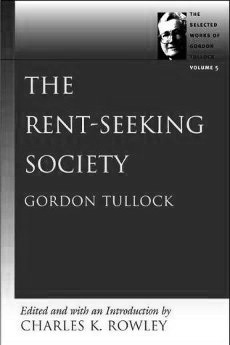Gleichberechtigung ist nicht Gleichstellung
7. Mai 2012 – Kai Rogusch über die aus freiheitlicher und rechtsstaatlicher Sicht verhängnisvolle Gleichsetzung zweier Konzepte.
Zuerst erschienen in NovoArgumente 110/111 (1–4 2011)

Wer das Verhältnis zwischen Gleichberechtigung, Gleichstellung und menschlicher Freiheit erschließen möchte, stößt auf ein facettenreiches Thema. Zuletzt war beispielsweise die Frauenquote in einer doch so traditionsbewussten und konservativen Partei wie der CSU Anlass für Auseinandersetzungen zwischen fitten Mädels aus der bayerischen Jungen Union, die sich selbstbewusst genug gaben, die Männer auf dem Weg nach oben in die Tasche stecken zu wollen, und Frauen-Fraktionen, die ihre mittlerweile angeblich ernüchternden Erfahrungen angesichts bornierter Männerbünde zum Besten gaben.
 Eine weitere Facette des Gleichstellungsthemas liefert die anhaltende Integrationsdebatte, die den Schutz der Minderheiten, das multikulturelle Neben- und Miteinander der Religionen und die Debatte über Thilo Sarrazin betrifft. Der Übergang der eher formalrechtlichen und verfassungsrechtlich verbürgten Gleichberechtigung, die dem Bürger neutral gegenübertritt und ihn nicht besonders behelligt, zur interventionistischen Gleichstellungspolitik veranlasst uns zu der Frage, wo bei der ganzen Angelegenheit die Freiheit bleibt.
Eine weitere Facette des Gleichstellungsthemas liefert die anhaltende Integrationsdebatte, die den Schutz der Minderheiten, das multikulturelle Neben- und Miteinander der Religionen und die Debatte über Thilo Sarrazin betrifft. Der Übergang der eher formalrechtlichen und verfassungsrechtlich verbürgten Gleichberechtigung, die dem Bürger neutral gegenübertritt und ihn nicht besonders behelligt, zur interventionistischen Gleichstellungspolitik veranlasst uns zu der Frage, wo bei der ganzen Angelegenheit die Freiheit bleibt.
Die Gleichberechtigung, die seit dem Einsetzen der Aufklärung erkämpft wurde, hat im 20. Jahrhundert einen eindrucksvollen Siegeszug genommen und ist in den westlichen Staaten zumindest theoretisch unumstritten. Jeder Bürger, gleich welchen Geschlechts und gleich welcher Abstammung, Weltanschauung oder Rasse, darf sich an freien und gleichen Wahlen beteiligen; ihm werden keine unsachgemäßen juristischen Hürden bei der Ergreifung eines Berufes in den Weg gelegt; auch die Rassentrennung existiert nicht mehr. Auch auf gesetzlicher Ebene hat sich viel getan: Frauen können seit zehn Jahren bei der Bundeswehr Karriere machen. Vor allem dem Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau aus dem Jahr 1957 ist es zu verdanken, dass die Ehe, zumindest rechtlich gesehen, von den Partnern auf gleicher Augenhöhe gelebt werden kann. Das Letztentscheidungsrecht des Ehemannes wurde gestrichen, die Ehefrau konnte von nun an ihr in die Ehe eingebrachtes Vermögen selbst verwalten. Seit 1977 darf die Ehefrau ohne Einverständnis des Ehemannes erwerbstätig werden. Ein weiterer, wenn auch immer noch umstrittener Meilenstein (der im Übrigen an die im Folgenden zu behandelnde „Gleichstellung“ grenzt) ist die durch die rot-grüne Bundesregierung durchgesetzte Möglichkeit gleichgeschlechtlicher Lebenspartner, eine eheähnliche Lebensbeziehung einzugehen.
In den letzten Jahrzehnten ist das Konzept der Gleichstellung in den Vordergrund gerückt. Hier geht es, anders als bei der bloßen Gleichberechtigung, um etwas, woran sich nicht wenige Geister scheiden, nämlich um die aktive Forcierung gleicher Lebenschancen durch eine gezielte Intervention in gesellschaftliche Prozesse und Traditionen. Dahinter steht der Gedanke, dass tradierte Normen und Gewohnheiten eine unsichtbare und oft unausgesprochene Schranke darstellen, die das Versprechen bloßer Gleichberechtigung zu einer Illusion macht. „Wo bleibt die Freiheit?“, fragen viele Verfechter der Geschlechtergleichheit zurück, wenn die herkömmliche Rolle der Hausfrau so fest in den Köpfen der Personalabteilungsleiter von Unternehmen verankert ist, dass sie Karrierepfade letztlich nur Männern eröffnen? „Wo bleibt die Freiheit?“, fragen sich nicht wenige Migranten, wenn sie keine ansprechende Wohnung finden, weil der Wohnungseigentümer eine verborgene Abneigung gegen Menschen anderer Hautfarbe hegt?
Im Zuge der politischen Bemühungen um Gleichstellung haben sich verschiedene Gleichstellungspraktiken etabliert, die auf sehr unterschiedlichen Philosophien beruhen. „Gleichstellungspolitik“ im Sinne der Antidiskriminierungsgesetze und des sogenannten „Gender Mainstreaming“ wurde in den letzten Jahren vor allem von linksgerichteten Strömungen forciert. Doch diese Politik hat nicht in erster Linie die „Gleichheit der Ergebnisse“ im Blick, sondern sie zielt im Kern auf eine „objektivere“ Herbeiführung ungleicher sozialer Positionierungen. Eine andere Art von Gleichstellungspolitik sah u.a. der F.A.Z.-Wirtschaftsredakteur Rainer Hank in der vom Bundesverfassungsgericht betonten Gewährleistung eines „sozio-kulturellen Existenzminimums“, die er, wie Guido Westerwelle, als eine fast „sozialistische“ Variante kennzeichnete. Verstünde man Gleichstellungspolitik in diesem vielleicht doch zu weiten Sinne, dann müsste man wohl auch umverteilende Steuerpolitik, die Bereitstellung öffentlicher Güter, die jedermann zugänglich sind – also viele Aspekte von der Schulpolitik bis hin zur Verkehrspolitik –, als Gleichstellungspolitik betrachten. Denn überall geht es hier auch darum, unterschiedliche Ausgangslagen zu verändern und Menschen unterschiedlicher Herkunft oder unterschiedlichen Leistungsvermögens in den gleichen Stand zu versetzen.
„Doch wo bleibt die Freiheit?“, fragen sich Menschen, die sich mit Grausen an stalinistische Gesellschaftsprogramme erinnern. Auch heute, in Zeiten einer globalisierten Marktwirtschaft, in der das Thema der ökonomischen Ungleichheit virulent ist, lässt sich der freiheitsfeindliche, antidemokratische und so paradox obrigkeitliche Charakter der Gleichstellungspolitik, besonders, was die inzwischen nahezu europäisierte Antidiskriminierungspolitik der letzten zehn Jahre betrifft, deutlich aufzeigen. Zwar lässt sich trefflich argumentieren, dass „gleichmacherischer“ staatlicher Interventionismus unter bestimmten Bedingungen durchaus die Freiheit des Einzelnen fördern kann. Staatliche „Gleichmacherei“ vermag die Freiheit des Einzelnen und den freiheitlichen Rahmen womöglich zu fördern, wenn damit bislang verbonzte Erstarrungen aufgebrochen werden, die ein gesamtgesellschaftlich deutlich wahrnehmbares Ungleichgewicht darstellen und die bislang unüberwindlich erscheinende soziale Gräben verursachen. Eine so verstandene „Gleichmacherei“ wäre im Sinne der Freiheit dann zu rechtfertigen, wenn erstickende, einschnürende, sich immer wiederholende und verdrießliche Lebensverhältnisse durch frischen Wind und neues Licht zum Blühen gebracht werden.
Die Zukunftsoffenheit, das Aufzeigen neuer Lebensperspektiven und die Erweiterung persönlicher wie auch kollektiver Handlungsmöglichkeiten können aber nur dann befördert werden, wenn die Gleichstellungspolitik überhaupt von der Freiheit und Mündigkeit des Einzelnen ausgeht, wenn sie als hauptsächliches Ziel die persönliche Freiheit anstrebt und im Rahmen eines demokratischen Gemeinwesens entsteht, das keinen Raum für obrigkeitliche Anmaßungen lässt. Davon kann bei der Antidiskriminierungsgesetzgebung eben nicht die Rede sein. Auf diese Politik einzugehen ist vor allem deshalb interessant, weil es sich bei der Antidiskriminierungspolitik um eine, wie ich es nennen möchte, „Meta-Gleichstellungspolitik“ handelt. Es handelt sich hier um einen übergreifenden Ansatz in der Gleichstellungspolitik, der die Bürger in ganz viele unterschiedliche „Minderheiten“ und Subkulturen aufspaltet, die es voreinander zu schützen gilt. Das Thema Gleichstellung an der Antidiskriminierungspolitik und dem damit zusammenhängenden „Multikulturalismus“ zu veranschaulichen, lohnt sich aber auch deswegen, weil sich gerade dieser Tage ein problematisches, aber auch menschlich verständliches „Aufbegehren“ der Bürger gegen eine, wenn man so will, „diffuse Obrigkeitskultur“ offenbart.
Als vor mehr als fünf Jahren das Antidiskriminierungsgesetz in den Bundestag eingebracht wurde, erhob sich ein „Aufschrei“ dagegen. Die F.A.Z. sprach von einem „jakobinischen Tugendterror“, von einem neuen Totalitarismus, und die Wirtschaftsverbände malten eine „monströse Bürokratie“ an die Wand. Anlass dieser Befürchtungen war das Bestreben der rot-grünen Bundesregierung, eine „Kultur der Antidiskriminierung“ zu schaffen, indem nun der Grundsatz der Gleichbehandlung nicht mehr nur für staatliche Organe, sondern auch im Verhältnis der Bürger untereinander gelten solle. Woran viele sich aber nicht so gerne erinnern, ist, dass diese Antidiskriminierungspolitik im Wesentlichen ihren Ursprung in der Europäischen Union hat, deren Entscheidungsabläufe dermaßen intransparent und ungreifbar sind, dass eigentlich keiner in der Lage war, das ganze Ausmaß des gesetzgeberischen Machwerkes demokratisch auch nur ansatzweise zu erörtern. Wovor viele nach wie vor gerne die Augen verschließen, ist die überwältigende Bereitschaft in der Politik und in den Medien, sich einem deterministischen Denken in Sachzwängen hinzugeben und Richtlinien der EU vorbehaltlos abzunicken, als kämen sie von einer Autorität, die man auf gar keinen Fall infrage stellen dürfe.
Dass die Politik heute vielen Bürgern verantwortungslos und unmenschlich erscheint, dafür bietet die Antidiskriminierungspolitik ein guten Grund. Das rächt sich nun in Form eines bürgerlichen „Aufbegehrens“ wie bei „Stuttgart 21“. Wirtschaftlicher Fortschritt wird dadurch erschwert. Oder es gibt, in Anlehnung an Sarrazin, verstörende „Tabubrüche“ gegen unterprivilegierte Menschen. Die Antidiskriminierungspolitik ist demnach ein Paradebeispiel für eine Politik, die freiheitsfeindlich und vor allem auch antidemokratisch ist, weil sie von einer ungreifbaren Warte aus das Leben der Bürger einschneidend verändert.
Worin liegt der freiheitsfeindliche Kern der Antidiskriminierungspolitik? Der erste Aspekt besteht darin, dass ein Meta-Ansatz in der Gleichstellungspolitik verfolgt wird, der die Gesellschaft in verschiedene Subkulturen und Minderheiten einteilt, in Alte und Junge, in Angehörige verschiedener Religionen und Weltanschauungen, in Gesunde und Behinderte usw. Ziel ist es, allen diesen Untergruppen Schutz vor Diskriminierungen, also Schutz vor unsachgemäßen Ungleichbehandlungen und auch „Belästigungen“ zu gewähren. Dieser Schutz, und darin liegt das erste hier anzusprechende autoritäre, obrigkeitsstaatliche Element der Antidiskriminierungspolitik, soll sich gegen Menschen richten, die so sehr in ihrer Minderheitenidentität be– und gefangen sind, dass, so die Begründung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), „unbewusste Ressentiments“ und „tradierte Vorurteile“ zu alltäglichen Unfreiheiten führten. Es handelt sich also um ein Gesetz, das Menschen in verschiedenen kulturellen, religiösen, herkunftsbezogenen oder auch biologischen Identitäten verhaftet sieht und so möglicherweise, gerade indem es die Bewusstmachung und Bekämpfung vorurteilsbehafteten Verhaltens anstrebt, in Wirklichkeit stereotypes Schubladendenken gerade erst befördert. So werden Menschen von oben herab festgelegt.
Ein weiterer freiheitsfeindlicher Aspekt der Antidiskriminierungspolitik liegt darin, dass die konzeptionelle Aushöhlung der Vertragsfreiheit betrieben wird, eines unerlässlichen Kernbestandes jeder freiheitlichen Wirtschafts- und auch Gesellschaftsordnung. Freiheitliche Lebensgestaltung, vor allem im unternehmerischen Gewerbe, wird erschwert, wenn bei der Auswahl, Bevorzugung und Besserbehandlung von Vertragspartnern nur noch „sachliche“ Entscheidungsgesichtspunkte gelten, wenn also alle „willkürlichen“ Beweggründe verboten sind. Wenn alles objektiv vorgegeben ist, kann man sich nicht mehr frei entscheiden. Betrachtet man das AGG, so zeigt sich, wie allumfassend der Angriff auf die Vertragsfreiheit ist. Ungleichbehandlungen und „Belästigungen“ aufgrund von „Rasse“, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, sexueller Vorlieben, Alter oder Behinderung sind untersagt. Dieses Diskriminierungsverbot reicht vom Abschluss eines Arbeitsvertrages über die Behandlung von Arbeitnehmern durch ihre Vorgesetzten oder Arbeitskollegen bis zu Vertragsverhandlungen- und -abschlüssen im öffentlichen Leben. Den freien Gewerbetreibenden oder Unternehmer versetzt man hier in den Stand eines Staatsbeamten: Schreibt er eine Stelle öffentlich aus, muss er bei der Einstellung eines neuen Mitarbeiters das Neutralitätsgebot beachten und darf nur noch nach „sachlichen“ Gesichtspunkten einstellen.
Einschneidend auf die Souveränität und die freie Entscheidungsfähigkeit von Unternehmern, Gaststättenbesitzern und anderen Bürgern wirkt sich des Weiteren die tendenzielle Aushöhlung der Unschuldsvermutung aus – eine der grundlegendsten Errungenschaften demokratischer Rechtsstaaten. Weil das AGG eine Beweislastverlagerung vorsieht, verlagert es auch die Rechenschaftspflicht vom Staat auf den Bürger. Auf diese Weise eröffnen sich Spielräume für eine Politik, die darauf ausgerichtet ist, „Gesinnung“ und Motive der Bürger auszuforschen und bei Bedarf zu sanktionieren. So muss im Falle einer Diskriminierungsklage nur noch die überwiegende Wahrscheinlichkeit des Vorliegens einer „Diskriminierung“ glaubhaft gemacht werden. Die verklagte Partei muss dann beweisen, keine der verdächtigen Beweggründe bei der Benachteiligung eines potenziellen Vertragspartners verfolgt zu haben.
Um diesen fast schon orwellschen Zug der Antidiskriminierungspolitik zu veranschaulichen, ist es hilfreich, sich in die Lage eines verklagten Gastwirtes zu versetzen, der eine Gruppe von 21-jährigen Indern oder Türken mit der schlichten Begründung, sie seien ihm noch zu jung, auffordert, die Kneipe zu verlassen. Dies mag den lebensfremden Charakter moderner Gleichstellungspolitik aufzeigen; doch noch klarer zeigt sich hier der anmaßende, „oberlehrerhafte“ Zug der Politik: Der Gastwirt müsste nun beweisen, die unerwünschten Gäste aus keinem der „verbotenen“ Gründe aus seinem Wirtshaus gewiesen zu haben. Denn er „diskriminiert“ die jungen Erwachsenen sicher wegen ihres Alters, aber „vermutlich“ auch noch wegen ihrer ethnischen Herkunft. Solches ist in der gesellschaftlichen Praxis noch kaum anzutreffen, aber der „gedankenpolizeiliche“ Ansatz ist unschwer zu erkennen. Eine früher unvorstellbare Einschnürung des rechtlich erlaubten Handlungsspielraums vor allem der kleineren Unternehmer offenbart sich heute auch in den kleinlichen Antirauchergesetzen, die den Alltag zunehmend „regulieren“.
Man täusche sich nicht: Das Prinzip der Unschuldsvermutung gilt zwar zunächst einmal nur für strafrechtliche Sachverhalte. Doch es hat seinen breiteren philosophischen Sinn überall, wo es darum geht, das notwendigerweise immer bestehende Obrigkeitsverhältnis zwischen Staat und Bürger (welches in der fortwährenden Möglichkeit des Staates besteht, den Bürger zu gängeln) dadurch abzumildern, dass der Staat einer strengen Beweispflichtigkeit ob der Notwendigkeit von Freiheitseinschränkungen der Bürger unterliegt. Durch die Verlagerung der Beweispflicht auf den einfachen Bürger und die damit ermöglichte Ausforschung seiner Motive begründet sich ein obrigkeitsstaatliches Verhältnis, das dem demokratischen Grundgedanken hohnspricht.
Was die Rolle des demokratischen und souveränen Staatsbürgers weiter schwächt, ist die Konstruktion schwacher, fast subjektloser Individuen. So vollzieht sich ein Angriff auf das freiheitliche Menschenbild aktiver, widerstandsfähiger und mündiger Menschen, die sich kollektiv und auch politisch selbst organisieren können. Sie erscheinen von nun an verstärkt als schutzlose Angehörige einer Minderheit, die mittels unbestimmter Rechtsbegriffe vor den „Belästigungen“ anderer, durch das AGG konstruierter, „Minderheiten“ geschützt werden sollen. Das ist auch deshalb problematisch, weil einerseits ein höfliches und respektvolles Miteinander der Bürger untereinander selbstverständlich erwünscht ist, sich aber ein zivilisiertes Verhalten, das auf informellen und spontanen Übereinkünften beruht, wohl kaum mittels drakonischer Gesetze bewirken lässt. Hier werden die Konturen einer Politik sichtbar, die auf eine völlige Durchnormierung eigentlich selbstverständlichster moralischer und sittlicher Übereinkünfte hinausläuft. Genauso wichtig ist es aber auch zu erkennen, dass eine derartige Politik auf ein deutlich schwächeres Menschenbild hinausläuft, das dafür sorgt, die Fähigkeit der Bürger und vor allem auch der Arbeiterschaft zur kollektiven Selbstorganisation zu schwächen: Die Basis eines kooperativen Miteinanders schwindet, wenn einander misstrauisch beäugende „Minderheiten“ sich gegenseitig juristisch bekriegen.
Unternehmern wird mittlerweile die Rechtspflicht auferlegt, in ihren Betrieben für ein „diskriminierungsfreies“ Arbeitsklima zu sorgen und organisatorische Vorkehrungen dafür zu treffen, dass die Mitarbeiter einander nicht „belästigen“. Kommen die Unternehmer dieser Pflicht nicht nach, trifft sie selbst der Vorwurf der „Diskriminierung“. Erschwert wird dies noch dadurch, dass das AGG auf eine Entmündigung nicht nur des Unternehmers, sondern vor allem seiner Mitarbeiter hinausläuft, denen man die Fähigkeit zur eigenverantwortlichen Bewältigung alltäglicher Konflikte in den Betrieben nicht mehr ohne Weiteres zutraut. Die Haftung des Unternehmers für „belästigende“ Untaten seiner Arbeiter und Angestellten hat zur Folge, dass deren Kraft zur eigenverantwortlichen Selbstorganisation schwindet und durch lehensähnliche Beziehungen abgelöst wird. Es bleibt deshalb ein Rätsel, warum gerade die Gewerkschaften, die ein vitales Interesse an der Selbstorganisationskraft ihrer Mitglieder haben sollten, sich auf eine derartige Geringschätzung der Fähigkeiten von Arbeitern und Angestellten einlassen. Zwar wachsen auf den ersten Blick die Möglichkeiten von Gewerkschaften und Betriebsräten, sich aus ihrer Position der Defensive, in die sie in den letzten Jahren gedrängt wurden, mittels der neuen AGG-Aufgaben hinauszumanövrieren. Letztlich aber untergräbt die Antidiskriminierungspolitik jene Möglichkeiten kollektiver Selbstorganisation, die die Gewerkschaften einst zu schlagkräftigen Organisationen hatten werden lassen.
Die Aufsplitterung der Menschen in zahllose Subkulturen, die mit der Aushöhlung der Vertragsfreiheit, der Aushebelung der Idee der Unschuldsvermutung und einer vertrauensvollen Basis kooperativen Miteinanders einhergeht, ist der Hintergrund für den im Folgenden zu behandelnden Aspekt der Antidiskriminierungspolitik, der die „Auslagerung“ wichtiger Bereiche der politischen Deliberation und der Entscheidungsfindung an Expertengremien betrifft. Ein verstärkt technokratischer und zugleich verantwortungsloser Politikmodus ist entstanden, und er überträgt sich auf das gesellschaftliche Leben. Die EU-Gleichstellungspolitik ist ein treffendes Beispiel dafür, dass sich die Politik vom Menschen „befreit“ hat, aber gleichzeitig aus einer Warte der Ungreifbarkeit heraus ein desorientiertes Unbehagen bewirkt.
Da die Antidiskriminierungspolitik überwiegend Ergebnis von Gesetzgebungsprozessen ist, die sich auf der EU-Ebene abspielen, gilt es hier, den Zusammenhang des häufig beklagten sogenannten „Demokratiedefizits“ mit dem oben genannten obrigkeitsstaatlichen Charakter der Antidiskriminierungsgesetze zu beleuchten. Vordergründig behandeln die Schriften über das sogenannte „Demokratiedefizit“ der EU vor allem den Umstand, dass in der EU-Gesetzgebung solche Organe eine bestimmende Rolle innehaben, die dem Bereich der Exekutive zuzurechnen sind. Des Weiteren sind der EU, vor allem seit dem Vertrag von Maastricht 1992, schrittweise neue Kompetenzen in der Gesetzgebung eingeräumt worden, die nun, deutlich erkennbar an dem aus dem „Verfassungsvertrag“ hervorgegangenen Lissabonner Vertrag, in weitere Kernbereiche der Staatlichkeit vordringen.
Anhand der EU-Antidiskriminierungspolitik wird deutlich, dass einschneidende Regelungswerke schon seit etlichen Jahren das Leben der Bürger erheblich bestimmen. Im Wesentlichen handelt es sich bei den fraglichen Vorschriften bislang um vier „Richtlinien“ aus den Jahren 2000 bis 2004:
-
Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 28. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft (ABl. EG Nr. L 188 S. 22) – die sogenannte Antirassismusrichtlinie
-
Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (ABl. EG Nr. L 303 S. 16) – sogenannte Rahmenrichtlinie Beschäftigung
-
Richtlinie 2002/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 76/207/EWG des Rates zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen (ABl. EG Nr. L 269 S. 15)
-
Richtlinie 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen (ABl. Br. L 373 vom 21.12.2004 S. 37–43) – sogenannte Gender-Richtlinie
Diese vier Richtlinien – neuere sind fortlaufend in Produktion – machen den nationalen Parlamenten verbindliche Vorgaben für eine nationalstaatliche „Umsetzung“. Sie enthalten alle berüchtigten Kernelemente und Probleme des AGG. Sie entstanden unter Aufhebung des für freiheitliche Demokratien unerlässlichen Grundsatzes der Gewaltenteilung. Das alleinige Initiativrecht für Rechtsakte auf EU-Ebene liegt bei der Kommission, einer supranationalen Behörde, die zusammen mit dem im jeweiligen Fachgebiet zusammentretenden Ministerrat allgemeinverbindliche Rechtsakte erlässt. Zwar wurde ein geringerer Teil der AGG-Vorgaben unter „gleichberechtigter“ Mitwirkung des europäischen Parlaments erlassen. Doch auch ihm fehlt der für einen demokratischen Parlamentarismus zentrale Rang einer mit entsprechenden Kompetenzen ausgestatteten Volksvertretung. Auf diese Weise wird das demokratische Prinzip, demzufolge die Legitimitätskette bei der Setzung gesellschaftlicher Weichenstellungen in Form von Gesetzen „von unten nach oben“ verlaufen soll, ausgehebelt.
Weder der EU-Ministerrat noch die EU-Kommission müssen sich als Ganzes einer direkten Wahl durch ein „europäisches Staatsvolk“ stellen. Lediglich die einzelnen Mitglieder des EU-Ministerrates sind, wenn auch immer noch recht indirekt, durch die in den nationalstaatlichen Rahmen organisierten Wahlakte legitimiert. Doch in diesen nationalen Wahlen, die innerhalb Europas zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten und in verschiedenen Organisationsprozeduren abgehalten werden, spielt die eigentliche europäische Politik des EU-Ministerrates kaum eine Rolle.
Was die sehr ungreifbare und automatisierte Natur der europäischen Gesetzgebung weiter verstärkt, ist die mächtige Rolle der Kommission, die, als Institution, noch viel „unabhängiger“ vom Bürgerwillen ist als der EU-Ministerrat, aber das alleinige Initiativrecht für europäische Rechtsakte innehat. Das bedeutet zum einen, dass auch die Antidiskriminierungsrichtlinien der EU oft von der Handschrift der Kommissionsbürokratie geprägt sind. Jeder Rechtsakt, der einmal auf der Ebene der EU erlassen worden ist, bleibt bestehen. Ohne die EU-Kommission bewegt sich nichts. Auch der Antidiskriminierungspolitik wird daher ein langes Eigenleben beschieden sein. Noch unheimlicher ist die Tatsache, dass diese institutionell nach außen wenigstens erkennbare Ungreifbarkeit europäischer Macht nur die Oberfläche darstellt, unter der sich ein Großteil des eigentlichen Gesetzgebungsprozesses abspielt.
Sehr instruktiv ist das Werk des Bremer Europawissenschaftlers Sebastian Huster, der in der 2008 erschienenen Untersuchung Europapolitik aus dem Ausschuss. Innenansichten des Ausschusswesens der EU (Wiesbaden 2008) aufzeigt, dass „unbemerkt von der Öffentlichkeit, den Medien oder der Wissenschaft“ sich das „Ausschusswesen im europäischen Politikprozess zu einem verborgenen Machtapparat entwickelt, der durch richtungsweisende Vorentscheidungen die EU-Gesetzgebung entscheidend beeinflusst“ (S. 25). Danach gibt es allein in der EU-Kommission zur Erarbeitung von Rechtsakten über 3000 Arbeitsgruppen. Huster stellt fest, dass selbst die EU-Kommission keinen genauen Durchblick in dem Wirrwarr der verschiedenen Vorbereitungsgremien habe (S. 29). Ähnliches zeigt sich bei den über 200 Arbeitsgruppen des Rates, die im Geheimen agieren. Sie sind den Ministerräten, dem „faktischen Hauptgesetzgeber der EU“, vorgeschaltet, und so „verfügen diese Arbeitsgruppen über eine zum Teil beträchtliche Gestaltungsautonomie. Ein großer Teil der Ratsentscheidungen wird bereits hier entschieden“ (S. 38). Jedoch werde, so der Europawissenschaftler, „auch dem komplexen Ausschusssystem des Rates bislang vonseiten der Europaforschung wenig Aufmerksamkeit geschenkt“, weil „das Untersuchungsobjekt lange Zeit nur schwer zu identifizieren war“ (S. 29). Mit anderen Worten: Rechtsakte wie die zur Antidiskriminierung oder Gleichstellung werden von nicht gewähltem Personal erarbeitet und maßgeblich vorgeprägt, und die Handelnden sind nicht einmal in wissenschaftlichen Kreisen bekannt.
Derlei anonyme, unfassbare und automatisierte Gesetzgebungsprozesse, die sich in der politischen Praxis mittlerweile etabliert haben, sind geradezu darauf angelegt, für Unruhe, Unbehagen und sogar Obstruktionismus, wie wir ihn bei den Protesten gegen „Stuttgart 21“ erleben, zu sorgen. Die Politik erscheint Bürgern heute dermaßen diffus, fremdgesteuert und außerhalb jeglicher Einflussnahme, dass sie zu Protesthaltungen animiert. In der Bevölkerung hat sich der Eindruck gefestigt, dass politische Entscheidungen automatisiert und von Arbeitsbienen, nicht mehr von Menschen, getroffen werden, In der Kaste der funktionalen Eliten werden Entscheidungen von sehr einschneidender und weitreichender Bedeutung zwar implementiert und forciert, aber nicht mehr verantwortet. Hierbei handelt es sich um Entscheidungen, die, weil sie keinen greifbaren Verantwortungsträgern mehr zugerechnet werden können, eigentlich Nicht-Entscheidungen sind und die auch inhaltlich die anonymisierte und stereotypisierte Verantwortungslosigkeit in das übrige gesellschaftliche Leben einsickern lassen.
Die EU-Antidiskriminierungspolitik, die von nationalen Parlamenten brav vollstreckt wurde, ist beispiellos für die Auflösung verantwortlicher Freiheit in Politik und Gesellschaft. Man kann deutlich erkennen, wie sich die dargelegte anonymisierte Verantwortungslosigkeit auf unmenschliche Weise auf die Lebenswirklichkeit vieler Bürger überträgt. Diese entmündigende Stoßrichtung spiegelt sich in den Inhalten des AGG fort: Da jeder, der sich der „willkürlichen“ Behandlung seines Gegenübers im Wirtschaftsleben verdächtig macht, aufgrund der Beweislastverlagerung vor dem Arbeits- und Zivilgericht beweisen muss, bei der Ungleichbehandlung lediglich „erlaubte“ Beweggründe herangezogen zu haben, setzt sich die Verlagerung der Rechenschaftspflicht – weg von der „Elite“ und hin zum Bürger – auch auf der gesellschaftlichen Ebene fort. In der gesellschaftlichen Praxis droht das AGG, besonders im Arbeitsleben, inhumane Verhältnisse herbeizuführen. Jeder Arbeitgeber, der in irgendeiner Form den Eindruck erweckt, nicht nach rein „sachlichen“ Entscheidungskriterien vorzugehen, macht sich durch das AGG angreifbar. Dies geht mit einem wachsenden Verlangen einher, die eigene sogenannte „Entscheidung“ von externen, „objektiven“ Stellen abhängig zu machen, die „allgemein anerkannte“ Zertifikate und sonstige Referenzen ausstellen. Der immer häufiger zu hörende Rat, künftig verstärkt sogenannte „Assessment Center“ mit der Auswahl von Bewerbern zu betrauen, passt zu diesem Trend.
Mit dem Pilotvorhaben, anonymisierte Bewerbungen einzuführen, erreichen diese Phänomene nunmehr auch die gesellschaftliche Wirklichkeit im Arbeitsleben. Diese Entwicklung eines subjektlosen Unwesens konnte man schon vor dem Inkrafttreten des AGG ansatzweise erkennen, als Unternehmensberater bereits dazu rieten, Bewerbungsunterlagen und Gesprächsverläufe sorgfältig zu dokumentieren, dabei Vorsicht walten zu lassen und es besser zu unterlassen, mit freundlichen Plaudereien herausfinden zu wollen, ob ein Aspirant zum Unternehmen passt, stattdessen die Gespräche immer zu zweit zu führen und Ablehnungen eines Bewerbers auf keinen Fall persönlich zu begründen.
Die Auswüchse der Sarrazin-Debatte passen zu den beschriebenen Trends. Man kann Sarrazins Buch für ein abstoßendes, in seinen Grundzügen zynisches und sozialdarwinistisches Machwerk halten, und der positive Anklang des Buches in der Bevölkerung könnte verärgern. Zudem gewinnt man aber den Eindruck, dass seine positive Rezeption auch eine sehr verständliche Reaktion auf das ist, was man einen von oben herab verordneten, das Gesellschaftsleben bis ins Kleinste durchregulierenden und desorientierenden „Multikulturalismus“ nennen möchte. Ähnlich gelagert wie die Proteste gegen „Stuttgart 21“ stellt die Sarrazin-Begeisterung möglicherweise eine natürliche Reaktion auf den Umstand dar, dass angesichts der tendenziellen Normierung auch selbstverständlichster moralischer Regeln breite Bevölkerungsschichten Freiheit nur noch bei bislang indiskutabler Political Incorrectness, wie sie von Leuten vom Schlage Sarrazins praktiziert wird, empfinden und erleben.
Das Interessante an Sarrazin ist jedoch, dass er im Grunde genommen ein zumindest genauso freiheitsfeindliches, ein ebenso anmaßendes, ein das Leben bestimmter Gesellschaftsschichten durchregulierendes Konzept im Sinne hat. Der „Sarrazinismus“ betreibt das, was ich eine Anti-Gleichstellungs-Politik nennen möchte, die sich gegen unterprivilegierte Gesellschaftsgruppen richtet und so auch die viel grundlegendere Gleichberechtigung angreift. Beide Erscheinungen, die Gleichstellungspolitik in Form der AGG und die Sarrazin-Denke offenbaren den Hang, ihr Augenmerk auf kulturelle, herkunftsbezogene, religiöse und auch biologische Unterschiede zu lenken.
Kai Rogusch ist Jurist und lebt in Frankfurt am Main. Der vorliegende Text basiert auf einem Vortrag, den der Autor am 8.10.2010 beim „7. Karlsruher Verfassungsdialog“ der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit / Reinhold-Maier-Stiftung Baden-Württemberg in Karlsruhe hielt.
In Novo108/109 (9–12 2010) argumentierte Rogusch in seinem Artikel „Sozialstaats-Debatte: Die Dekadenz kommt von oben“, dass die Politik es aufgegeben habe, die Gesellschaft zu neuen Ufern führen zu wollen.
Weitere Artikel zu diesem Thema finden Sie im Dossier „Europa“ unter novo-argumente.com.