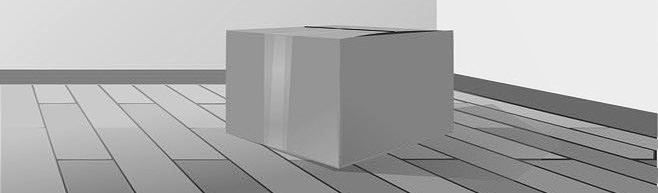Gleichstellungspolitik an Hochschulen
In westlichen Regierungen wie auch in internationalen Organisationen hat sich zusehends ein Staatsfeminismus institutionalisiert, dessen Basis die abstrakte Vorstellung eines „Patriarchats“ bildet. Doch sowohl in theoretischer wie auch empirischer Hinsicht ist die These des „Patriarchats“ nicht haltbar.
1. Die allgemeine These der Frauendiskriminierung durch das „Patriarchat“
Die konkreten frauenpolitischen Konzepte der Gegenwart enthalten eine Weltsicht, in der die Frauen als Opfer innerhalb des umfassenden, aber nicht näher theoretisch gefassten oder erklärten Systems des „Patriarchats“ von den Männern beherrscht und diskriminiert werden. Wegen der vermeintlichen Allgemeingültigkeit dieser Hintergrundaussage scheint es dann auch kaum noch notwendig zu sein, die realen Verhältnisse konkret, empirisch, differenziert und ergebnisoffen zu untersuchen.
Auf eine solche wissenschaftliche Zielsetzung kommt es dem Feminismus aber gar nicht an. Er benötigt für seine Interessen einen Kampfbegriff, dessen Gehalt höchst vage bleiben mag, wenn er nur als Instrument im Geschlechterkampf verwendet werden kann. Aus wissenschaftlicher Perspektive kann allerdings sowohl in theoretischer wie in empirischer Hinsicht von einem angeblichen „Patriarchat“ keine Rede sein (Diefenbach 2012). „Patriarchat“ ist ein Kampfbegriff, der politisch nichts zu legitimieren vermag.
Heike Diefenbach schreibt dazu auf S. 20 f.:
“Die Auffassung, dass derzeit ein Patriarchat in mehr oder weniger allen Gesellschaften der Erde herrsche oder ‚zählebige [patriarchalische] Grundstrukturen‘ (Klenner 2002) (nahezu) überall auf der Welt, auch in postindustriellen, modernen Gesellschaften, Frauen systematisch benachteiligten, ist die Basis des Staatsfeminismus, wie er nicht nur von einzelnen Staatsregierungen, insbesondere in der westlichen Welt, seit den 1960er-Jahren institutionalisiert worden ist, sondern als leitende sozialpolitische Idee auch in internationalen Organisationen (wie z. B. der EU) etabliert ist. Ein Nachweis darüber, dass diese Auffassung in der Realität zutrifft, erfolgt im Rahmen des Staatsfeminismus nicht. Anscheinend wird aus der Tatsache, dass Frauenpolitik weltweit in staatlichen Organisationen verankert ist, geschlossen, dass sie notwendig sein müsse, und von dieser Notwendigkeit wiederum wird auf die Existenz umfassender patriarchalischer Strukturen geschlossen. Deren Behauptung soll Fördermaßnahmen für Frauen begründen wie z. B. die Einrichtung von Positionen für Frauenbeauftragte in öffentlichen Verwaltungen und an Hochschulen und eine Vielzahl von Mentoring- und Coachingprogrammen für Frauen.“
2. Die feministische Diskriminierungsthese im Hochschulbereich

Vor diesem Hintergrund wird heute in der Regel mit dem Hinweis auf eine statistische Unterrepräsentanz von Frauen operiert. Diese ist jedoch methodisch-statistisch fragwürdig, weil sie reichlich schlicht am Frauenanteil in der Bevölkerung einerseits und z. B. am Frauenanteil an Professuren andererseits gemessen wird, und daraus wird dann das ethisch nicht weiter reflektierte und daher unbegründete Werturteil abgeleitet, diese Zahlenverhältnisse seien ungerecht. Dies soll im Folgenden am Beispiel der Hochschulen exemplarisch dargestellt werden.
Das fundamentale feministische Selbstverständnis, Opfer des Patriarchats zu sein, bedingt im Hinblick auf den Arbeitsmarkt und insbesondere die Bewerbungsverfahren an Hochschulen, dass explizit oder implizit folgendes behauptet wird:
a) Es gebe eine aktive wirksame männliche Diskriminierung von qualifizierten Kandidatinnen in der Warteschlange, die nur durch intensive Kontrollen (durch die Institution der Frauenbeauftragten) und rechtlich zwingende Einflussnahmen zu brechen sei, was impliziert, dass weiter behauptet werden muss, dass
b) die Anzahl qualifizierter Frauen für alle beruflichen Positionen mehr als ausreichend sei: Denn ohne eine solche tatsächlich vorhandene Warteschlange von qualifizierten Kandidatinnen könnte die Diskriminierungsbehauptung nicht aufrecht erhalten werden, da nicht existente Bewerberinnen weder diskriminiert noch ungerecht behandelt werden können.
Das hierauf basierende Politikkonzept kann als „nachfrageorientiert“ bezeichnet werden, weil die Probleme auf Seiten derjenigen gesehen werden, die am Arbeitsmarkt Arbeitskraft nachfragen, d. h. die die Stellen ausschreibenden gesellschaftlichen Organisationen, hier die Hochschulen.
4. Der Widerspruch zwischen ideologischer Diskriminierungsthese und Arbeitsmarktrealität
Wenn die empirische Testsituation – z. B. im Rahmen der Ausschreibung einer Professur – nun aber aufweist, dass trotz ausdrücklicher Hinweise in der Stellenausschreibung am Arbeitsmarkt und trotz der regelmäßigen und intensiven Suchprozesse in den weitgespannten Frauennetzwerken angebotsseitig entweder gar keine oder zu wenige oder aber zu gering qualifizierte Frauen auftreten – und eben das ist bisher häufig der Fall -, dann wird, um das nachfrageorientierte Konzept – zunächst Punkt (3 b), daraus folgend dann auch (3 a) – nicht aufgeben zu müssen, entgegen der tatsächlichen Lage um so nachdrücklicher behauptet, es gebe in jedem Falle genug Bewerberinnen, man – und das heißt hier die Berufungskommission – müsse einfach nur intensiver nach ihnen suchen.
Sozialpsychologisch erfolgt damit eine Schuldzuweisung für nicht vorhandene Sachverhalte zu Personen, die gar nicht beabsichtigen, sich diskriminierend zu verhalten, aber mit den Tatsachen des Arbeitsmarkts umgehen müssen. Da sich selbstverständlich die Zahl der qualifizierten Bewerberinnen durch eine längere Suche überhaupt nicht ändert, muss die Forderung nach weiterer Suche wiederholt werden. Es wird eine neue, zweite Ausschreibung der Stelle verlangt, danach eine weitere, dritte, usw. usf.; dies nenne ich: die Absurditätsspirale der nachfrageorientierten Frauenpolitik.
Werden im Laufe des Bewerbungsverfahrens tatsächliche Schwächen erkannt, dann führen sie bei Bewerbern umgehend zum Ausschluss aus dem Verfahren, während Bewerberinnen aufgrund des Einflusses der Frauenbeauftragten mit einer pauschal unterstellten allgemeinen gesellschaftlichen Benachteiligung entschuldigt und tendenziell im Verfahren gehalten werden. Es handelt sich somit um eine ideologisch begründete Sonderbegünstigung von Frauen.
Das nachfrageorientierte Politikkonzept offenbart jetzt, dass es faktisch auf Privilegierung setzt, was im klaren Widerspruch zur Diskriminierungsthese steht. Denn wenn es genügend qualifizierte Frauen gäbe, dann benötigten diese keine Sonderbegünstigungen; und wo diese doch eingefordert werden, dort hat bereits ein Bruch mit der Diskriminierungsthese und damit ihre Selbstwiderlegung stattgefunden: die nachfrageorientierte Frauenpolitik ist also in sich selbst widersprüchlich.
Aus all dem ergibt sich im Rahmen der nachfrageorientierten Politikkonzeption derzeit mit Notwendigkeit die Tendenz, offene Stellen nicht mit erstrangig, sondern mit zweitrangig qualifizierten Personen (im Hinblick auf Frauen ohnedies, aber auch im Hinblick auf Männer, weil die erstrangigen Kandidaten, die meist über mehrere Bewerbungs-Chancen verfügen, im Verlauf mehrfacher Ausschreibungen aus dem Bewerbungsprozess ausscheiden) zu besetzen, und dies nicht zügig, sondern stark verzögert.
Ein weiteres faktisches Ergebnis ist, dass überwiegend kinderlose Frauen besonders privilegiert werden, und dieser Privilegierung steht die Diskriminierung der betroffenen Männer samt Familien – und d. h. einschließlich der immer mit betroffenen weiblichen Familienmitglieder – gegenüber.
5. Die nachfrageorientierte Frauenpolitik beruht auf einer Fehldiagnose
Zwar gibt es in der Gegenwart im Hochschulbereich tatsächlich ein frauenpolitisches Problem, aber dieses liegt auf der Angebots- und nicht auf der Nachfrageseite.
Es gibt im Hochschulbereich, wie sich aus den Berufungsverfahren, die zugleich den Charakter empirischer Tests haben, je nach Fachgebiet häufig einfach zu wenig qualifizierte Frauen: d. h. promovierte und habilitierte Kandidatinnen an Universitäten bzw. an Fachhochschulen promovierte Kandidatinnen mit – im Hinblick auf ausgeschriebene Stellen – mindestens dreijähriger einschlägiger Berufserfahrung nach erfolgter Promotion. Hierbei spielen auch die freien Präferenzen und subjektiven Interessen der Studierenden bei der zeitlich vorgelagerten Wahl des Studiengangs eine wesentliche Rolle. So könnte es z. B. in den Ingenieurswissenschaften mehr weibliche Professoren geben, aber nur dann, wenn es zuvor deutlich mehr weibliche Studierende der Ingenieurswissenschaft und mehr Doktorandinnen gäbe, als das bisher der Fall ist. Falls sich jedoch aus solchen freien Präferenzen eine statistische Unterrepräsentanz ergeben sollte, dann wären diese aus Respekt vor der individuellen Berufswahl hinzunehmen. Es gibt keinerlei Berechtigung, hier politisch und normativ einzugreifen.
Die Qualifikationsanforderungen für Professuren sind vom Gesetzgeber um der Qualität der Lehre und Forschung willen, also mit sehr gutem und triftigem Grund, so hoch angesetzt worden, dass die weitaus meisten der Bewerber – und daher eben auch der Bewerberinnen – daran scheitern. Sicherlich könnte es im Hinblick auf das gesellschaftliche Potenzial mehr Kandidatinnen geben. Aber dieser Sachverhalt ist nicht Folge irgendeiner Diskriminierung, sondern Ergebnis freier Entscheidungen der potentiell betroffenen Frauen selbst. Denn diese selbst sind es, die sich für oder gegen eine in der Regel für Männer und Frauen gleichermaßen sozial risikoreiche, intellektuell extrem fordernde und strapaziöse Entscheidung zur Weiterqualifikation im Hinblick auf eine Hochschulkarriere entscheiden. Sie wissen, dass eine solche Entscheidung einen langen Atem ebenso braucht wie eine besondere Motivation zur wissenschaftlichen Arbeit, und sie wissen, dass sie auf diesem Weg auch scheitern können. Ohne einen hohen Grad an Entschlossenheit, Zielorientierung und Anstrengung ist auf diesem Feld jedenfalls für niemanden etwas zu erreichen.
Es liegt daher für befähigte junge Männer und Frauen in der Regel nahe, dass sie mit anderen beruflich oder privat wählbaren Möglichkeiten vergleichen, mit einer sofort erreichbaren attraktiven beruflichen Position etwa oder mit einer Familiengründung, und dass diese dann einer in der Regel riskanten, weil sozial prekären Hochschulkarriere vorgezogen werden.
Mutterschaft einschließlich der meist mehrjährigen intensiven Betreuungs- und Entwicklungsphase der Kleinkinder ist nicht nur eine Privatangelegenheit, sondern sie ist auch aus einer gesellschaftlichen Perspektive wichtig. Es geht dabei um die Geburtenzahl und um möglichst gute psychosozialen Entwicklungsbedingungen in der frühen Kindheit; letztere sind wichtig für die Herausbildung stabiler Persönlichkeiten. Kinderkrippen dürften solche Bedingungen in der Regel nicht bieten, und auch Kinderarmut steht dazu im Widerspruch.
Aus privatwirtschaftlicher, betriebswirtschaftlicher Sicht handelt es sich hierbei jedoch um externe Probleme, die zu Gunsten der Unternehmungen und damit zu Lasten der Familien gelöst werden. Aus Sicht der Familien werden dadurch insbesondere die Frauen benachteiligt, obwohl rechtliche Mutterschutzregelungen vorhanden sind.
Es geht also für die Familien um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auf diese sollte großer Wert gelegt werden. Denn Frauen, Männer und Kinder leiden darunter, wenn diese Vereinbarkeit nicht hinreichend gewährleistet ist. Die Beschäftigungs- und Erziehungssysteme müssen folglich beide so umgeformt werden, dass sie mit den Bedürfnissen der Familien verträglich gemacht und an diese angepasst werden. Die Lebensqualität für alle würde dadurch deutlich steigen.
Die jetzt teils fehlenden qualifizierten Frauen wären früher oder später vorhanden, wenn die Bedingungen dafür geschaffen würden. Und die Frauen wären dann auch wettbewerbsfähig, brauchten also auch weder eine Privilegierung noch eine Frauenbeauftragte oder eine Gleichstellungspolitik. Dies wären die Konsequenzen des „angebotsorientierten“ Modells der Frauenpolitik.
6. Hemmnisse und Blockaden
Warum wird dieses Konzept nicht systematisch ausgearbeitet? Darauf gibt es m. E. mehrere einander ergänzende Antworten:
a) weil die feministische Ideologie, ohne im politischen Diskurs jemals kritisch reflektiert worden zu sein, aus ziemlich oberflächlichen und opportunistischen Gründen mehr oder weniger in allen Parteien zur Grundlage der frauenpolitischen Parteiprogrammatik und des konkreten Handelns geworden ist, und
b) weil die tatsächliche Wirkungsweise der nachfrageorientierten Frauenpolitik bisher nicht richtig erkannt worden ist, sowie
c) weil z. B. eine verbesserte Kleinkinderbetreuung (verbesserte Kindergärten) und Ganztagesschulen erhebliche zusätzliche Staatsausgaben erfordern, die jedoch seit Beginn der um 1980 angebrochenen Ära des Neoliberalismus politisch kaum durchsetzbar sind, und
d) weil diejenigen, die aus der Praktizierung des ebenso wirkungslosen wie teuren nachfrage-orientierten Frauenpolitikmodells unmittelbar oder mittelbar Einkommen oder Macht beziehen, als letzte ein Interesse daran haben können, an dieser absurden Praxis irgend etwas zu ändern; im Gegenteil: das Phantom der Diskriminierung muss stets von neuem beschworen werden, denn sonst entfiele für sie der Grund ihres Daseins. Und genau diese Leute reagieren dann auch auf ansatzweise Kritik am nachfrageorientierten Politikkonzept höchst allergisch: kein Wunder, geht es hier doch um ihre ganz persönlichen Interessen!
7. Ergebnisse
(a) Die „nachfrageorientierte“ Frauenpolitik kann nur dann wirksam sein, wenn erstens auf dem Arbeitsmarkt eine Warteschlange hinreichend qualifizierter Bewerberinnen vorhanden ist und wenn zweitens organisationsintern tatsächlich ein „Diskriminierungsverhalten“ existiert. Sind diese empirischen Voraussetzungen nicht erfüllt, dann ist sie nicht nur unwirksam, sondern sogar schädlich.
(b) Jedes Berufungsverfahren ist ein empirischer Test dieser Voraussetzungen. Im Falle eines quantitativen Mangels an hinreichend qualifizierten Bewerberinnen und bei Existenz einer Frauenquotenpolitik an Hochschulen führt die „nachfrageorientierte“ Frauenpolitik insbesondere bei Professuren erstens zwingend zu einer schädlichen Verzögerung bei Stellenbesetzungen, zweitens zu einer Absenkung des Qualifikationsniveaus der berufenen Personen und drittens zu einer Diskriminierung qualifizierter – zur Berufung geeigneter, aber nicht berufenen – Männer.
Nur wenn Qualitätsverlust und Diskriminierung geeigneter Männer hingenommen werden, kann unter den Voraussetzungen dieses Absatzes die Frauenquote erhöht werden. Im Umkehrschluss (unter diesen empirischen Bedingungen) zeigt daher ihr faktischer Anstieg den Qualitätsverlust an.
Der nachfrageorientierte, auf den Annahmen des Absatzes (a) beruhende Politikansatz leistet frauenpolitisch wenig bis nichts, weil er auf einer ideologisch begründeten Fehldiagnose beruht. Während die feministische Ideologie die empirischen Bedingungen des Absatzes (a) unterstellt, wird die Realität, wie eine langjährige Erfahrung gezeigt hat, an den Hochschulen im wesentlichen durch Absatz (b) zutreffend beschrieben.
Die Politik aller Parteien scheint dieser Fehldiagnose aufgesessen zu sein, und daher ist eine grundsätzliche und weitreichende Korrektur auf der gesetzgeberischen Ebene erforderlich. Der Mangel ist jetzt erkannt, er verlangt nach Beseitigung, und diese bietet, wenn die ideologischen Fixierungen überwunden werden können, sogar positive politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Effekte. Denn die „nachfrageorientierte“ Frauenpolitik stiftet durch ihre weitgehende Unwirksamkeit, durch die sich daraus ergebende Fehlverwendung finanzieller Mittel und durch die frauenpolitisch verursachte Zeitverschwendung an den Hochschulen einen erheblichen, aber durch eine Umorientierung vermeidbaren Schaden für die Hochschulen, für die Hochschullehrer, für die Studierenden und für die Steuerzahler.
Die nachfrageorientierte Frauenpolitik (Gleichstellungspolitik) war, ist und bleibt ein Irrweg. Es muss stattdessen darum gehen, die heute noch problematische Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Männer, Frauen und Kinder im Sinne einer verbesserten Lebensqualität für alle durch eine an den Bedürfnissen der Familien orientierte Familien- und Bildungspolitik zu ermöglichen.
Dieser Beitrag ist eine geänderte Fassung des Textes: Buchholz, G. (2011), Personalpolitik an Hochschulen – eine Kritik der nachfrageorientierten Frauenpolitik, in: Eckhard Kuhla (Hrsg.), Schlagseite – MannFrau kontrovers, Klotz GmbH und Sich Verlag in der Sich Verlagsgruppe: Frankfurt/Main/Magdeburg
Literatur
- Dr. habil. Heike Diefenbach: Das Patriarchat – Bedeutung, empirischer Gehalt, politische Verwendung; Quelle: sciencefiles.org 2012; siehe http://sciencefiles.files.wordpress.com/2012/06/heike-diefenbach_2012_das-patricharchat_sciencefiles-org.pdf
- Klenner, Christina (2002): Geschlechtergleichheit in Deutschland? Aus Politik und Zeitgeschichte B33-34/2002
Bildnachweis: Femen
Prof. Dr. Güter Buchholz, Jahrgang 1946, hat in Bremen und Wuppertal Wirtschaftswissenschaften studiert, Promotion in Wuppertal 1983 zum Dr. rer. oec., Berufstätigkeit als Senior Consultant, Prof. für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Consulting an der FH Hannover, Fakultät IV: Wirtschaft und Informatik, Abteilung Betriebswirtschaft. Seit 2011 emeritiert.