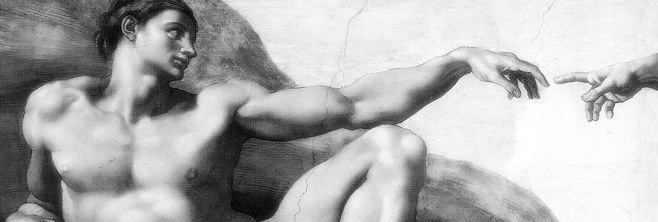Warum es eine starke Frauen- und eine schwache Männerbewegung gibt
7. Oktober 2012, von Arne Hoffmann
Eine Rezension zu Matthias Stiehlers Buch „Der Männerversteher: Die neuen Leiden des starken Geschlechts“
Derzeit scheint es pro Jahr mindestens ein Buch zu geben, das die männerpolitische Debatte entscheidend voranbringt. War es 2008 Professor Walter Hollsteins „Was vom Manne übrig blieb“ und 2009 die von Paul-Hermann Gruner und Eckhard Kuhla herausgegebene Anthologie „Befreiungsbewegung für Männer“
, überzeugt Dr. Matthias Stiehler mit „Der Männerversteher“
– erschienen 2010 im Beck-Verlag. Sein Buch liefert den Schlüssel dafür zu begreifen, warum die Geschlechterdebatte so geführt wird, wie es gegenwärtig der Fall ist.
Als Mitbegründer des bundesweiten Netzwerks Männergesundheit sowie Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit ist Stiehler ein ausgewiesener Experte und weiß, wovon er spricht. Viele seiner Erkenntnisse entspringen zahlreichen Gesprächen mit Männern in Beratungen, Gruppengesprächen und Workshops – ein solides Fundament, wenn es um den Einblick in Männerseelen geht.

In der Danksagung zu seinem Buch würdigt Stiehler vor allem den bekannten Psychologen Hans-Joachim Maaz, den er als „Freund und Lehrer“ bezeichnet. Tatsächlich ist der Aufbau von Stiehlers Buch Maazens Werken durchaus ähnlich und Maaz hat es auch mit einem Vorwort gewürdigt, in dem er seinen Inhalt vorausnimmt. Maaz zufolge stellt Stiehlers Buch „das Bemühen von Männern, sich endlich selbst gut zu verstehen, in den Mittelpunkt. (…) Bieten sich Männer hingegen als ‚Frauenversteher‘ an, handelt es sich meistens um ‚Mutterbediener‘, die immer noch um die nie erhaltene Zuwendung betteln.“ Damit ist bereits eine der Kernthesen dieses Buches deutlich geworden.
Eine weitere Kernthese lautet, dass es eine „patriarchale Dividende“, die Männerforscher wie Robert Connell zu sehen glaubten, in Wahrheit ebensowenig gibt wie eine vom Feminismus behauptete Unterdrückung der Frauen durch die Männer: „Die Männer sind in diesem Spiel ebenso Verlierer. Den Vorteilen, die sie haben und die von feministischer Seite immer wieder hervorgehoben werden, stehen ebensolche Nachteile entgegen.“ Mit dieser Erkenntnis schließt Stiehler an die politische Männerrechtsbewegung an, die sich in den letzten Jahren auch in Deutschland mit Gruppen wie MANNdat und AGENS gebildet hat und die diese Nachteile beseitigen möchte.
Als gravierendsten dieser Nachteile sieht Stiehler die mehrere Jahre kürzere Lebenserwartung von Männern:
„Dabei ist einer der Grundsätze der Medizinsoziologie, dass sich die gesellschaftliche Stellung einer Gruppe in ihrer Lebenserwartung zeigt: je kürzer diese ist, desto schlechter ist auch die gesellschaftliche Situation. Dieser Grundsatz ist wissenschaftlich unumstritten und wird für viele Bereiche der Gesellschaft angewandt – nicht jedoch in der Geschlechterforschung. Denn dies würde ja folgerichtig zu der Frage führen, in welcher gesellschaftlichen Situation Männer leben, wenn sie im Durchschnitt mehrere Jahre weniger leben als Frauen. Doch diese Frage und erst recht die Suche nach Antworten wird seit Jahren gemieden. Die Gesundheitssoziologin Ute Gerhard wies bereits vor mehr als zwanzig Jahren auf diesen Widerspruch hin. Aber es scheint so, als interessiere sich dafür höchstens eine kleine Gruppe von Männeraktivisten. Unvorstellbar hingegen, dass es ebenso ruhig bliebe, wenn eine Statistik herausfände, dass die Lebenserwartung von Frauen geringer als die der Männer wäre.“
Wäre letzeres der Fall, würde man
„diese Tatsache als Skandal betrachten und immer wieder den Finger in die Wunde legen. Undenkbar, dass eine solche Statistik nicht als Ausdruck gesellschaftlicher Zustände angesehen würde.“
Die kürzere Lebenserwartung ist indes nur eines von vielen Feldern, wo Männer gegenüber Frauen deutliche Nachteile erleiden, über die aber nicht gesprochen wird. Stiehler führt hierzu zutreffend aus:
„Im Hinblick auf die gesellschaftliche Benachteiligung von Männern gibt es eine breite Allianz des Schweigens, des Nicht-wahrhaben-Wollens und des Umdeutens. Zu dieser Allianz gehören nicht nur feministische Wissenschaftlerinnen, Gleichstellungsbeauftragte und Politikerinnen, die in unserem Land den Geschlechterdiskurs dominieren. Dazu zählen auch zahlreiche männliche Wissenschaftler und Politiker. Unter diesen Männern sind zwei Formen des Umgangs mit dem Problem verbreitet. Entweder es wird grundsätzlich geleugnet, dass auch Männer Benachteiligungsstrukturen ausgesetzt sind. Von diesen sogenannten kritischen Männerforschern wird noch zu sprechen sein. Oder man ist, wenn schon Probleme von Männern angesprochen werden, sehr darauf bedacht, bloß nicht den Unmut von Frauen zu erregen.“
Nachdem ich die Geschlechterdebatte seit über zehn Jahren intensiv begleite, kann ich (und mit mir viele andere) bestätigen, dass sich genau diese beiden Mechanismen immer wieder abspielen.
Wie das konkret geschieht, verdeutlicht Stiehler anhand der Wortmeldung eines Zuhörer bei einem seiner Vorträge: „Wenn Frauen gesundheitliche Schwierigkeiten haben, liegen die Ursachen in den gesellschaftlichen Zuständen, die Männer sind jedoch selbst daran schuld.“ Auf Nachfragen versicherte der Zuhörer, diesen Satz keineswegs ironisch gemeint zu haben, sondern in vollem Ernst. Diese verquere Sichtweise prägt die Geschlechterpolitik. Während beispielsweise seit Jahren ein Frauengesundheitsbericht vorliegt, wird ein Männergesundheitsbericht mit den durchschaubarsten Ausflüchten abgelehnt. Hier liegt für Stiehler „der Verdacht auf der Hand, dass man eine Benachteiligungsdebatte, in die auch Männer einbezogen sind, auf jeden Fall vermeiden möchte.“ Die konsequente Zurückweisung sämtlicher Gespräche mit Männerrechtlern durch die etablierte Genderszene, die mit den irrwitzigsten Scheinbegründungen erfolgt, weist ebenfalls auf den von Stiehler aufgezeigten Sachverhalt hin. Die Benachteiligung von Männern ist für jeden so sichtbar wie ein Elefant im Wohnzimmer, aber darüber zu sprechen ist in der etablierten Genderszene das oberste Tabu.
Auch Matthias Stiehler berichtet von entsprechenden Reaktionen. Sobald er in Debatten die gesundheitliche Situation von Männern thematisieren möchte, stößt er auf hämische Erwiderungen wie „Ach die Ärmsten.“ Wird er vom Bürgermeister einer Stadt eingeladen, einen entsprechenden Vortrag zu halten, teilt die dortige Gleichstellungsbeauftragte prompt mit, dass „sie sich so etwas gar nicht erst anhöre und der Veranstaltung daher fernbleibe“. Viele andere, die sich für Männer einsetzen, haben dasselbe erlebt. Offenbar ist es für die Genderkader von immenser Bedeutung, dass ihre Vorurteile auf keinen Fall mit Fakten oder auch nur gegenläufigen Ansichten konfrontiert werden.
Neben dieses zentrale Tabu in der Geschlechterdebatte, so Stiehler, tritt zugleich eine ebenso zentrale Lüge: nämlich die, dass Männer sich endlich grundlegend ändern sollen. Tatsächlich sollen sie sich nur in den engen Grenzen ändern, die der feministische Mainstream ihnen vorschreibt:
„Sie sollen nicht auf ihre Bedürfnisse achten, denn das täten sie in ihrem männlichen Egoismus ohnehin zu viel. Vielmehr sollen sie noch größere Kraftanstrengungen unternehmen, die an sie gestellten Erwartungen besser zu erfüllen.“
Die alte Männerrolle des Funktionierens wird also fortgeschrieben, nur eben jetzt nicht mehr mit dem General oder dem Chef, sondern mit den Feministinnen als Kommandogeber. Stiehler führt aus:
„Die vielen Forderungen an die neuen Männer sind bei Licht betrachtet eine Fortschreibung der alten Verhältnisse, mit ein wenig neuer Tünche: Männer, tut, was wir von euch verlangen, und achtet auch weiterhin bloß nicht darauf, was ihr wollt und was für euer Leben gut ist. Es geht im derzeitigen gesellschaftlichen Mainstream überhaupt nicht darum, dass Männern lernen, mehr auf sich zu achten. (…) Im Kern geht es also darum, dass sich Männer NICHT ändern.“
Man könnte hinzufügen: Die einzigen Männer, die sich tatsächlich geändert haben und ihre eigenen Bedürfnisse formulieren, etwa die Aktivisten von MANNdat und AGENS, werden vom feministischen Mainstream erbittert und bis aufs Messer bekämpft.
Stiehler erkennt glasklar, aus welchem Grund den meisten Feministinnen an einer echten Veränderung des Geschlechterverhältnisses inzwischen wenig gelegen sein kann:
„Es geht um Geld und es geht um die Pfründe, die über die Jahre geschaffen und besetzt wurden. Eine Entideologisierung der Geschlechterdiskussion hätte zur Folge, dass all dies infrage gestellt wird. Unter diesem Aspekt lässt sich auch verstehen, warum sich so viele Gleichstellungsbeauftragte gegen wirkliche Gleichstellung wehren und warum eine Zeitschrift wie die EMMA nicht ideologiefrei sein kann. Hier sind jeweils konkrete Berufskarrieren in Gefahr.“
Auch auf einer anderen Ebene findet Stiehler Idelogisierungen schädlich, nämlich wenn es darum geht, wie eigentlich Geschlechter entstehen. Was macht einen Mann zum Mann und eine Frau zur Frau? Stiehler weist hier sowohl die Sicht zurück, dass diese Geschlechtsidentität biologisch zwingend festgelegt sei – das lasse dem Einzelnen zuwenig Entscheidungsfreiheit, was sein Verhalten angeht -, als auch die in der Genderszene weit beliebtere Annahme, Geschlecht werde lediglich gesellschaftlich konstruiert. Stiehler kommt hier auf den vom SPIEGEL aufgedeckten Skandal um den Verein „Dissens“ zu sprechen. Dessen Pädagogen bekamen es in dem geschilderten Fall mit einem Schützling zu tun, der selbstbewusst andere Auffassungen vom Jungen- bzw. Mannsein vertrat als seine feministisch ausgerichteten „Dissens“-Betreuer. Diese versuchten daraufhin, seine Geschlechtsidentität dadurch zu verunsichern, dass sie ihm mitteilten, „dass er eine Scheide habe und nur so tue, als sei er ein Junge.“ Wie zerstörerisch solche Praktiken für Jungenseelen sein können, legte daraufhin vor allem Professor Gerhard Amendt in einer ausführlichen Stellungnahme dar. „Dissens“ verwahrte sich gegen die durch den SPIEGEL-Artikel ausgelösten Proteste mit einer Erwiderung, die, wie Stiehler erklärt, den Vorwurf des ideologischen Missbrauchs nur bestätigte: „Das Beispiel zeigt, dass es eben nicht um den konkreten Jungen geht, der durch die ‚irritierende Intervention‘ in seinen unmittelbaren Empfindungen verwirrt wird. Es geht vielmehr um eine Ideologie.“
Bis hierhin liegt Stiehler mit vielen Männerrechtlern (so auch mit meinen eigenen Veröffentlichungen) auf einer Linie. Das eigentliche Verdienst seines Buches beginnt, wenn er analysiert, warum sich zahllose Männer nicht längst gegen all diese Zumutungen wehren. Dazu wirft er zunächst einen Blick auf eine Standardbotschaft etlicher Kinofilme:
„Um als Mann für gut befunden zu werden, muss man schon ein liebenswerter Trottel sein, der dann auch noch durch eine Frau erlöst wird.“ Diese Aussage ist offenbar deshalb so immens beliebt, weil sie auch an den Bedürfnissen sehr vieler Männer andockt – dem Bedürfnis, es Frauen recht zu machen und sie zufriedenzustellen. Männer, die irgendwann die Vergeblichkeit eines solchen Unterfangens erkennen, landen häufig in einer von vielen Männergruppen. „Mit diesem Schritt“, so Stiehler, „sind sie letztlich weiter als die sogenannten kritischen Männerforscher, die genau das, wissenschaftlich verbrämt, immer noch versuchen“ und die hier explizit (!) eine Forschung verbieten, die sich autonom der Situation von Männern zuwendet. „Als ehemaliger DDR-Bürger“, merkt Stiehler an, „werde ich natürlich hellwach, wenn innerhalb einer Wissenschaft Prinzipien aufgestellt werden, die festlegen, was bei der Wahrheitssuche nicht getan werden darf“.
Der Versuch, auf (hier: feministische) Kritik so zu reagieren, dass man es dem Kritiker auf jeden Fall Recht machen will, führt Stiehler zufolge zu heilloser Überforderung:
„Das müssen auch die kritischen Männerforscher irgendwie ahnen, wenn sie selbst zugeben – wie ich es in mehreren Vorträgen erlebte -, dass ihre eigene Praxis hinter den selbst gesteckten Zielen zurückbleibt. Doch ihr Trick besteht darin, dass sie sich den Frauen andienen, indem sie die Solidarität mit ihren Geschelchtsgenossen aufkünden, um so vor den Frauen als besserer Mann dazustehen.“
(Ein Schuft, wer hier „Thomas Gesterkamp!“ ruft.)
Die eigenen Bedürfnisse auszublenden, wenn nicht zu verleugnen, ist indes nicht nur auf die „kritischen Männerforscher“ beschränkt. „Offenbar haben es sehr viele Männer gelernt“, postuliert Stiehler, „die eigene Unzufriedenheit hinzunehmen und sich am besten erst gar nicht richtig bewusst zu machen.“ Dass sie in Wahrheit hoch unzufrieden sind, lassen diese Männer nur durchblicken, indem sie griesgrämig oder knurrig werden oder vor anderen Menschen bösartige Bemerkung zu ihrer Frau machen. Offen zur Sprache bringen sie ihre Unzufriedenheit aber häufig nicht.
Unweigerlich muss man hier daran denken, dass die Paartherapeutin Ulla Rhan in ihrem Buch „Fuck & Go“ eine sehr ähnliche Beobachtung äußerte: Während es für Männer mit dem gesellschaftlichen Tod bedroht sei, „in ähnlicher Weise gegen Frauen zu wettern, wie es nicht nur radikale Feministinnen seit Jahrzehnten lustvoll tun“, beseitige das Sprechverbot nicht die zugrunde liegende Unzufriedenheit. Rhan berichtet:
„Während kaum einer meiner weiblichen Gesprächspartner ein gutes Haar an den ‚Herren der Schöpfung‘ ließ und fast alle die Gründe für ihr Alleinsein in männlichen Unzulänglichkeiten sahen, schlugen die Männer ganz andere, sehr viel leisere Töne an. Die meisten wiesen mich schon bei der Terminvereinbarung darauf hin, dass sie aber auf keinen Fall als Frauenhasser gesehen werden wollten. ‚Ich bin pro Frau‘, beteuerten gleich mehrere noch am Telefon. Kamen sie aber erst einmal ins Erzählen, wurde bei allem Wohlwollen dennoch deutliche Kritik, manchmal sogar ungeheure Wut laut. Männern, denen von Frauen nur allzu oft mangelnde emotionale Ausdrucksfähigkeit vorgeworfen wird, echauffierten sich über die Ungerechtigkeit der gängigen Rollenbilder und die weibliche Kontrollsucht. Sie stöhnten über finanzielle Ausbeutung und klagten über Verunsicherung, Ängste und zunehmende Unlust.“
Anders als bei den Frauen mündet dieses verbreitete Missbehagen aber nur marginal in eine politische Bewegung. Woran liegt das? Warum ist es für Männer in der Regel wichtiger, Zustimmung von Frauen zu erhalten als ihre eigene Unzufriedenheit zu äußern?
Stiehler führt dies (ähnlich übrigens wie der Jungenpädagoge Wolfgang Wenger in meinem Buch „Männerbeben“) auf eine männliche Grundhaltung zurück, der zufolge Männer
„das tun wollen, was von ihnen erwartet wird. Sie verwenden viel Energie darauf zu erahnen, was sie tun SOLLEN. Von wem sie dieses ‚Sollen‘ empfangen, ist unterschiedlich. Das können Mütter, Väter, Partner oder Partnerinnen sein, aber auch Gruppen von Gleichaltrigen oder vermeintliche öffentliche Erwartungen. Die meisten Männer wissen jedoch kaum, was sie selbst, also aus sich heraus, tun WOLLEN. So treten sie dann auch in der Öffentlichkeit nur selten für sich ein. Dass es keine wirkliche Männerbewegung gibt, ist ein deutliches Zeichen dafür.“
 Von dem Bedürfnis, Forderungen zu erfüllen, die von weiblicher Seite an sie herangetragen werden, sind vor allem jene Männer betroffen, die Frühstörungen durch ihre Mutter ausgesetzt waren. Stiehler knüpft hier an die von seinem Lehrer Hans-Joachim Maaz aufgezeigten „Mütterlichkeitsstörungen“ an und verdeutlicht, „dass die Konsequenzen des derzeit dominierenden gesellschaftlichen Männerbildes dem entsprechen, was die Mütterlichkeitsstörungen bewirken“. Verinnerlicht werden Botschaften wie „Du hast keine Berechtigung!“, „Erwarte nicht zu viel, halte dich zurück!“ und „Tu, was von dir verlangt wird!“ Dieser Befund, darin ist Stiehl Recht zu geben, sei um so interessanter, als wir wie selbstverständlich nicht von einer matriarchalischen, sondern von einer patriarchalischen Gesellschaft ausgehen, in der Männer den Ton angeben. Gleichzeitig werde durchgehend so getan, „als seien die Mütter vor allem gut und als läge das Problem vor allem bei den Vätern.“ Diese Leugnung der Mütterlichkeitsstörungen durch die Erwachsenen und ihr Niederschlag in der Gesellschaft wird von Hans-Joachim Maaz als „Lilith-Komplex“ bezeichnet. Dieser Komplex vergifte Stiehler zufolge das Geschlechterverhältnis: „Denn wenn die Mutter und mit ihr alle Frauen als undifferenziert gut und schutzwürdig angesehen werden, kann sich kein Miteinander entwickeln.“
Von dem Bedürfnis, Forderungen zu erfüllen, die von weiblicher Seite an sie herangetragen werden, sind vor allem jene Männer betroffen, die Frühstörungen durch ihre Mutter ausgesetzt waren. Stiehler knüpft hier an die von seinem Lehrer Hans-Joachim Maaz aufgezeigten „Mütterlichkeitsstörungen“ an und verdeutlicht, „dass die Konsequenzen des derzeit dominierenden gesellschaftlichen Männerbildes dem entsprechen, was die Mütterlichkeitsstörungen bewirken“. Verinnerlicht werden Botschaften wie „Du hast keine Berechtigung!“, „Erwarte nicht zu viel, halte dich zurück!“ und „Tu, was von dir verlangt wird!“ Dieser Befund, darin ist Stiehl Recht zu geben, sei um so interessanter, als wir wie selbstverständlich nicht von einer matriarchalischen, sondern von einer patriarchalischen Gesellschaft ausgehen, in der Männer den Ton angeben. Gleichzeitig werde durchgehend so getan, „als seien die Mütter vor allem gut und als läge das Problem vor allem bei den Vätern.“ Diese Leugnung der Mütterlichkeitsstörungen durch die Erwachsenen und ihr Niederschlag in der Gesellschaft wird von Hans-Joachim Maaz als „Lilith-Komplex“ bezeichnet. Dieser Komplex vergifte Stiehler zufolge das Geschlechterverhältnis: „Denn wenn die Mutter und mit ihr alle Frauen als undifferenziert gut und schutzwürdig angesehen werden, kann sich kein Miteinander entwickeln.“
Stiehler zufolge sei es dem Feminismus zwar grundsätzlich zu verdanken, dass er die Spannungen aus der Verborgenheit der kleinbürgerlichen Familie an die Öffentlichkeit geholt hat und dabei auch die gesamtgesellschaftliche Relevanz der Zerwürfnisse zwischen den Geschlechtern deutlich machte. Das Problem liege jedoch in der Einseitigkeit der feministischen Sichtweise. Gerade diese Einseitigkeit zeige, „dass davon der gesellschaftliche Mainstream geprägt wird. Im gesellschaftlichen ‚Ausschlachten‘ realer wie vermeintlicher Benachteiligungen von Frauen sowie im Schweigen der Männer offenbart sich der verbreitete Mechanismus familiärer Konstellationen.“
Verstärkt werde dieser Mechanismus durch faktisch oder auch nur emotional abwesende Väter. Wenn ein Vater seinen Sohn allein dem mütterlichen Einfluss überlasse, führe die dadurch entstehende Abhängigkeit dazu,
„dass Jungen andere Jungen als Konkurrenten empfinden, untereinander keine Schwäche zeigen wollen und nicht die Erfahrung machen, wie wichtig männliche Solidarität sein kann. Gerade die fehlende Bereitschaft zur Solidarität ist ein wunder Punkt unserer Geschlechterdebatte. Dies zeigt sich etwa daran, wie schnell selbst Männerforscher bereit sind, ihre Geschlechtergenossen zu diskreditieren und sich auf Seiten des Feminismus zu schlagen.“
Hier sticht Stiehler nun endgültig in ein Wespennest, wenn man sich die aktuellen Entwicklungen in Deutschland anschaut. So wurde unter dem Schirm des Familienministeriums ein profeministisches „Bundesforum Männer“ begründet, dessen erste und bisher einzige Amtshandlung darin bestand, sich von denjenigen Männeraktivisten zu distanzieren, die selbstbewusst eigene Wahrnehmungen und Forderungen jenseits feministischer Vorgaben formulierten. Etwa zeitgleich legte der profeministische Männerforscher Thomas Gesterkamp ein Pamphlet für die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung vor, in dem er zu einer ebensolchen Distanzierung von diesen Aktivisten aufrief. Diese Schrift wurde von Experten wie Professor Walter Hollstein zwar geradezu zerfetzt, was ihre wissenschaftlichen Ansprüche anging; gleichzeitig erregte Gesterkamp damit aber weit mehr Aufmerksamkeit als mit jedem anderen seiner Texte. Wenig später durfte er in der profeministischen Männerzeitschrift „Switchboard“ mit der Polemik nachlegen, dass man um die nicht-feministischen Männerrechtler einen „cordon sanitaire“ wie um Rechtsextreme ziehen solle, also ein Sprech- und Berührungsverbot. Ein ebenfalls in diesem Jahr vorgestelltes „Manifest der grünen Männer“ warb wortreich darum, dass Männer feministische Anforderungen noch viel stärker erfüllen sollten, und ein Blog der den Grünen nahestehenden Heinrich-Böll-Stiftung ließ seine Autorinnen und Autoren in ständig neuen Beiträgen gebetsmühlenhaft wiederholen, dass eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Männern, die eigene Nöte und Bedürfnisse formulieren, in keiner Weise zur Diskussion stehen dürfe. Kurz: Die gesamte politisch etablierte Männerszene starrt derzeit unisono auf den Elefanten mitten im Wohnzimmer, und jeder drängt den anderen, dieses Wesen doch bitte unbedingt zu ignorieren. „Du sollst nicht merken“ ist die implizite Botschaft solcher Kommentare, wie man in Anlehnung an Alice Miller formulieren könnte. Man will sich gar nicht näher ausmalen, von welchem Ausmaß an „Mütterlichkeitsstörungen“ viele der männlichen Genderkader, die sich entsprechend äußern, geprägt sein mögen.
Matthias Stiehler jedenfalls sieht die etwa im Anti-Macho-Manifest der Grünen so massiv geforderten „Neuen Männer“ durchaus skeptisch. Auch die aktuell sehr verbreitete Meinung, Männer sollten sich nun endlich mehr der Familie zuwenden und „weicher“ werden,
„hat erst einmal kein Interesse daran, was Männer selbst wollen. Vor dieser Frage steht bereits fest, wie sie sein sollten – und das orientiert sich keinesfalls an deren Bedürfnissen. (…) In jedem Fall geht es darum, dass Männer funktionieren. Diese Diskussion hat sich mittlerweile so verselbständigt, dass selbst die Männerforschung zu weiten Teilen davon bestimmt ist und es den Männern am Ende nicht einmal mehr selbst auffällt. (…) Auch die heutzutage so sehr geforderten ’neuen Männer‘ sollen vor allem das tun, was andere, die Partnerin oder auch der feministische Mainstream fordern.“
In der Tat: Zwar erhielt das „Manifest der grünen Männer“ in der darunter vorgesehenen Kommentarspalte von etlichen männlichen Lesern massiven Gegenwind – aber Sprecher dieser grünen Männer erklärten daraufhin immer wieder, diese Proteste weiterhin so ignorieren zu wollen wie all die Jahre zuvor.
Professor Gerhard Amendt, Leiter des Instituts für Geschlechter- und Generationenforschung der Universität Bremen, hatte zu dieser Schrift der grünen Männer befunden:
„Das Manifest will neue Perspektiven im Arrangement der Geschlechter eröffnen – aber die Autoren scheinen sich eher abgewertet und hilflos vorzukommen. Denn sie wagen nicht ‚Ich‘ zu sagen; noch weniger ‚wir Männer‘, sondern nur: was will die Frau, und: ist ihr Recht von dem, was ich will? Wenn sie sich Machos (…) nennen – ganz wie ein missbrauchtes Kind, das sich mit seinem Angreifer identifiziert -, dann haben sie sich nicht nur selber aufgegeben.“
Amendts Analyse ist mit der von Matthias Stiehler praktisch deckungsgleich. Und Amendt dürfte auch der folgenden Einsicht Stiehlers weitgehend zustimmen:
„Gleichberechtigung beinhaltet, dass nicht derjenige ein guter Mann ist, der selbstvergessen den Forderungen der Frauen nachkommt, wie es die kritische Männerforschung fordert. Es geht vielmehr um einen gemeinsam gestalteten Aushandlungsprozess in privaten Beziehungen wie in der Gesellschaft. (…) Und zumindest auf gesellschaftlicher Ebene hat der Aushandlungsprozess zwischen den Geschlechtern noch gar nicht wirklich begonnen.“
Stiehler sieht eindeutige Parallelen zwischen der gesellschaftlichen Geschlechterdynamik und der Geschlechterdynamik in Paarbeziehungen:
„Solange behauptet wird, die eine Seite wäre für die Probleme verantwortlich, sie müsse sich erst einmal ändern, so lange kann es zu keinem echten Miteinander kommen. In unserer gesellschaftlichen Situation wird jedoch genau das getan. Vor allem die Männer sollen sich endlich ändern, damit es besser wird. Nach dieser Meinung kann sich das Geschlechterverhältnis erst dann bessern, wenn Männer mehr von ihrer Macht abgeben und sich stärker als bisher dem Haushalt und den Kindern zuwenden.“
Entsprechende Forderungen rangieren heute vom konservativen Lager (Ursula von der Leyen) bis zu den Grünen und noch weiter ins linke Spektrum hinaus. Mit einer Gegenaggression kann sich Stiehler aber genauso wenig anfreunden:
„Auch das führt letztlich zu keinem Dialog, sondern wieder nur zu Schuldzuweisungen, jetzt jedoch in Richtung der Frauen. In dieser Logik stehen Frauen und Männer einander gegenüber, werfen sich gegenseitig Vorwürfe an den Kopf und verlangen, dass sich erst mal die andere Seite ändern besser solle, ehe es besser werden kann.“
Zum Schluss seines Buches zieht Matthias Stiehler folgendes wegweisendes Fazit:
„Eines der wesentlichsten Merkmale der derzeitigen Geschlechterdebatte ist die defensive Grundhaltung, mit der Männer auftreten. Einmal abgesehen davon, dass vergleichsweise wenige Männer einen Kampf gegen vermeintliche oder auch reale Benachteiligungen führen, zeichnen sich Männer vor allem dadurch aus, dass sie in öffentlichen Diskussionen sehr schnell bereit sind, den entschieden argumentierenden Frauen Recht zu geben. Als zentrales Ergebnis einer weite Teile der Gesellschaft umfassenden Männlichkeitsdebatte sollte daher eine offensivere männlichere Haltung stehen. Selbstbewusst die eigene Position zu vertreten, ohne sich auf Streitereien einzulassen, ist sicher ein schwierig zu erreichendes Ziel. Aber ohne eine selbstbewusste Männlichkeit kommen wir im gesellschaftlichen Geschlechterdialog nicht weiter.“