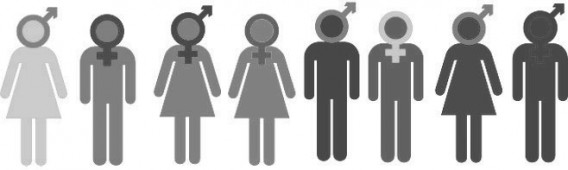Brauchen Schulen Dildos? (und andere Kernfragen einer „Sexualpädagogik der Vielfalt“)
„Das erste Mal ein Kondom überziehen, das erste Mal einen Tampon einführen, das erste Mal Analverkehr.“
Darüber sollten, so wunderte sich Christian Weber im April in der Süddeutschen Zeitung, schon Dreizehnjährige in der Schule „als Gedicht, als Bild, als Skulptur, als Theaterstück, als Sketch“ etwas vorstellen.
Jedenfalls, wenn es nach dem Standardwerk zu einer Sozialpädagogik der Vielfalt (dort auf S. 151 ff) ginge, das gemeinsam mit anderen die Soziologin Elisabeth Tuider verfasst hat, die an der Universität Kassel das Fachgebiet „Soziologie der Diversität“ leitet.
Die gerade veröffentlichte und global formulierte Solidaritätsadresse der Deutschen Gesellschaft für Soziologie „zu aktuellen Kampagnen der Diskreditierung und Diffamierung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern“ bezog sich wohl auch auf die heftige Kritik an Tuiders Position.
Weber überlegt:
„Pflichtgemäß hat man mit dem Kopf genickt, als die Leitartikler die Proteste [gegen den Baden-Württembergischen Bildungsplan, LS] gegeißelt haben. Wenn man aber nachliest, was unter einer ‚Sozialpädagogik der Vielfalt‘ möglicherweise konkret zu verstehen ist, wird einem doch komisch zumute.“
Darunter ist beispielweise ein Fragebogen zu verstehen, der auf einem ironischen „Heterosexual Questionnaire“ aus dem Jahr 1972 basiert und den die Ländle-GEW in ihre Broschüre Lesbische und schwule Lebensweisen. Ein Thema für die Schule aufgenommen hat (dort auf S. 21).
„Ist es möglich, dass deine Heterosexualität von einer neurotischen Angst vor Menschen des gleichen Geschlechtes kommt?“
Oder:
„Laut Statistik kommen Geschlechtskrankheiten bei Lesben am wenigsten vor. Ist es daher für Frauen wirklich sinnvoll, eine heterosexuelle Lebensweise zu führen und so das Risiko von Geschlechtskrankheiten und Schwangerschaft einzugehen?“
Über diesen Fragebogen hatte auch schon im April Matthias Mattussek geschäumt und Homosexualität bei dieser Gelegenheit gleich insgesamt als „Fehler der Natur“ hingestellt. Stefan Niggemeier wiederum hatte Matussek lächerlich gemacht: Er zeigte, dass Matussek die Ironie der Fragen, deren Umkehrung gängiger Klischees über Homosexuelle gar nicht verstanden habe und also mit einem Fragebogen für Siebtklässler überfordert gewesen sei.
Die heftige Kontroverse, die von den Kommentatoren unter den Texten beider noch heftiger fortgesetzt wurde, ist ein gutes Beispiel für die Gefechtslage, die sich angesichts einer „Sexualpädagogik der Vielfalt“ entwickelt hat. Regelmäßig stehen sich zwei Positionen gegenüber, die eigentlich beide nicht vertretbar sind und von denen aus gerade diejenigen nicht wahrgenommen werden, um die es angeblich geht: die Kinder und Jugendlichen.
Kinder verwirren, Erwachsene bestätigen
Matussek liegt tatsächlich falsch in seinem Verständnis der Fragen, die er als Skandal wahrnimmt. Niggemeier aber übersieht, dass Matusseks Interpretation für den Schulunterricht völlig stimmig ist – denn es ist ja durchaus zu erwarten, dass die meisten Schüler sich nicht unbedingt intensiv mit den Diskursstrategien Erwachsener beim Umgang mit der Homosexualität auseinandergesetzt haben. Die Ironie der Fragen ist für die erkennbar, die sich ohnehin schon auskennen – alle anderen werden sie in eben dem Sinn verstehen, wie Matussek sie verstanden hat.
„Warum verurteilt Weber den sexualpädagogischen Unfug, in dem Aufklärung in Intim-Terror umschlägt, nicht noch schärfer?“
fragt das Deutschlandradio anlässlich von Webers Auseinandersetzung mit Tuiders Sexualpädagogik der Vielfalt. Das Buch ist sehr gut geeignet, um die unergiebige, aber erregte Diskussion zu verstehen, die sich nicht nur zwischen Matussek und Niggemeier zu Fragen des Umgangs mit Sexualität in der Schule entwickelt hat – daher lohnt sich ein Blick hinein.
Mein erster Eindruck: Wer sich, wie Christian Weber, angesichts dieses Buches allein auf Analverkehr konzentriert – oder auf die schräge Aufgabe, dass Schüler einen virtuellen Puff einrichten sollen (75) – oder auf die Aufgabe, in der sie Gegenstände wie Dildos oder Lack- und Lederkleidung für verschiedene Parteien eines Mietshauses ersteigern müssen (51) –, der hat auch gezielt nach Skandalösem gesucht.
Der größte Teil der Aufgaben ist nicht so extrem, und wenn „Vielfalt“ thematisiert wird, ist das Buch deutlich weniger auf Sexualität konzentriert als etwa der so kontroverse Baden-Württembergische Bildungsplan. Es bezieht viele Aspekte ein: soziale Positionen, Herkunft, persönliche Eigenschaften wie Schüchternheit, Berufswünsche und anderes: „Der intersektionelle Junge“ heißt beispielweise eine Aufgabe, die eben solche verschiedenen Aspekte auflistet. (108)
Das Gesamtbild ist keineswegs so irre, wie Weber es zeichnet – und dass in einer Methodensammlung einige sinnvolle Methoden neben vielen fragwürdigen und einigen indiskutablen stehen, ist nach meiner Erfahrung durchaus üblich. Eher verdeckt die Suche nach möglichst sensationellen Fehlschlägen des Buches seine tatsächlichen Probleme:
„Für die Lesenden ist nicht nachvollziehbar, inwieweit die Ausführungen des Autorenteams faktenbasiert sind oder sich auf Annahmen beziehen. So heisst es beispielsweise auf S. 40 unkommentiert, dass die Auseinandersetzung mit Vielfalt in der Sexualpädagogik mit Sicherheit die eigene Weltsicht bereichert, obwohl gerade dieser Punkt regelmässig zu Diskussionen in der Gestaltung sexualpädagogischer Angebote führt.“
So der Pädagogikprofessor Daniel Kunz in einer Rezension. Das ist durchaus beachtlich: Während Tuider und ihre Mitschreiber durchgängig das Ziel formulieren, hergebrachte Vorstellungen zu reflektieren, zu ihrer „VerUneindeutigung“ und „Verwirrung“ (40) beizutragen, reflektieren und belegen sie ihre eigenen Grundannahmen nirgendwo.
Nach Tuider
„kann es nun auch in sexualpädagogischen Methoden nicht mehr darum gehen, die Polarisierungen von Norm/Abnorm, von positiv/negativ zu zementieren, sondern stattdessen wird gerade diese Einteilung und Grenzziehung thematisiert.“ (16)
Zwei Seiten später schreibt sie dann, wie selbstverständlich: Die
„Zuordnung zu einem der beiden Pole einer Kategorie (zum Beispiel bei der Kategorie Geschlecht die Rolle ‚Frau‘ oder ‚Mann‘) geht immer auch mit einer hierarchischen Anordnung der beiden Pole (Stichwort: Patriarchat) und damit mit einer Privilegierung des dominant gesetzten Teils einher.“ (18)
Das stimmt so allgemein natürlich nicht – Pole sind etwas anderes als Kategorien, und Polarisierungen sind nicht notwendig hierarchisch geordnet.
Vor allem aber: Die feministische Normalvorstellung, wir würden in einem Patriarchat leben, wird von Tuider blind wiederholt, zum Bestandteil von Aufgaben gemacht (z.B. in der „Blume der Macht“, S. 54) und genretypisch durchdekliniert. Sie geht von der „Norm“ (natürlich in Anführungszeichen) „heterosexuell, deutsch, weiß, christlich“ (39) aus und betont, fast im gleichen Atemzug, dass
„gesellschaftliche Positionen wie Frau, Schwuler, Migrantin oft als Grundlage für Abwertung und Diskriminierung“ (38)
dienten – als ob Frauen der skizzierten Norm nicht ebenso selbstverständlich angehören würden wie Männer.
Kinder brauchen Märchen Dildos
Woher aber diese Blindheit für die eigenen Normen rührt, lässt sich mit einem Zitat aus einem Aufsatz erklären, den auch Weber zitiert: Der Kieler Pädagogik-Professor Uwe Sielert schreibt schon 2001 in seinem Text Gender Mainstreaming im Kontext einer Sexualpädagogik der Vielfalt:
„Sich auf einige kulturell festgelegte Markierungen (wie Geschlecht, sexuelle Orientierung, Kernfamilie, biologische Elternschaft) sicherheitsheischend zu verlassen bedeutet, der Selbst-Entfaltung, dem aufregenden und zugleich befriedigenden Selbst-Entwurf aus dem Weg zu gehen.“ (S. 22)
Damit aber niemand auf die Idee kommt, jetzt dürfe also jeder so sein, wie er wolle, fügt Sieler gleich hinzu:
„Das Dominanzmuster des klassisch Männlichen gibt inzwischen am Wenigsten her.“
Das wäre ja auch noch schöner, wenn jemand sich selbst-entfaltend und selbst-entwerfend ausgerechnet zu einem klassischen Mann entwickeln würde.
In der Konsequenz ist für Sieler wie für Tuider nicht allein die – angebliche – Abwertung von Frauen ein Problem, sondern die Tatsache, dass sich Menschen überhaupt in Normalvorstellungen wie „Mann“ und „Frau“ einpassen. Weder Sieler noch Tuider kommt jedoch jemals auf die Idee zu fragen, ob Normen nicht einen positiven Sinn haben und eine Funktion erfüllen könnten – Normen werden von ihnen jeweils blind als Reproduktionen von Herrschaftsverhältnissen hingestellt.
Eben das aber ist gerade für Kinder und Jugendliche natürlich ganz anders. Wer sich einigermaßen verlässlich im Rahmen einer Gruppe orientieren und dort handeln will, muss ein Bild davon bekommen, was er gemeinhin von anderen erwarten kann – welche Erwartungen andere an ihn haben, welche Erwartungen er also seinerseits erwarten kann – was geschieht, wenn diese Erwartungen enttäuscht werden, welche Spielräume es für Regelübertretungen gibt.
Das hat einerseits schlichte ökonomische und praktische Gründe – ohne solche Normalerwartungen wäre keine soziale Situation berechenbar.
Es ist aber außerdem wichtig, um einzelne zu schützen: Wenn es Normen gibt, an die sich alle halten müssen, dann werden damit auch diejenigen eingebunden, die in der stärksten Position sind – und auch diejenigen, die in der schwächsten Position agieren, gewinnen ein Mindestmaß an Übersicht und Handlungsfähigkeit. Es ist blind, Normen gewohnheitsmäßig als Ausdruck von Herrschaft zu interpretieren, ohne die Selbstverständlichkeit zur Kenntnis zu nehmen, dass Normen Schwächere vor dem Recht des jeweils Stärkeren schützen.
Diese Blindheit kann sich nur jemand leisten, der sich an die eigenen Privilegien so gewöhnt hat, dass sie ihm schon lange nicht mehr auffallen.
Normalerwartungen sind zudem wichtig für die Frage eines Einzelnen nach der eigenen Identität – für die Frage zum Beispiel, wie er sich selbst zu den Erwartungen verhält, denen er begegnet. Wenn er diese Erwartungen – was wiederum normal ist – nicht vollständig bedienen kann oder will, nimmt er sie ja erst recht zum Anlass, über die eigene Position und über soziale Normen zu reflektieren.
Statt aber diese Funktionen anzuerkennen und, durchaus im Sinn einer klassischen Liberalität, human mit Normverstößen umzugehen, werden Sieler und Tuider nicht nur einzelne Normen zum Problem – sondern die Tatsache, dass es überhaupt Normen gibt.
So erklärt sich denn eben auch die Konzentration auf Ungewöhnliches in dieser Sexualpädagogik: Ziel ist nicht einfach nur, beispielsweise, ein offener, ziviler Umgang Heterosexueller mit Schwulen und Lesben, sondern der Angriff auf das Konzept der Normalität generell. Es reicht dann eben nicht, lesbischen und schwulen Liebespaaren in vorgeschlagenen Rollenspielen eine ebenso große Rolle wie heterosexuellen zu geben – Vierzehnjährige oder Zwölfjährige müssen sich auch mit Analsex, Dildos, Intimpiercing, Gang Bangs, Swinger Clubs, Gleitmittel und Lederpeitschen auseinandersetzen (Sex Mosaik, 81ff, Sex Quiz, 102ff).
Wo Betonköpfe Betonköpfe „Betonköpfe“ nennen
Ein solcher prinzipiell geführter Angriff auf Normen aber ist gerade in der Schule natürlich ein ernsthaftes Problem, zumal wenn Erwachsene ihre eigenen Erfahrungen und Positionen ungeprüft auf Kinder projizieren. Wer sich seiner eigenen Position und Identität einigermaßen sicher ist, kann „Verwirrung“ und „VerUneindeutigung“ sicher als befreiend erleben – wer aber ohnehin schon unsicher und verwirrt ist, wird dadurch eher eingeschränkt.
Härte und Unduldsamkeit gegenüber Schwulen sind gerade bei Kindern und Jugendlichen eben regelmäßig nicht allein Ausdruck herrschender Normen, sondern eigener Verunsicherungen. Wer sich hingegen einigermaßen sicher in der eigenen Identität fühlt, kann deutlich souveräner mit Menschen umgehen, die anders sind als er selbst.
Wer Menschen verwirrt, die sich ihrer selbst sicher sind, stellt möglicherweise sinnvoll Routinen in Frage – wer hingegen Menschen verwirrt, die ohnehin verunsichert sind, wird ihr Bedürfnis nach fraglosen Eindeutigkeiten eher noch wachsen lassen.
Der scheinbar radikalisierende Schritt von einer Erziehung zur Toleranz und Zivilität hin zu einer Erziehung, die den Begriff der Normalität an sich in Frage stellt, ist also tatsächlich eher ein Rückschritt, der Reflexionen verhindert, statt sie zu fördern, und der Verhärtungen aufbaut, statt sie zu lösen.
So ergänzen sich die Gegner und Befürworter einer solchen Erziehung komplementär: Die einen beharren unreflektiert auf einer verhärteten Normalität, die keine Spielräume lässt und Abweichungen schlankweg als Krankheiten und Perversionen hinstellt – die anderen stellen unreflektiert den Begriff der Normalität prinzipiell in Frage und haben eben deshalb überhaupt keinen Sinn für die eigenen, niemals angezweifelten und verhärteten normierten Ideen („Patriarchat“, „Männerherrschaft“).
So stehen sich dann zwei Parteien gegenüber, die beide falsch liegen und einander ähnlicher sind, als sie es wahrhaben wollen.
Falsch ist beispielweise der beliebte Vorwurf, eine „Sexualpädagogik der Vielfalt“ würde Kinder „frühsexualisieren“. In einer sechsten Klasse kann es passieren, dass die eine Hälfte der Klasse bei einem Satz wie „Der Wind bläst um das Haus“ wild zu lachen beginnt, während die andere Hälfte still vergnügt vor sich hin grinst. Kinder und Jugendliche in der Pubertät müssen nicht erst noch eigens „sexualisiert“ werden, sie sind es schon – allerdings: auf eine eigene, gewiss nicht erwachsene Art und Weise.
Eben hier ist Tuider und ihren Mitschreibern offenbar nicht klar oder nicht wichtig, dass ihre großzügige Thematisierung von Lederpeitschen, Dildos und Analsex im Schulunterricht bei Zwölf- bis Vierzehnjährigen eben nicht Vielfalt signalisiert – sondern die Besetzung der Sexualität von Kindern und Jugendlichen durch die sexuellen Erfahrungen und Phantasien Erwachsener.
Tuider, Elisabeth et.al: Sexualpädagogik der Vielfalt. Praxismethoden zu Identitäten, Beziehungen, Körper und Prävention für Schule und Jugendarbeit, Weinheim Basel 2012
Sielert, Uwe: Gender Mainstreaming im Kontext einer Sexualpädagogik der Vielfalt, in: FORUM Sexualaufklärung und Familienplanung 4.2001. Gender Mainstreaming, S. 18-24
Christoph Webers Artikel Was sie noch nie über Sex wissen wollten vom 24. April 2014 wurde von der Süddeutschen Zeitung nicht online gestellt. Er ist hier aber als Scan einsehbar.
Der Artikel erschien zuerst auf man tau.