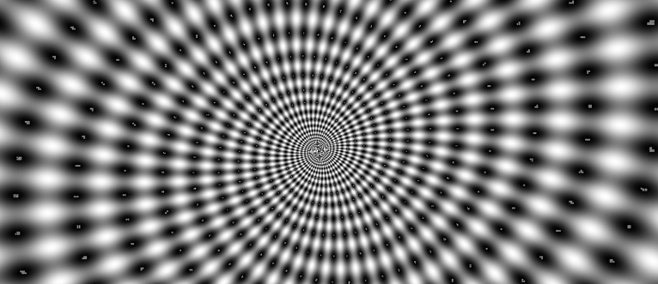Keine Angst, die tun nichts!
Was ist los mit den Schriftstellern in Deutschland? Haben sie sich inzwischen aus der Politik verabschiedet und ihren Beruf an den Nagel gehängt? Es sieht ganz danach aus. Manche hatten es schon geahnt: Schriftsteller! Ach, die nun wieder. Die haben doch sowieso nichts zu sagen. Schriftsteller ist auch kein richtiger Beruf.
 Nun ist es passiert. Der Berufsverband der Schriftsteller VS hat sich aufgelöst und in seine Bestandteile zerlegt. Nein. So kann man das nicht sagen. Der Verband hat sich umbenannt und sich von der Berufsbezeichnung „Schriftsteller“ verabschiedet.
Nun ist es passiert. Der Berufsverband der Schriftsteller VS hat sich aufgelöst und in seine Bestandteile zerlegt. Nein. So kann man das nicht sagen. Der Verband hat sich umbenannt und sich von der Berufsbezeichnung „Schriftsteller“ verabschiedet.
Warum? Einige der Schriftsteller leiden unter einer neuen Unverträglichkeit; sie leiden unter einer Art von Allergie gegen ihre Berufsbezeichnung, die sie früher gemocht haben und auf die einige sogar stolz waren. Doch der Stolz ist dem Leiden gewichten und heute gilt: Wer leidet, hat recht – und so versuchen die bedauernswerten Rechthaber die inzwischen lästig gewordene Bezeichnung „Schriftsteller“ zu meiden. In der neuen Broschüre des ehemaligen „Verbandes der Schriftsteller VS“ heißt es ersatzweise: „Der VS ist der Berufsverband für Schreibende“
Ich könnte also, wenn ich nächstes Mal nach meinem Beruf gefragt werde, antworten: „Ich bin Schreibender!“ Ich fürchte jedoch, dass das dann erst recht nicht als Beruf angesehen wird. Nebenbei hat sich der Schreibende damit auch aus der aktuellen Diskussion um das Urheberrecht verabschiedet. Die findet ohne ihn statt. Der Schreibende braucht keinen Schutz des Urheberrechts. Noch nicht.
Der Berufsverband hat noch einen zweiten Namen. „Berufsverband für Schreibende“ nennt er sich auf den ersten Blick, der auf das obere Ende der ersten Seite der neuen Broschüre fällt. Am unteren Ende, wohin der zweiter Blick fällt, steht: „VS Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller in ver.di“. Dann wäre also jemand, der früher „Schriftsteller“ genannt wurde, heutzutage ein „Schreibender im Verband der Deutschen Schriftstellerinnen und Schriftsteller“. Was sollen wir uns darunter vorstellen?
Das sehen wir im Mittelteil der erwähnten Broschüre. Da finden wir hübsch gestaltete Stichworte, die uns erste Hinweise geben, was wir uns unter den „Schreibenden“ von heute und unter denjenigen, die sich neuerdings als Teil des Zweierpacks „Schriftstellerinnen und Schriftsteller“ sehen wollen, vorstellen mögen – nämlich:
Zunächst fällt auf, dass die Vermeidung der ungeliebten „männlichen Form“ – wie bei „Schriftsteller“ – nicht konsequent durchgehalten wird, obwohl es doch gerade das Anliegen der Initiative zur Umbenennung war, diese Form, die man neuerdings „generisches Maskulinum“ nennt, zu meiden.
Der erste Begriff auf der bunten Spielwiese (die vermutlich zeigen soll, wie fantasievoll die Schreibenden heutzutage sind) lautet „Performer“, der letzte „Wortwerker“. Es heißt nicht etwa, wie man erwarten kann, „Performende“ oder „Performerinnen und Performer“, es heißt auch nicht „Wortwerkende“ oder „Wortwerkerinnen und Wortwerker“.
Warum eigentlich nicht?
Sehen wir mal ab von der Frage, ob „Performer“ und „Wortwerker“ geeignete Beispiele sind, um das Berufsbild der „Schreibenden“ zu erklären, es stellt sich ernsthaft folgende Frage: Warum stören sich die „Schreibenden“ beziehungsweise diejenigen, die zukünftig „Schriftstellerinnen und Schriftsteller“ genannt werden wollen, an diesen Stellen nicht an der sonst als so schädlich angesehenen „männlichen Form“?
Warum bestehen sie darauf, die Bezeichnung „Schriftsteller“ zu ersetzen oder zu ergänzen, nicht aber die von ihnen selbst neu in die Debatte geworfenen Bezeichnungen „Performer“ und „Wortwerker“, die sie obendrein prominent platziert haben? Sie trumpfen regelrecht damit auf, als wollten sie sagen: Seht her! Es geht auch ohne Doppelnennung, es geht auch ohne Partizip.
Wieso geht es? Da liegt doch dasselbe Problem vor.
Ich sehe es nicht als Problem. Aber wenn die empfindsamen Seelen von heute es als Problem sehen und zwar als eines, das ihnen dermaßen wichtig ist, dass sie – koste es, was es wolle – auf einer Umbenennung bestehen, dann sollen sie bitte erklären, warum sie in einem Fall ihre Auffassung vom ihrer Meinung nach richtigem Sprachgebrauch anwenden, in einem anderen Fall aber nicht. Mal so, mal so. Mir kommt es vor, als würde jemand ausrufen „Nieder mit dem Alkohol!“, um daraufhin demonstrativ zwei Schnäpse zu trinken.
Sehen wir uns die Bescherung näher an. Es geht gleich mit einem Eigentor los: Performer sind keine Schreibende. Schreibende sind keine Performer. Sie können auch keine sein. Ich vermute mal, dass die Schreibenden mit diesem unerwartetem Begriff sagen wollen, dass manche von ihnen gelegentlich aus ihren Büchern vorlesen und dass diese Lesungen keineswegs so langweilig sind, wie es viele in Erinnerung haben, so dass ihnen herkömmliche Bezeichnungen wie „Vorleser“ oder „Vorlesende“ nicht geeignet erschienen und sie eine Lesung lieber als etwas sehen wollten, das einer Kunst-Performance nahe kommt. Oder einem Ausdruckstanz. Mag sein. Doch es bleibt dabei: Performer und Schreibende – das passt nicht zusammen.
Es sei denn, es handelte sich bei dem Akt um eine Performance, die darin besteht, dass der Performer gerade schreibt. Dann stimmt es. Sonst nicht. Denn dem Performer geht es nicht um das Ergebnis seiner Performance, also in unserem Fall um das Produkt des Schreibens, sondern um die Performance selber, also allein um den Vorgang des Schreibens, der zunächst für niemanden außer für denjenigen, der gerade damit beschäftigt ist, von Interesse ist. Sicher: Urs Widmer hat einst in seinem Buch ‚Das Paradies des Vergessens’ geschrieben: „ … das Schreiben ist das Ziel, nicht das Buch“. Aber: Das war ein Scherz!
Wer interessiert sich für Schreibende? Ich nicht. So ein Schreibender soll erst mal fertig werden. Dann soll er das Geschriebene noch mal in Ruhe durchlesen und das ganze einem Lektor anvertrauen. Wenn es irgendwann veröffentlicht wird, will ich gerne einen Blick darauf werfen. Aber vorher? Nur wenn es ein Freund von mir ist – oder gegen Geld, weil ich für die Lektoratstätigkeit bezahlt werde.
Was also sind Schreibende? Schreibende können von sich sagen, dass sie Leute sind, die keine Schriftsteller sind. Noch nicht. Sie sind noch nicht so weit. Die neue Parole des Verbandes lautet also: Gehe zurück auf Los, ziehe nicht 4000 Euro ein, fange von vorne an. Ganz von vorne. Mit dem nackten Akt des Schreibens, losgelöst von möglichen Folgen.
Der Schreibende ist wie das Vieh an den „Pflock der Gegenwart“ (Nietzsche) gekettet, er bleibt an der „Gegenwart kleben“ (Schopenhauer). Er wird schon noch merken, wie weit er kommt, wenn er immer nur im Präsens schreibt. Ein Schriftsteller von früher wusste, dass er damit nicht weit kommt. Ein Schriftsteller von früher wusste auch, dass ein Partizip stets einen Vorgang vor seiner Vollendung bezeichnet. Ein Schreibender hat nicht etwa „fertig“, wie man heute gerne sagt, er hat noch gar nicht richtig angefangen.
Man kann den Faktor Zeit nicht ausblenden und sich mit einer allumfassenden Gegenwart begnügen. Zeit spielt sowohl für das Schreiben selber (Erzählzeit und erzählte Zeit), als auch für die Berufstätigkeit eine zentrale Rolle. Der Schriftsteller von früher, der seine Tätigkeit als Beruf ansah, war ein Geschrieben-Habender (der Vorgang des Schreibens lag in der Vergangenheit). Er war jemand, der aus dem Umgang mit seinen fertigen und erfolgreich veröffentlichten Büchern und aus dem Handel mit den damit verbundenen Urheberrechten einen Beruf gemacht hat. Das Reflektierte stand dabei über dem Unmittelbaren. Das Geformte über dem Improvisierten. Das Geistige über dem Körperlichen.
Na gut, ich gebe zu, dass das Schreiben das eigentlich Schöne an dem Beruf ist, da hat Urs Widmer in gewisser Weise recht – vermutlich hat er es in dem Sinne gemeint. Es gibt viele von uns – und dazu gehöre ich auch –, die selbst dann noch schreiben würden, wenn sie keinen Beruf daraus machen können. Viele haben einen zweiten Beruf. Denn das Schreiben selber, so schön es ist, ist noch nicht gesellschaftlich vermittelt, mit dem Schreiben bleibt der Schreibende (jetzt habe ich den Begriff selber verwendet – und zwar mit Absicht) bei sich. Er tut etwas, das ihn glücklich macht. Er tut sich etwas Gutes. Schön. Das ist aber nur ein erster Schritt, der nicht für sich alleine stehen kann. Der Schreibende vergisst während des Schreibens – zumindest phasenweise –, dass er in einer Gesellschaft mit anderen lebt.
Doch die Welt wird nicht angehalten. Sie dreht sich weiter. Gerade ist die Aktion ‚Autoren helfen Flüchtlingen’ angelaufen. Da sind es Autoren. Nicht etwa Autorinnen und Autoren oder Autor-Seiende. Es sieht zwar stark nach einer Aktion aus, bei der es mehr um Selbstdarstellung als um echte Hilfe geht, aber – immerhin – da tut sich was. Es wird uns eindrucksvoll vorgeführt, wie schwer es nicht nur überforderten Politikern, sondern auch routinierten Autoren fällt, ihre aufrechte Gesinnung in Worte zu fassen, die nicht grottenpeinlich wirken. Es geschieht etwas, wenn Autoren die überflüssige und schädliche Trennung der Geschlechter einen Moment lang nicht in den Vordergrund stellen, wenn sie zusammenfinden und solidarisch als Gemeinschaft tätig werden. Autoren können dann vielleicht sogar anderen helfen.
Schreibende können nur schreiben.