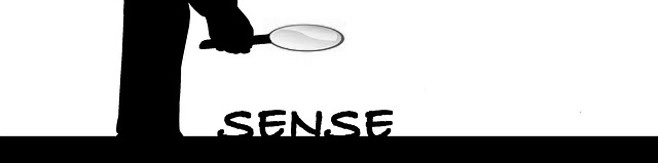Erstmals klar belegt: systematische Diskriminierung von Männern an Universitäten
Vergessen Sie alles, was Sie über Meritokratie gehört haben! Meritokratie, das ist das Prinzip, nach dem diejenigen, die die besten Leistungen bringen, diejenigen sind, die mit begehrten Positionen belohnt werden. Professuren waren einst begehrte Positionen und Meritokratie das Prinzip, mit dem die Professuren besetzt wurden.
 Unter der Ägide des Staatsfeminismus ist dies alles anders: Nicht mehr Leistung entscheidet darüber, wer auf Positionen gelangt, sondern Geschlecht. Das ganze Brimborium, das diese Tatsache verdecken soll, z.B. die Floskel: “Bei gleicher Eignung werden weibliche Bewerber bevorzugt”, ist eben nichts Anderes als Brimborium.
Unter der Ägide des Staatsfeminismus ist dies alles anders: Nicht mehr Leistung entscheidet darüber, wer auf Positionen gelangt, sondern Geschlecht. Das ganze Brimborium, das diese Tatsache verdecken soll, z.B. die Floskel: “Bei gleicher Eignung werden weibliche Bewerber bevorzugt”, ist eben nichts Anderes als Brimborium.
Es dient dazu, den Leichtgläubigen Fairness vorzugaukeln und den anderen den Mund zu stopfen, weil man bei Kritik behaupten kann, dass z.B. Professuren in Deutschland nicht nach Geschlecht, sondern nach Leistung besetzt werden und nur bei gleicher Leistung weibliche Bewerber bevorzugt werden.
Das kann man so lange behaupten, so lange es keine Belege gibt, die diese Behauptung widerlegen.
Und – offensichtlich haben die staatsfeministischen Instanzen nicht aufgepasst – denn:
Es gibt jetzt eindeutige Belege.
Belege, die man nicht wegdiskutieren kann. Belege, die man nicht weginterpretieren kann, und Belege, die man auch nicht als Einzelfall abtun kann, Belege dafür, dass Männer an Hochschulen systematisch diskriminiert werden, dass nicht Meritokratie das Leitmotiv bei der Besetzung von Professuren ist, sondern die Bevorzugung von Frauen, von Frauen, die weniger qualifiziert sind als Männer.
Die Untersuchung, die diese Belege liefert, ist nagelneu, wurde direkt unter der Nase staatsfeministischer Kontrollinstanzen und politischer Korrektheitswächter erstellt, und zwar beim Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln. Ein Leser von ScienceFiles, dem wir an dieser Stelle herzlich danken wollen, hat uns auf diese Untersuchung, nach der niemand mehr behaupten kann, er habe nicht gewusst, dass Männer systematisch an Hochschulen diskriminiert werden, aufmerksam gemacht.
Mark Lutter und Martin Schröder haben die Untersuchung “Who Becomes a Tenure Professor, and Why?” durchgeführt und als MPIfG Discussion Paper 14/19 veröffentlicht.
Fundierte Untersuchungen benötigen eine gute Datenbasis. Lutter und Schröder haben eine gute Datenbasis: Sie berücksichtigen alle Professuren, die im Fachbereich Soziologie, an 77 Instituten für Soziologie in ganz Deutschland von 1980 bis 2013 besetzt wurden. Damit nicht genug, Lutter und Schröder können den gesamten Weg bis zur Professur, den Tenuretrack nachzeichnen, und zwar für 1.260 Soziologen, die im Beobachtungszeitraum 530 Promovenden wurden, 433 Post-Doc Positionen besetzt haben, 36 Junior- und 297 richtige Professuren erreicht haben. Der Datensatz ist mit einem Wort: beeindruckend.
Und er ist einmalig, denn Lutter und Schröder sowie zwei ungenannt gebliebene Helfer haben sich hingesetzt und aus den veröffentlichten Lebensläufen der 1.260 Soziologen und bis einschließlich 2013 alle Publikationen, die in Zeitschriften, Büchern und als graue Literatur veröffentlicht wurden, gesammelt. Die Publikationen wurden zudem in solche in renommierten Peer-Review-Zeitschriften und weniger renommierten Zeitschriften unterschieden. Insgesamt haben die Autoren 28.545 Publikationen zusammengetragen. Warum? Weil die Anzahl der Publikationen, die wissenschaftliche Produktivität als Indikator für die Kompetenz, das Humankapital, eines Wissenschaftlers gilt.
Die Anzahl der Publikationen und deren Ort der Veröffentlichung wird ergänzt von einer Vielzahl weiterer Informationen, die Lutter und Schröder gesammelt haben. Darunter die wissenschaftliche Sozialisation, d.h.: hat ein Soziologe an einer angesehenen oder an einer Provinzuniversität studiert; seine Mobilität, d.h. wie oft hat er die Universität gewechselt, die Dauer internationaler Aufenthalte, sofern es sie gibt, und vieles mehr, das einen Einfluss auf eine Berufung auf eine Professur ausüben könnte.
Auf Grundlage dieser Daten haben die Autoren dann untersucht, was die Soziologen auszeichnet, die auf eine Professur berufen wurden.
Die auf den ersten Blick gute Nachricht vorab: Die Anzahl der Publikationen ist der beste Prädiktor einer Berufung, wobei die Art der Publikationen eine Rolle spielt: wissenschaftliche Beiträge in Peer-reviewed Zeitschriften sind am wichtigsten, es folgen andere Zeitschriftenbeiträge, eigene Monographien, Herausgeberschaften und Kapitel in Sammelbänden mit einigem Abstand. Graue Papiere wirken sich negativ auf die Berufungschancen aus, in sie zu investieren, lohnt sich entsprechend nicht, wenn man eine Professur anstrebt, es sei denn, es ist ein grauer Schocker, wie das Papier von Lutter und Schröder. Interessanterweise spielen Auslandsaufenthalte, die man als eine Form der Horizonterweiterung ansehen kann, bei der Berufung keinerlei Rolle, ebenso wenig wie eine Ausbildung an einer renommierten Universität dies tut.
Das war das, was man auf den ersten Blick als gute Nachricht ansehen könnte.
Nun kommen die schlechten Nachrichten, die zeigen, dass die gute Nachricht eben keine gute Nachricht war:
-
Weibliche Bewerber werden schneller berufen als männliche Bewerber. Männer müssen zwei Jahre länger auf eine Berufung warten als Frauen.
-
Weibliche Bewerber, die auf eine Professur berufen werden, haben deutlich weniger publiziert als männliche Bewerber: “… by the time, men get a tenure, they have published 1.8 times as many SSCI-articles … 1.7 times as many non-SSCI-articles …, 1.4 times as many books …, 1.3 times as many edited volumes …, 1.4 times as many book chapters …, and 1.8 times as much ‘gray’ literature as women”.
-
Für männliche Bewerber ist es schädlich, wenn sie ihre Sozialisation an einer renommierten Universität, z.B. in Heidelberg, Mannheim oder (früher) in München erfahren haben. Dieser Stallgeruch reduziert ihre Wahrscheinlichkeit, eine Professur zu erhalten.
Diese Ergebnisse sind schockierend und ein eindeutiger Beleg dafür, dass an deutschen Universitäten das Prinzip der Meritokratie nicht mehr gilt. Die Arbeit von Lutter und Schröder zeigt, dass das Prinzip der Meritokratie quasi als sekundäre Meritokratie eingesetzt wird, um unter weiblichen Bewerbern den besten Bewerber auszuwählen. Dabei handelt es sich insofern um sekundäre Meritokratie als die besseren männlichen Bewerber, diejenigen mit mehr Publikationen und mit mehr Erfahrung, ausgeschlossen wurden.
Daran gibt es nach der Untersuchung von Lutter und Schröder keinen Zweifel. So wenig Zweifel wie es daran gibt, dass diese offene Benachteiligung von Männern einerseits politisch gewollt ist, andererseits Universitäten schädigt, weil geringer qualifizierte Frauen qualifizierteren Männern vorgezogen werden und das Prinzip der Meritokratie damit zerstört wird.
Was es heute bedeutet, männlich zu sein, lässt sich am Beispiel einer typisch männlichen Bildungskarriere, wie sie unter dem Staatsfeminismus gegeben ist, wie folgt darstellen:
-
Jungen werden häufiger von der Einschulung zurückgestellt als Mädchen.
-
Wer es als Junge in die Grundschule geschafft hat:
-
hat eine höhere Wahrscheinlichkeit als Mädchen auf eine Sonderschule abgeschoben zu werden;
-
hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, nicht versetzt zu werden als Mädchen;
-
hat eine geringere Wahrscheinlichkeit, selbst bei gleicher oder besserer Leistung eine Grundschulempfehlung für ein Gymnasium zu erhalten als Mädchen;
-
Jungen landen entsprechend häufiger auf Haupt- und Sonderschulen als Mädchen und deutlich seltener auf Gymnasien.
-
Entsprechend haben Jungen einen geringere Wahrscheinlichkeit, ein Abitur zu erreichen als Mädchen.
-
Entsprechend gibt es weniger männliche als weibliche Studenten.
-
Männliche Akademiker, die ein Studium abgeschlossen haben,
-
müssen länger warten, bis sie eine Promovendenstelle, Post-Doc-Stelle oder Juniorprofessur erhalten und benötigen im Durchschnitt zwei Jahre länger, um eine Professur zu erreichen als weibliche Adademiker;
-
Damit männliche Akademiker auf eine Professur berufen werden, müssen sie deutlich mehr publizieren als weibliche Akademiker, d.h. der durchschnittliche männliche Bewerber auf eine Professur ist nicht nur qualifizierter als der durchschnittliche weibliche Bewerber, der durchschnittliche männliche Beweber muss auch zusehen, wie ihm geringer qualifizierte weibliche Bewerber vorgezogen werden.
Wenn man diese systematische Benachteiligung von Jungen und Männern im deutschen Bildungseinrichtungen so heruntertippt, dann kann man nicht anders als festzustellen, dass es sich hierbei um eine Form des bildungspolitischen Kahlschlags handelt, unter dem nachwachsende Generationen leiden werden, denn bislang hat es noch keine Gesellschaft dauerhaft überlebt, dass die Besten von Positionen ferngehalten wurden, um mittelmäßige aber politisch dienliche Kandidaten zu berufen.
Der Artikel erschien zuerst auf ScienceFiles.