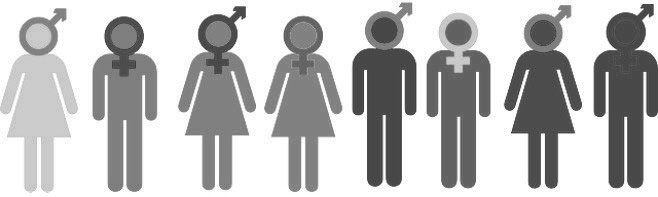Sex ist süß, macht aber dumm
Wie der sexistische Blick und totalitäres Denken die Limbo-Latte niedrig hält

Stellen wir uns vor, aus dem Schwimmbecken im Olympiastation wäre das Wasser abgelaufen, und das Becken wäre stattdessen mit unzähligen kleinen Liebesperlen angefüllt. Die eine Hälfte der Perlen wäre rot, die andere weiß. Nun geht jemand mit verbundenen Augen an den Beckenrand und fischt zehn Perlen heraus. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass fünf davon weiß und die anderen fünf rot ist? Eher klein.
Die Wahrscheinlichkeit wird umso größer, je größer die Menge der Liebesperlen ist, die unsere Testperson angeln darf. Je kleiner die Menge ist, desto größer ist die Abweichung von einer „gerechten“ Teilung in zwei gleich große Hälften. Wenn es unsere Testperson schließlich geschafft hat, alle Perlen herauszufischen, ist das Verhältnis genau 50% zu 50%.
Schon an dieser Stelle sollte man die Forderung, die „Repräsentation von Frauen in Aufsichtsräten zu erhöhen“, ablehnen. Denn die Menge der Aufsichtsräte ist eine kleine – ja, eine sehr kleine Menge, die sich bezogen auf die Gesamtbevölkerung erst bei der vierten oder fünften Stelle hinter dem Komma bemerkbar macht. Bei so einer kleinen Menge kann man keine Repräsentation erwarten. Bei kleinen Mengen wird es immer „ungerecht“ und zufällig sein.

Doch die Quotenbefürworter erkennen keine Untergrenze an, ab der es „statistisch nicht mehr relevant ist“, als wären sie mit großen Zahlen und mit den Grundlagen der Statistik sowieso überfordert. Eine Diskussion mit ihnen ist so, als würden sich Literaten mit Analphabeten unterhalten. Wetten, dass 98% der Quotenbefürworter noch nie etwas von der Gaußschen Glockenkurve gehört haben? Sie haben ein monochromes Bild vor Augen, bei dem an jeder Stelle, die Farbe gleich dick aufgetragen ist. Die Mengen, die sie sich vorstellen, sind komplett durchdrungen von einem überall gleichen Mischungsverhältnis – wie Mus. Man kann an jeder Stelle eine Kostprobe nehmen. Auch eine winzig kleine.
Und so kommt es, dass selbst für Minimengen eine Repräsentanz gefordert wird, wie das Drama um das legendäre Pixi-Buch zeigt, das einst zu einer Anfrage im Hamburger Rathaus führte. Denn in einem dieser Büchlein wurde doch tatsächlich eine Klasse abgebildet mit einer Vorschlagsliste für die Wahl zum Klassensprecher und unter den drei (in Zahlen 3) Namen war keiner, der einen Migrationshintergrund erkennen ließ. Diskriminierung! Rassismus!
Was soll man dazu sagen? Selbst wenn eine Diskriminierung nicht gewollt ist und auch wenn sie überhaupt nicht möglich ist – auch unsere Textperson hatte verbundene Augen – es erscheint ihnen immer so. Nie wird das Ergebnis den Anforderungen einer vorher festgelegten Quote entsprechen. Höchstens zufällig.
Das gilt auch für Bewerbungen. Stellen wir uns vor: Meister Zufall macht einen echten Blindtest. Die Bewerber verschweigen nicht nur Namen, Religionszugehörigkeit, Geschlecht und Aussehen – sie verschweigen alles: Die Mappen bleiben zugeklebt. Hundert Bewerbungen liegen vor, die Hälfte davon von Frauen. Meister Zufall muss sich in diesem Fall nicht extra die Augen verbinden, er wählt einfach eine aus. Und? Zeigt das Ergebnis, dass er Frauen diskriminiert hat? Und wenn nur zehn Bewerbungen von Frauen vorlagen? Wenn er dann einen Mann gewählt hat – war das ungerecht?
Aber wenn das Geschlecht erkennbar ist – und das ist es ja glücklicherweise im wirklichen Leben -, dann spielt es eine entscheidende Rolle bei Bewerbungen – oder? Dann ist das Geschlecht so wichtig, dass es noch wichtiger ist als das Gesetz der Wahrscheinlichkeit. Dann heißt es: Liebling, es gibt keine Zufälle. Aber ist es wirklich so?
Ein Unglück kommt selten allein. Nun kommt das nächste. Bei dem Club der Zuckstückchen-Sammler sind Motive mit Sternkreiszeichen besonders beliebt. Das sind Zuckerstücke, die haben auf der einen Seite das entsprechende Symbol und eine Definition nach Termin, also beispielsweise:
Widder: 21. März bis 20. April
Auf der anderen Seite finden wir die Beschreibungen, die das Horoskop nennt:
Eigenschaften: mutig, strebsam, unternehmungslustig, willensstark, zielbewusst
Launisch, jähzornig, rücksichtslos, ungeduldig
Auf der einen Seite haben wir ein hartes, klares Entweder-oder-Kriterium: Das Geburtsdatum fällt entweder in den angegebenen Zeitraum oder nicht. Auf der anderen Seite finden wir ein weiches Kann-Aber-Muss-nicht-Kriterium. Nicht jeder Widder ist mutig. Löwen und Jungfrauen können genauso gut mutig sein. Müssen aber nicht.
 Bei einer Stellenbesetzung werden jeweils ganze Bündel von Merkmalen, die all die verschiedenen Bewerber mitbringen, verglichen. Man darf sich nicht von dem Singular in der Formulierung „bei gleicher Qualifikation“ täuschen lassen. Hier werden viele Faktoren abgewogen. Es geht um mehr als immer nur um das eine. Der Betrieb sagt sich: Wir brauchen Mitarbeiter die mutig und strebsam, aber auch nicht allzu rücksichtslos sind; die einerseits willenstark sind, aber nicht launisch. Es ist sehr kompliziert.
Bei einer Stellenbesetzung werden jeweils ganze Bündel von Merkmalen, die all die verschiedenen Bewerber mitbringen, verglichen. Man darf sich nicht von dem Singular in der Formulierung „bei gleicher Qualifikation“ täuschen lassen. Hier werden viele Faktoren abgewogen. Es geht um mehr als immer nur um das eine. Der Betrieb sagt sich: Wir brauchen Mitarbeiter die mutig und strebsam, aber auch nicht allzu rücksichtslos sind; die einerseits willenstark sind, aber nicht launisch. Es ist sehr kompliziert.
Und dann kommt die Kritik, die sagt: Ihr habt zu wenig Leute eingestellt, die im Zeitraum vom 21. März bis zum 20. April geboren sind. Denn allein darauf kommt es an. Es gilt nur die eine Seite des Zuckerstückes. Der Diskriminierungsvorwurf ist also – wie man im Tennis sagt – ein Doppelfehler: Die Statistik wird falsch angewandt und das Zuckerstück wird umgedreht. Sexistisches und totalitäres Denken drängelt sich vor. Das Primitive will sich über das Komplexe erheben. Oder wie wir auf dem Land sagten, wenn einer mit der Axt eine Blume pflücken wollte: stumpf ist Trumpf.
Das Zuckerstück ist ein gutes Beispiel für den Schleiertanz, der mit den Begriffen „Gender“ und „Sex“ veranstaltet wird. Gucken wir uns das Stückchen noch einmal an. Die beiden Beschreibungen eines Tierkreiszeichens entsprechen den beiden Definitionen von Geschlecht. Die eine Seite zeigt uns „Sex“ – das biologische Geschlecht, da heißt es: entweder oder. Die andere Seite zeigt uns „Gender“ – das soziale Geschlecht, da werden die verschiedenen Rollenbilder genannt, die wir annehmen können und von denen wir möglicherweise beeinflusst sind.
Eigentlich ist alles in Ordnung. Die Auswahl der Bewerber, wie sie bisher gehandhabt wurde, ist nämlich durchaus „gendersensibel“, sie ist jedoch nicht „sextauglich“. Auch der „Gender-Pay-Gap“ ist ein irreführender Begriff, er müsste „Sex-Pay-Gap“ heißen: Die Statistik kennt nur „männlich“ oder „weiblich“. Dass ein Mutiger anders bezahlt wird als ein Sozialkompetenter, kann in der Welt der Zahlen nicht erfasst werden. Mit dem sozialen Geschlecht kann man nicht rechnen, „Gender“ passt in keine Statistik. Auch die Quote unterscheidet nach Sex, nicht nach Gender. Es wäre wirklich alles in Ordnung, wenn nicht Leute, die immer nur an Sex denken, ständig behaupten, dass das Zuckerstück nur eine Seite hat.
Es kommt noch schlimmer. In Deutschland sind wir gebeutelt von einem „sexistischen Mantra“, mit der wir uns international schon genug blamiert haben – ich meine die so genannte Doppelnennung, wenn wir etwa von „Wählerinnen und Wählern“ sprechen und in der Bibelübersetzung in „gerechter“ Sprache von „Makkabäerinnen und Makkabäern“. Dagegen lässt sich viel sagen – was ich mir an dieser Stelle verkneife. Ich will nur kurz fragen: Um wie viele Mengen handelt es sich? Um eine oder um zwei?
Wenn wir schon mal Urlaubsvideos bearbeitet haben, kennen wir im Menu „Bearbeiten“ die Funktion „Auf Auswahl trimmen“. Mit einem Klick erscheint dann eine ausgewählte Episode als neuer Film, den wir noch weiter bearbeiten können. Unsere Doppelnennung wie bei „Wählerinnen und Wählern“ ist so, als würden wir sagen: „Die auf Auswahl getrimmte Menge und die Gesamtmenge“. Wenn nun eine Quote gefordert wird, stellt sich die Frage: bezogen auf welche Menge?
An dieser Stelle wird gemogelt. Wenn wir eine Ungerechtigkeit bei der Stellenbesetzung behaupten, müssten wir die „auf Auswahl getrimmte“ Menge der Bewerberinnen berücksichtigen und nicht die Menge aller Frauen. Wenn wir wissen wollen, wie viele Frauen die Pille nehmen, befragen wir auch nur die geschlechtsreifen Jahrgänge und nicht etwa alle Frauen jedweden Alters. Befürworter der Quote starren aber auf die Gesamtmenge und wünschen sich einen Prozentsatz, der tendenziell bei 50% liegt. Oder glaubt jemand, dass die Forderungen, die jetzt bei 40% liegen, da liegenbleiben?
Die Engländer haben den Trick bemerkt. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass sie noch nicht so dusselig geworden sind wie wir, weil sie die manipulative Doppelnennung nicht kennen, es wird wohl eher daran liegen, dass sie den Vorgaben aus Brüssel mit größerer Gelassenheit gegenüberstehen. Ein so genanntes Select Commitee hat sich mit den Argumenten für und gegen eine Quote befasst. Michael Klein hat den Text, bei dem kein Argument für die Quote übrig bleibt, übersetzt und auf „Kritische Wissenschaft – critical science“ unter dem Titel „Eine Frauenquote ist rational nicht begründbar“ veröffentlicht. Die Engländer stellen fest, dass die angestrebte Förderung gar nicht „den“ Frauen nützt, wie behauptet wird, sondern nur einer kleinen auf Auswahl getrimmten Minderheit von Frauen. Sie haben richtig erkannt, um welche Menge es eigentlich geht.
Ob wir das auch können? Stellen wir uns einen Volksmarathon in Berlin vor. Es sind hunderttausend Läufer an den Start gegangen. Die ersten tausend kriegen einen kleinen Preis. Unter ihnen sind aber nur 10 % mit Migrationshintergrund. Das ist zwar viel, wenn man bedenkt, dass unter denen, die an den Start gegangen sind, überhaupt nur 5 % einen Mihigru haben. Dennoch ist es ein Skandal. Denn in Berlin haben ganze 40 % der Bürger einen Migrationshintergrund. Berlin ist tolerant und will noch toleranter werden. Und so wird beim nächsten Marathon eine Quotenregelung eingeführt: Die Läufer unterliegen einer Kennzeichnungspflicht. Sobald 600 Läufer, die keinen Migrationshintergrund haben, im Ziel sind, werden alle folgenden Läufer ohne Mihigru angehalten und müssen so lange auf der Stelle treten, bis 400 Läufer mit Mihigru im Ziel sind. Dann kann es weitergehen. Das kann man leicht regeln – mit einer Ampel und einer computergesteuerten Zählung und natürlich mit einer Strafandrohung, wenn einer trotzdem weiterläuft.
Wie gesagt: Nur die ersten Tausend kriegen einen Preis. Ein Zuckerstückchen.