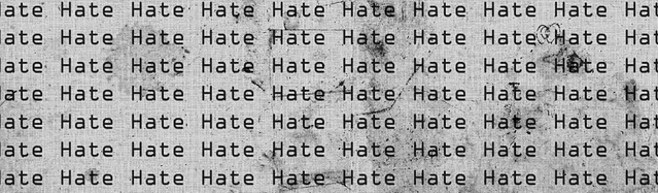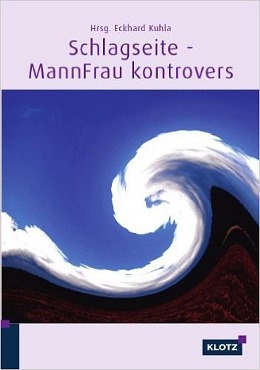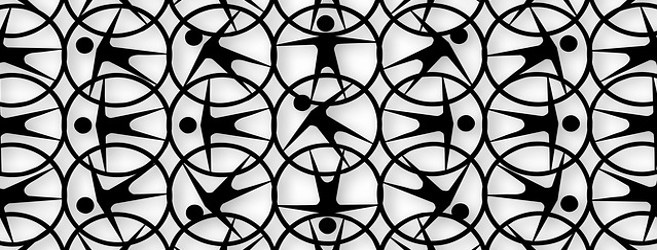Zensur in Deutschland
Wir sind nicht mündig und nicht frei. Richter sitzen viel zu oft vor dem Fernsehen und wissen nicht mehr, was ein Buch ist. Frauen haben eine neue Geldquelle erschlossen. Die Schlinge um den Autor wird enger.
Teil 1: Wir sind nicht mündig und nicht frei
Gerade wollte ich das Buch mit dem originellen Titel ‚Das Da-Da-Da-Sein’ von Maik Brüggemeyer empfehlen und hatte schon geschrieben: „Der Autor macht alles richtig. Es kommen großartige Sätze vor, als würde es zwischendurch aufblitzen …“
Dann hieß es: Kommando zurück. In letzter Sekunde stoppte der Verlag die Auslieferung, nachdem eine einstweilige Verfügung gegen das Buch angedroht worden war. „Eine Frau glaubt, darin porträtiert zu werden, und fühlt sich in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt“, hieß es bei ‚Welt online’. Der Roman würde nun erst einmal den Wünschen der juristischen Gegenspielerin angepasst. Dem ‚Focus’ sagte der Autor: „Als Schriftsteller, der über die Gegenwart schreibt, kommt man in Deutschland ohne Anwalt nicht mehr aus.“
Helfen da noch Anwälte? Befreien sie den Autor von den Fesseln oder legen sie ihm überhaupt erst welche an? Trifft hier das berühmte Bonmot zu, dass die Psychoanalyse das Problem ist, für dessen Lösung sie sich hält? – in diesem Fall bezogen auf Anwälte und unser Rechtssystem.

Die viel zitierte „Freiheit der Kunst“ wird uns nicht etwa großmütig durch unabhängige Richter und durch das segensreiche Wirken von selbstlosen Anwälten garantiert – im Gegenteil: Die Herrschaften in Talaren finden je nach Grad ihrer Anpassung an die Stimmung im Lande neue Gründe, die „Freiheit der Kunst“ einzuschränken, etwa weil – ihrer Meinung nach – Gewalt verherrlicht oder der Staat verunglimpft wird, oder weil – so die aktuelle Variante – das Persönlichkeitsrecht verletzt wird. Das Private ist politisch, das Persönlichkeitsrecht einer Frau ist zur Staatsaffäre geworden.
„Die neue Redefreiheit“ ist nur noch eine Werbung für eine Flatrate. Bei politischen Diskussionen gilt die nicht mehr, wir beißen uns vorsichtshalber auf die Zunge, da gibt es nicht nur Fettnäpfchen, sondern „Meinungsdelikte“, wie Pascal Bruckner sagt. Auch wenn der ‚Spiegel’ meint, „Political Correctness ist gesellschaftliche Toleranz“, im Flüsterton wird sie als „Stasi West“ bezeichnet.
Korrektes Sprechen gilt besonders gegenüber Frauen. Wir befinden uns in einer Situation, in der „nichts Gutes über Männer und nichts Schlechtes über Frauen“ veröffentlicht wird, wie jemand, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, gesagt hat. Den Eindruck habe ich auch. Dann ist auch die Freiheit der Kunst bedroht – sofern darin Frauen vorkommen, was fast immer der Fall ist.
Dabei basiert die Freiheit der Kunst auf einem „Gesellschaftsvertrag“ der besonderen Art: Die Freiheit der Autoren gründet sich auf die Freiheit der Leser. Beide Enden hängen zusammen und bedingen sich. Der „liebe Leser“ ist volljährig, er kann ohne Bevormundung selbst entscheiden, was er sich zumuten will und was nicht. Ich mache von dieser Freiheit übrigens häufig Gebrauch: Wenn mich ein Buch langweilt oder meine Intelligenz unterfordert, lege ich es weg.
So möchte man auch der Klägerin zurufen: Lass doch die Finger von dem Buch. Tu doch nicht so, als sei das Pflichtlektüre, respektiere die Freiwilligkeit als Grundlage für den Umgang mit Kunst. Du musst das nicht lesen. Doch die Klägerin dachte vermutlich, dass sie muss. Sie fühlte sich nicht frei. Dann sollen sich andere auch nicht frei fühlen. Der Autor nicht. Und die potentiellen Leser auch nicht, die sollen von vorneherein in ihrer Wahlfreiheit eingeschränkt werden und den Text gar nicht erst lesen dürfen.
So wird die Klägerin nicht erfahren, ob die Leser zu demselben Urteil über die von ihr beanstandeten Passagen kommen oder nicht. Vielleicht sind denen gerade diese Stellen herzlich gleichgültig. Vielleicht sind sie ihr sogar selber wenig später herzlich gleichgültig.
Die Freiheit im Umgang mit dem Buch bringt es mit sich, dass der Leser entscheiden kann, wann er ein Buch lesen will. Er kann auch über das Lesetempo bestimmen: Er kann Pausen einlegen, Seiten überblättern und kann sogar – falls die Spannung unerträglich wird – das letzte Kapitel zuerst angucken. Er liest mit Lesebrille und mit Eselsohren. Der mündige Leser kann jederzeit innehalten und sich seine eigenen Gedanken machen, er kann die Lektüre langsam auf sich einwirken lassen und kann sich genauso gut gegen jegliche Wirkung immunisieren. Ein gutes Buch ist in etwa so wie diese Seife, von der früher mal ein Werbeslogan behauptet hat: „Diese Seife entfaltet auf jeder Haut einen anderen Duft.“
Jeder Leser duftet anders. Ein Leser ist in keiner Weise verpflichtet, sich der Sichtweise des Autors oder der Perspektive der Romanhelden anzuschließen. Er muss nichts von dem nachmachen, was ihm die Figuren an Dummheiten vorführen. Der Dichter, so bedeutend er auch sein mag, ist letztlich doch nur – wie Berthold Brecht einst in seiner berüchtigten Bescheidenheit gesagt hat – einer, der lediglich „Vorschläge“ gemacht hat, mehr nicht. Unter solchen Umständen möchte man gerne Leser sein – oder?
Wenn nun irgendwo auf der Welt diese Freiheit bedroht oder eingeschränkt wird, ist ein Autor auf der Seite der Leser und setzt sich für seine Freiheiten ein, weil das auch die Freiheit des Autors gewährleistet. Ich rufe also zweistimmig nach Freiheit – als Autor und als Leser: Freiheit! Freiheit!
Die Freiheit der Leser macht die Wirkung so unübersichtlich. Wer sich auch nur ein wenig mit Rezeptionsästhetik befasst, merkt schnell, dass es „ein weites Feld“ ist. Mindestens. Die lieben Leser lassen sich nicht vorschreiben, wie das geschriebene Wort zu wirken hat. Einstweilige Verfügungen oder Verbote setzen aber voraus, dass ein Text nur eine einzige Lesart zulässt und sich nur auf eine einzige Art auswirkt – nämlich auf die Art, die man unterbinden will. Aber nichts da. Ein Roman ist komplex und widersprüchlich und bietet sich einer Leserschaft an, von denen sich jeder selber seinen Reim auf die Welt macht.
Wer bei so einer Vielfalt und so einem Reichtum mit Verboten kommen will, erweist sich als kulturfremder Primitivling, der versucht, mit der Keule eine SMS zu schreiben. Außerdem wird deutlich, dass hier jemand gerne den Tyrannen spielt.
Teil 2: Richter sitzen viel zu oft vor dem Fernsehen und wissen nicht mehr, was ein Buch ist.
Wir erinnern uns vielleicht: Im Jahre 2003 wurde das Buch ‚Esra’ von Maxim Biller verboten. Das hatte Nachwirkungen. Als noch nicht feststand, dass ‚Esra’ tatsächlich verboten werden würde und auch nicht klar war, wie der Streit um eine Entschädigung in Höhe von 100.000 Euro ausgehen würde, schrieb Daniel Kehlmann zu dem drohenden Verbot: „ … so wäre das ein Skandal sondergleichen und ein Schlag, von dem sich Deutschland als literarischer Standort nicht erholen würde. Wie schriebe man denn, wenn man befürchten müßte, daß jedes Buch nicht bloß verboten werden, sondern auch noch Grund für die gerichtlich verordnete ökonomische Vernichtung sein könnte? Mit Angst oder gar nicht mehr oder am liebsten anderswo, kurz: wie in einer Diktatur.“ ?

Es kam zum Schlag. Dabei sei es doch eine „Binsenwahrheit“, so Kehlmann weiter, dass ein Autor aus dem „Leben schöpfen“ würde, es könne doch nicht angehen, dass man Biller verbiete, was anderen Autoren zugestanden wurde. ?
„Ist Kehlmann bei Trost?“, fragte Ulrich Greiner – eine Frage, die ich mit einem klaren „Ja“ beantworten kann. Doch ich ahne, warum Greiner so scheinheilig fragt. Er steht als Kritiker nicht auf der Seite der Autoren, sondern auf der Seite der Richter, wenn nicht gar der Henker. Und er greift zu starken Worten, weil sein Argument schwach ist.
Sein Argument ist, dass Goethe, Proust und andere Größen es im Unterschied zu Biller richtig gemacht haben, wenn sie „Rudimente der Realität“ in ihre Werke „eingeformt“ hätten – das haben sie nämlich, genial wie sie waren, so hingekriegt, „dass Ähnlichkeit erkennbar wurde, nicht aber Identität. Das Identische zeigt auf den anderen, das Ähnliche auf uns selber.“ Alles klar?
Nein. Was ist – bitte schön – das „Identische“? Das Identische gibt es nicht in der Literatur. Aber wir können mit Hilfe dieses unglücklichen Begriffes nachvollziehen, wie Greiner auf das schmale Brett gekommen ist. Das Gericht hatte damals gefunden, Biller habe „keine Typen dargestellt, sondern Portraits“. Da haben wir das Schlüsselwort: „Portrait“, das uns zum „Identischen“ führt. Auch im Fall von Brüggemeyer hieß es, die Klägerin sehe sich „portraitiert“.
Das kann man so sagen, wenn man locker drauflos plaudert. Wir denken dabei an Maler oder Fotografen. Deren Portraits unterscheiden sich allerdings in einem entscheidenden Punkt von den „Portraits“, die ein Schriftsteller zustande bringt. Portraits der bildenden Künstler idealisieren und verfremden womöglich, sie setzen aber immer eines voraus: die Identität des Portraitierten.
In der Literatur ist das gerade nicht so. Mark Twain hat sich für die Figur von Tom Sawyer an vier verschiedenen Jungen aus dem richtigen Leben orientiert. Und erst vor kurzem ist der „alte Mann“ verstorben, der das Vorbild vom ‚Der alte Mann und das Meer’ gewesen sein will – erstaunlich eigentlich; denn schon zur Zeit, als Hemingway das Buch schrieb, müsste er vergleichsweise alt gewesen sein. Aber gönnen wir ihm seine Einnahmen durch Fotos, auf denen er zusammen mit glücklichen Touristen abgebildet wurde. Er war nicht der einzige.
Bei Bildern ist es offensichtlich. Da gibt es Identität. Wir rechnen nicht damit, dass Mona Lisa so raffiniert war, dass sie sich zwischendurch von drei Freundinnen vertreten ließ, die alle hintergründig gelächelt haben. In der Literatur wäre das gut möglich. Da gibt es keine Identität des Porträtierten. Die Verfilmungen täuschen darüber hinweg, weil wir Bilder sehen, und immer ein und derselbe Schauspieler einen Charakter darstellt. Abgesehen von dem Film ‚Das obskure der Begierde’ von Luis Buñuel, in dem die Hauptfigur von zwei Schauspielern verkörpert wird. Zu meiner Enttäuschung war es eine Verlegenheitslösung – ich dachte, es wäre ein Kunstgriff.
Erst wenn man sich klar macht, dass hier ein falsches Verständnis vorliegt von dem, was ein „Portrait“ in der Literatur bedeutet, kann man die Denkweise der Kläger verstehen. So haben sie Biller vorgeworfen, dass er „intime Details“ preisgegeben hätte. Doch gerade die Details müssen – im Unterschied zum Bild – beim Buch überhaupt nicht stimmen.
Wenn wir auf einem Bild von Marilyn Monroe ein Muttermal erkennen, vermuten wir, dass Norma Jeane auch im richtigen Leben an genau der Stelle eins hatte. Wenn jedoch einer Figur in einem Buch ein Muttermal angedichtet wird, hat der Leser keinerlei Gewissheit; denn bei einem literarischen Portrait wird gar nicht der Anspruch erhoben, dass sich die Details im richtigen Leben wiederfinden – im Gegenteil: Die Verwendung von Details folgt einer eigenen Logik; einer, die im künstlerischen Konzept des Autors liegt. Da ging es womöglich nur um eine Kolorierung aus reiner Freude an der Farbe – um auch mal eine Formulierungen zu verwenden, die eher für einen Maler gilt.
Patricia Highsmith hat für ihre Krimis die Charaktereigenschaften und die äußeren Merkmale von Leuten aus ihrem Bekanntenkreis munter gemixt. So gibt es bei ihr keine klischeehafte Verbindung von Sein und Schein: Der Polizist, der so gutmütig aussieht, erweist sich wenig später als Gauner. Wer hätte das gedacht? Literarische Figuren sind eben keine Portraits wie von einem Maler, sie sind Patchwork-Figuren, deren Entsprechung im wirklichen Leben sich nicht an einer einzigen Person festmachen lässt.
 Deshalb kann es bei Romanen keine Persönlichkeitsrechtsverletzung geben. Denn man kann bei einem Buch, sofern es kein ausgewiesenes Sachbuch oder eine Arbeit ist, die den Anspruch erhebt, eine genaue Biographie zu sein, nicht von der Identität einer Persönlichkeit ausgehen. Die setzten wir aber voraus, wenn wir eine Verletzung der Persönlichkeit beklagen.
Deshalb kann es bei Romanen keine Persönlichkeitsrechtsverletzung geben. Denn man kann bei einem Buch, sofern es kein ausgewiesenes Sachbuch oder eine Arbeit ist, die den Anspruch erhebt, eine genaue Biographie zu sein, nicht von der Identität einer Persönlichkeit ausgehen. Die setzten wir aber voraus, wenn wir eine Verletzung der Persönlichkeit beklagen.
Stellen wir uns vor, ein junger Mann – nennen wir ihn Walter Smith – hätte gegen ‚Tom Sawyer’ geklagt, weil er sich darin „porträtiert“ sieht. Er könnte eine Verletzung seines Persönlichkeitsrechts nur zu einem Teil geltend machen, vielleicht zu 25%. Die Details, an denen er eine Wiedererkennung festmachen will, hätten keine Beweiskraft. Er wäre nicht der einzige Lieferant solcher Details. Und vielleicht hatte sich Mark Twain gerade diese Einzelheiten nur ausgedacht.
Darüber sind sich bisher Leser und Autoren immer einige gewesen. So funktioniert auch die Wiedererkennung, die einem so viel Freude bereiten kann: Die Leser erkennen in einer Figur einen Freund wieder. Einen Feind. Vielleicht sogar sich selbst. Die Beschreibung trifft aber immer nur – wie Björn Engholm sagen würde – „ein Stück weit“ zu. Und das Erstaunliche dabei: Die Wiedererkennung funktioniert, obwohl gerade die Details nicht stimmen. Der Leser schmunzelt und sagt sich: Genau, so eine Frau kenne ich auch, nur dass sie kein Muttermal hat. Oder: So einen Jungen kenne ich auch, nur dass er nicht Tom heißt. Walter Smith erkennt sich selbst. Vielleicht tut das auch seine Mutter. Und sein Anwalt. Jeder andere macht sich ein anderes Bild und erkennt andere.
Wer will unter diesen Voraussetzungen auf Persönlichkeitsverletzung klagen? Was sind das überhaupt für Leute? Es sind welche, die Bild und Buch verwechseln; welche, die zuviel Pro7, zuviel Sat1 und zuviel RTL geguckt haben und den Kontakt zur Literatur verloren haben. Sie wissen nicht mehr, was ein Buch ist.
Teil 3: Frauen haben eine neue Geldquelle erschlossen.
Wir finden es schlimm, wenn in anderen Ländern Kunst und Meinungsfreiheit einer ungerechtfertigten Zensur unterliegen. Es ist noch nicht lange her, dass die helle Empörung über die Knechtung der Kunst, wie man sie in der DDR beobachten konnte, einen großen Teil des moralischen Überlegenheitsgefühls eines selbstbewussten Westlers ausmachte. Wir im Westen waren besser. Bei uns gab es Freiheit. Bei denen nicht.
Wie weit die Kunst eingeschränkt wird, gilt als Gradmesser dafür, wieweit eine Gesellschaft sich zu einem totalitären System entwickelt hat. Da wo der Würgegriff der Zensur besonders groß ist, finden wir nicht nur langweile Bücher – das wäre noch nicht so schlimm -, sondern auch geduckte Menschen, anspruchslose Leser, die sich nichts mehr zutrauen und nichts mehr erwarten vom Leben, weil sie in ihren Hoffnungen und Träumen beschnitten wurden und ihre Gedanken nicht mehr spazieren führen dürfen.
Doch es geht nicht nur darum, Autoren einzuschüchtern, zu bestrafen und zu ruinieren und eine Stimmung zu schaffen, die man früher mit der Nachtwächterruhe eines Deutschen Michels beschrieben hat. Es geht um Geld.
„Ich ging durch die Hölle“, berichtet Lisa Loch, die vor ca. 9 Jahren von Stefan Raab verhöhnt wurde und für die Verletzung ihrer Persönlichkeit mit 60.000 Euro entschädigt wurde – sie wollte ursprünglich 300.000. Eine Therapie hat ihr geholfen. Und das Schreiben: Sie schrieb fleißig an einem Buch über ihre Erlebnisse in der Hölle.
Nun weiß ich nicht, wie ich den Eindruck vermeiden kann, ich wollte Stefan Raab in Schutz nehmen. Das will ich nicht. Was soll gut daran sein, dass er die Nebengeräusche, die der Name Lisa Loch verursacht, so laut aufdreht, dass alles andere übertönt wird? Das ist nicht anspielungsreich, sondern anspielungsarm.
Viel besser ist es bei Caroline Kebekus auch nicht, selbst wenn sie hoch gelobt wird. Sie nennt das Starmodel Sandy Meyer-Wölden – inzwischen als Sandy Pocher bekannt – „Sandy Meyer-Kotz“. Dass sie gerade schwanger ist, kommentiert sie so: „Pocher stopft das Sommerloch“.
Wird das auch eine Klage geben? Um – sagen wir – 500.000 Euro? Ich glaube nicht. Warum gilt die Erwähnung einen Loches und das Hervorrufen von Assoziationen, die damit einhergehen, einmal als Beleidigung, ein andermal nicht? Weil es nicht darum geht, WAS gesagt wird, sondern WER es tut.
Als ich im ersten Teil einen unbekannten Beobachter zitierte, der meinte, dass wir heute in einer Zeit leben, in der „nichts Gutes über Männer und nichts Schlechtes über Frauen“ gesagt werden darf, hatte ich nicht daran gedacht, dass es nur teilweise richtig ist. Man muss so sagen: Männer dürfen nichts Schlechtes über Frauen sagen, Frauen können über ihr Geschlecht sagen, was sie wollen. Es bietet sich ein schrilles Bild: Männer kuschen und Frauen spreizen sich.
Eine Frau darf. Charlotte Roche trumpft mit Schamlosigkeiten auf. Sie schreckt ganz offensichtlich nicht zurück vor der peinlichen Frage, die im Fall von Biller und von Brüggemeyer die Klägerinnen quälte, vor der Frage nämlich, ob man sie – zumindest teilweise – in einer Figur des Romans wiedererkennen kann. Bei Charlotte Roche ist das kein Problem. Können wir. Sie präsentiert uns die Antwort auf einem bekleckerten Silbertablett.
Teil 4: Die Schlinge um den Autor wird enger
Ich werde nun etwas tun, das nicht sein soll. Ich biete etwas zum Lesen an, das per Gerichtsbeschluss nicht gelesen werden soll, ich werde eine verbotene Passage enthüllen. Nicht von Maxim Biller. Nicht von Maik Brüggemeyer. Es geht um einen Fall, der weitgehend unbekannt geblieben ist. Es handelt sich – so merkwürdig das jetzt klingt – um einen Glücksfall. Es geht um eine recht kurze Passage, die ich in voller Länge zitieren kann, ohne die Leser zu strapazieren. Die Klägerin kommt nur in diesen Zeilen vor. Sonst nicht. Das fragwürdige Glück besteht also darin, dass wir das Problem vollständig erfassen und qualifiziert beurteilen können. Der Fall ist angenehm übersichtlich.
Ein Sonderfall also. Ein Roman gehört zu den großen Formen, da gibt es eigentlich keine „Stellen“, auch wenn so mancher Leser danach geiert. Das heißt aber auch einmal mehr, dass man das Persönlichkeitsrecht auf Romane nicht anwenden kann. Kommt eine Figur an mehreren Stellen vor, dann relativieren sich die Passagen, sie widersprechen sich womöglich; eine Figur wird ambivalent und vielschichtig. Nicht nur im so genannten Entwicklungsroman entwickelt sich ein Charakter. Wo will da eine Klage ansetzten?
Hier gibt es nur ein Zitat. Die Klägerin, die namentlich nicht genannt wird, argumentierte so: Der Ort des Geschehens ist so klein, dass ihr Fall bekannt ist, zumal darüber ausführlich in der Lokalpresse berichtet wurde. Sie ist also identifizierbar.
Das Argument wirkt auf den ersten Blick wie ein Eigentor. Wir fragen uns: Wenn schon die Presse darüber geschrieben hat, wieso darf der Fall nicht auch noch in einem Buch vorkommen? Hat sie etwa die Lokalpresse und die Leserbriefschreiber auch alle verklagt?
Dennoch war das Argument ein Treffer. Es geht nämlich nicht darum, ob etwas schon bekannt ist oder nicht, genauso wenig wie es darum geht, ob es wahr ist oder nicht, was der beklagte Autor geschrieben hat. Es geht nur darum, ob die Person identifizierbar ist und ob etwas „Persönliches“ über sie geschrieben wurde, wovon sie sich verletzt fühlen könnte.
Es geht auch nicht darum – wie wir es vielleicht dunkel als Fragestellung aus dem Deutschunterricht in Erinnerung haben -, was uns der Autor damit sagen wollte. Seine Intention spielt keine Rolle, sein künstlerisches Konzept auch nicht. Der Autor war übrigens von der Klage völlig überrascht; er wollte der Frau, die er nicht näher kannte, nichts antun. Er brauchte die kleine Skizze nur als Beitrag zu dem Gesamtbild, das er von dem Ort zeichnen wollte.
Egal. Der Mann, dessen Namen ich sicherheitshalber auch nicht erwähne, ist alles andere als ein Skandalautor oder ein Krawallmacher. Er gilt als anspruchsvoll und sensibel. Leser schätzen seinen lyrischen Ton. Seine Stärke liegt in der kleinen Form (der Roman ist auch eher schlank), seine Kurzgeschichten sind hervorragend.
Er wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. Es war zwar nur ein Bruchteil von dem, was die Klägerin gefordert hatte (offenbar geht es bei Gericht zu wie auf dem Bazar), aber es war schmerzlich genug. Der Roman, dessen Titel ich ebenfalls streng geheim halte, durfte in der ursprünglichen Form, also mit der heiklen Stelle, die ich gleich zitieren werde, nicht mehr erscheinen. Die verbliebenen Exemplare wurden geleimt – d.h. die Seiten wurden zusammengeklebt, so dass man nicht mehr blättern kann in dem Buch, das nun als Dekoration in Möbelhäusern in Regalen, die ansonsten leer bleiben müssten, herumsteht.
Der Autor war nicht vorbelastet. Er ist kein Jude (was ich nur deshalb erwähne, weil Maxim Biller meint, dass es in seinem Fall eine Rolle spielt). Es waren keine alten Rechnungen im Spiel. Es gab keine Nebenschauplätze. Wir haben es wirklich mit einem „Glücksfall“ zu tun: Hier zeigt sich Persönlichkeitsrechtsverletzung in ihrer reinen Form. Achtung – es geht los:
„Nach Süden sah ich hinab auf das alte Maschinenhaus. Nun wohnte in ihm ein Zahnarzt. Vor seiner Tür saß dunkel die Frau, hielt zwischen Lupinen ein Baby. Nach Norden hin besaß, wo die Bauern hatten abliefern müssen, den Getreidespeicher nunmehr ein Lehrer. Weitgereist war der, um sich ein Unglück heimzuholen. Bis nach Australien hin hatte er Umwege gelebt. Als dann im Speicher die starkhaarige Schönheit untergebracht war, zeugten sie Kinder. Er hatte seine Arbeit, sie die Kinder, und waren selber noch zwei. Sie sahen den Irrtum. Deutsch sprach die Frau bald nur noch wie Englisch. Den Haupt- und Tätigkeitswörtern entzog sie die Endungen für Fall, Zeitform, Geschlecht. Mit niemandem mehr sprach der Mann Hochdeutsch. Kurz kaute er die Sätze und platt. Auch das war brauchbar für ihr wechselseitiges Kampfgeschrei. Zwischendurch, als keiner hinsah, stürzte ihnen die Tochter ins Bad und schien erstickt. Sie wurde gerettet, mit ihr aber nicht das ganze Gehirn. Lange blieb das Kind, wie es herausgefischt war, klein und beschädigt. Das Unglück verbündete die Eltern kurz. Dann siegte ihr eigenes und hieß sie wieder kämpfen. In Dreck stürzten beide, die Kinder dazu, Familiendrecksturz.“
Das war’s. Ich erinnere an Daniel Kehlmann, der in einem Kommentar zum Fall Biller davon gesprochen hat, dass unter solchen Bedingungen ein Autor nur noch schreiben kann wie „in einer Diktatur“. Und ich erinnere daran, wie es in einer Diktatur zugeht, da gilt die Formel von Mao Tse Tung: Strafe einen, erziehe hundert. Da herrscht Unsicherheit. Willkür. Angst. Der Autor weiß nicht, was er schreiben darf und was nicht. Er spürt aber, dass die Schlinge um den Hals enger wird.