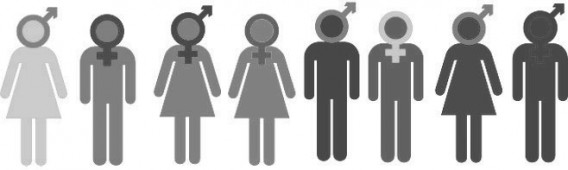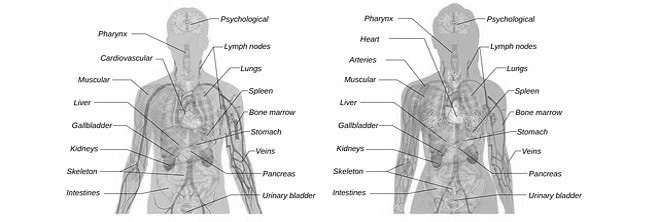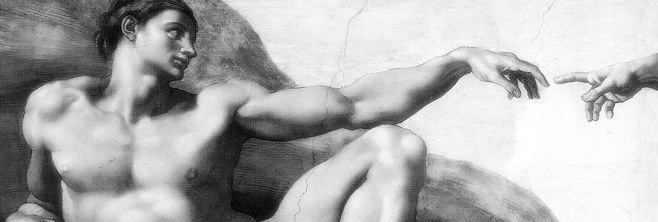Professor Gerhard Amendt: „Von Höllenhunden und Himmelwesen“ – eine Buchvorstellung
„Stell dir vor, es ist Geschlechterkampf und keiner macht mit“ heißt es auf dem Backcover von Professor Gerhard Amendts neuem Buch Von Höllenhunden und Himmelswesen. Plädoyer für eine neue Geschlechter-Debatte.
Es handelt sich meines Erachtens um ein Schlüsselwerk im Moment des historischen Umbruchs, den wir gerade erleben und den Genderama begleitet: weg von den Jahrzehnten feministischer Schwarz-Weiß-Malerei und des simpel gestrickten Weltbildes von unfähigen, aber aufgrund ihrer Bösartigkeit mächtigen Männern (Patriarchat) und den fast vollkommenen, edlen, aber unterdrückten Frauen hin zu einem Diskurs, der die Komplexität der Geschlechterbeziehungen angemessen differenziert betrachtet.
Eben weil ich Amendts Buch als eine wichtige Wegmarke bei diesem gesellschaftlichen Transformationsprozess betrachte, habe ich mich dazu entschieden, in dieser Buchvorstellung noch ausführlicher aus seinem Werk zu zitieren, als dies in meinen Besprechungen oft ohnehin der Fall ist. Viele Passagen des Buches sind aufgrund ihrer treffenden und durchdachten Formulierung für geschlechterpolitische Arbeit insgesamt zitierfähig und sie können eine argumentative Grundlage für so manche Debatte liefern. Insofern ist es sinnvoller, sie im Originaltext wiederzugeben, statt sie zu paraphrasieren und so „Amendt gefiltert durch Hoffmann“ als Präsentation solcher Schlüsselpassagen wahrzunehmen.
Im Vorwort und der Einleitung seines Werks macht Amendt zunächst einmal explizit klar, was Sinn und Zweck seines Buches ist. Demnach soll es „dazu anregen, die sich ständig ändernden Beziehungen zwischen Männern und Frauen einer viel sorgsameren Betrachtung zu unterziehen, als das zur Zeit in kokonartig abgeschotteten Zirkeln an Universitäten und Ministerialbürokratien geschieht.“ (Seite 8) Es soll „den Weg bereiten, damit Männer und Frauen aus unterschiedlichen sozialen Schichten, Berufen und Weltanschauungen ihre Konflikte verstehen und gemeinsame Lösung finden können. Es geht darum, zum gemeinsamen Verstehen und Handeln zurückzukehren.“ (Seite 9). Dieser Wunsch stellt einen roten Faden für alle folgenden Kapitel dar.
So wie viele ist Amendt über die letzten Jahrzehnte der Geschlechterdebatte, die von einem männerfeindlichen Verdammungsfeminismus geprägt waren, alles andere als glücklich (Seite 6-7):
Es ist eine bislang unbeantwortete Frage, wie sich dieses Klischee zerstörerischer Männlichkeit ohne Widerrede in modernen Gesellschaften breitmachen konnte. Womit wird dieses Bild begründet, woraus ist es hervorgegangen und warum haben vor allem die unmittelbar davon betroffenen Männer zu ihrer eigenen Abwertung bislang geschwiegen, statt lautstark dagegen aufzubegehren? Ebenso stellt sich die Frage, warum Frauen dazu ebenfalls nicht anzumerken hatten. Denn es sind die eigenen Väter, Großväter und Onkel, die vom harten Urteil, die Erde zerstört zu haben, ebenso herabgesetzt werden wie ihre Ehemänner, Partner und Brüder. Aber vor allem sind damit ihre eigenen Söhne gemeint, die sie geboren und aufgezogen haben und die sie lieben. Sie werden den Müttern als Feinde dargestellt, gegen die sie zu Felde ziehen sollen.
„Unser Feind ist meist nicht, wie im großen Krieg, der klar bestimmbare Fremde“, hatte beispielsweise Alice Schwarzer einmal formuliert, „sondern häufiger der eigene Mann: der Vater, Bruder, Geliebte, Sohn.“ Das Resultat eines über Jahrzehnte hinweg auf dieser Grundlage betriebenen feministischen Geschlechterpolitik hatte die Paar- und Traumatherapeutin Astrid von Friesen im Untertitel eines ihrer Bücher als Frustrierte Frauen und schweigende Männer zusammengefasst. Warum aber schweigen die meisten Männer gegenüber den täglich an sie gerichteten Kriegserklärungen? Das stellt auch für Amendt eine zentrale Frage dar, für die er schon zu Beginn seines Buchs eine provisorische Antwort gibt (Seite 12):
Der, dem es leichter fällt zu sprechen, verdankt das nicht allein seinen Fähigkeit, seinem Mut oder seiner Angst. Was dem einen die Sprache mehr als dem anderen verschlägt, hängt nicht zuletzt davon ab, ob die Gesellschaft solche Auseinandersetzungen fördert oder ob sie es darauf anlegt, sie zu verhindern.
Auf Seite 13 stellt Amendt dazu fest:
Wir leben in Verhältnissen, die Frauen das Reden bis hin zur leichtfertigen Beschuldigung erleichtert haben und Männern im Gegenzug das Reden erschweren, sie unbeholfen machen und Schuldgefühle unter ihnen auslösen. (…) Beides ist kommunizierenden Röhren vergleichbar. Je mehr Frauen, Massenmedien und Politik zu anklagender Beredsamkeit griffen, umso mehr ließen Männer sich einschüchtern.
Oder noch klarer formuliert:
Es geht um politische Repression, der Männer sich gebeugt haben und gegen die sie sich nicht gewehrt haben.
Beispiele solcher Repression waren und sind auf Genderama immer wieder Thema und werden auch von Amendt analysiert. Dabei verdeutlicht er, wie schizophren und widersinnig unsere Gesellschaft inzwischen mit Konflikten zwischen den Geschlechtern umgeht (Seite 14):
So haben wir zwar einerseits ein System hoch qualifizierter Professionen wie Psychotherapeuten, Berater, Psychiater etc., die helfen können, Konflikte zu lösen. Dem steht aber ein politisches System von selbsternannten Helfern gegenüber. Sie werden staatlich finanziert und arbeiten weitgehend ungestört unter der Fahne eines simplen politischen Kampfprogramms. Die Fahne trägt die naive Aufschrift: „Männer sind an allem schuld“. So stehen einander zwei konkurrierende Systeme gegenüber. Dass eine will Menschen professionell helfen, ihre Konflikte zu lösen, das andere über die Konflikte hinweggehen und stattdessen Sündenböcke finden, was die Konflikte letztlich verschärft. Die Konfliktverschärfer arbeiten mit Schuldzuweisungen, was professionelle Helfer nicht tun, weil das Lösungen unmöglich macht. Paradoxerweise werden die Konfliktverschärfer staatlich gefördert, was gänzlich im Widerspruch zur sozialstaatlichen Funktion der Konfliktbewältigung steht. Noch verheerender sind die Konsequenzen für die Wissenschaft. Weil Männer die Schuldigen seien, muss man über sie nicht sprechen. Wer schuldig sei, der verdiene es nicht, dass man über seine Sicht auf die Konflikte forscht, damit ihm professionelle Helfer gut informiert Hilfe anbieten können.
Der Ansatz, der sich weniger für eine erwachsene, reife und zielführende Bewältigung von Konflikten eignet, weil er ein einfaches Weltbild zeichnet, das mit der komplexen Wirklichkeit von Geschlechterbeziehungen nichts zu tun hat, habe sich im Gefolge der feministischen Bewegung und der von ihr betriebenen Repressionen bislang durchgesetzt. Der Feminismus, so Amendt (Seite 17-18),
schrieb Geschichte nach politischen Bedürfnissen um, ganz so, wie das in der Sowjetgesellschaften geschah (…). Das Totalitäre bezieht sich aber gerade nicht nur darauf, „alles Notwendige“ ein für allemal gesagt zu haben, sondern keine Widerrede, weder in den Medien, den Wissenschaften noch in der Politik, zu dulden. Und falls sich jemand trotzdem dazu erkühnt, dann wird er mit den Mitteln der Zensur und Manipulation entsorgt. Dazu werden abweichende Meinungen unterdrückt, demokratische Strukturen missbraucht und eine Atmosphäre der Bedrohung gegenüber Abweichlern geschaffen. Kritische Gedanken werden in Verlagen, Zeitschriften und Fernsehanstalten unterdrückt. Ob die Abweichler Männer oder Frauen sind, ist dabei unerheblich. Das gilt für die USA, für England und nicht minder für Deutschland. Wer sich dem Bild von einer zweigeteilten Welt entgegenstellte, das dadurch entstanden ist, der wurde geschmäht oder der Gewalt gegenüber Ehefrauen und Partnern geziehen und es wurde versucht, seine Karriere als Wissenschaftler zu zerstören.
(Mit dem letzten Satz spielt Amendt vor allem auf die feministische Verleumdungskampagne gegen Gewaltforscher wie Murray Straus, Richard Gelles und Susanne Steinmetz an, nachdem diese Wissenschaftler zu den ersten gehörten, die eine Gleichverteilung der Täterschaft bei häuslicher Gewalt feststellten.)
Dabei hält Amendt wenig davon, sich Parolen wie „DEN Feminismus gibt es nicht“ zu beugen, die diese Ideologie gegen Kritik immun machen sollen:
Der Feminismus kannte zwar viele Erscheinungen, und nur wenige davon waren demokratiefeindlich oder militant antisemitisch und nicht alle verfolgten Männer mit ihrem schlecht kaschierten Hass. Aber es ist wenig sinnvoll und deshalb wird darauf verzichtet, zwischen einem kultivierten und einem unkultivierten Feminismus zu unterscheiden, einem der ersten, zweiten oder dritten Welle, einem sexpositiven, einem gleichheitsrechtlichen, genderideologischen oder einem milderen, bärbeißig fast schon amüsanten, einem garstig totalitären oder einem Mehrheitsfeminismus, einem transphobischen Feminismus, einem Allmachstsfeminismus, einem Transfeminismus, einem apokalyptischen Opferfeminismus von Eckhard Fuhr, Pseudofeminismus, einem Fleischmarktfeminismus der Laurie Penny oder einem von diesem Autor wahrgenommenen Verdammungsfeminismus, der Zeichen der verzückten Selbstverliebtheit darin erkennt, lustvoll ein Opfer sein zu wollen und diesen Status eisern zu verteidigen.
An dieser Stelle weicht meine Haltung minimal von der Professor Amendts ab. Ich halte eine Unterscheidung zwischen dem Radikalfeminismus des Mainstreams und dem Equity-Feminismus, der sich auch der Diskriminierung von Männern zuwendet und beispielsweise von Wendy McElroy und Christina Hoff Sommers vertreten wird, durchaus für sinnvoll. Allerdings lässt sich gegen meine Einstellung leicht einwenden, dass Equityfeministinnen als Abweichlerinnen der gängigen Lehre kaum ein Promille aller Feministinnen insgesamt darstellen, weshalb eine Ideologiekritik hier nicht zwingend differenzieren müsse. Die Leitlinie der feministischen Bewegung fasst Amendt in dem Kapitel „So viel Schmutz und Verschmutzung zwischen den Geschlechtern war nie“ (ein Zitat aus einem „Zeit“-Artikel) folgendermaßen zusammen (Seite 24):
Männern wird versucht, facettenreich einzureden, dass sie schon immer Täter gewesen seien und sich daran auch nichts ändern wird – einmal Täter, immer Täter, einmal Opfer, immer Opfer. Obwohl sich die meisten Männer darüber nur wundern können, gipfelt darin im Großen und Ganzen der jüngere Blick auf die Geschichte von Männern und Frauen.
Realitätstauglich sei diese Propaganda nicht (Seite 27):
Das Zerrbild sowohl von Frauen als auch von Männern hat nichts mit realen Menschen zu tun. Vielmehr entspringt es Wunschbildern, Projektion aus einer polarisierten Vorstellungswelt, die Zwangsvorstellungen einzelner feministischer Aktivisten entspringen, die diese mit sich herumschleppen.
Wenn allerdings genügend Menschen eine Zwangsvorstellung teilen, dann kann daraus unter günstigen Umständen eine politisch verwendete Pseudowissenschaft entstehen (Seite 29):
In westlichen Gesellschaften hat die Forschung ein übersichtliches Gebäude von Beweismaterialen angehäuft, das Männer beschämen und Schuldgefühle über ihre Untaten zum Blühen bringen soll. Diese Forschung hat sich in ein selbstgewähltes Getto begeben, das die eigene Forschung nicht der Kritik der etablierten Wissenschaften aussetzen will. Vielmehr soll die Vorstellung von „Männern“ erschüttert werden, dass sie je die zuverlässigen Versorger von Frauen und Kindern gewesen seien.
Amendt führt dazu weiter aus (Seite 50):
Mit dieser Trivialisierung hat der Feminismus sich die Fähigkeiten zum ambivalenten Denken verstellt. Er hat sich damit der Isolation verdammt. Nach dieser Trivialisierung konnte seine Weltsicht in zwei Pole zerfallen: hassende Männer und gehasste Frauen. Dies brachte die erstarrte Feindseligkeit im Denken und Handeln hervor. Die einen verkörpern das absolut Böse und die anderen das absolut Gute. Gestützt wurde solche Hybris von Margarete Mitscherlich, die im Jahr 1987 Frauen zur „biologischen Inkarnation einer besseren Menschheitsperspektive“ erklärte. Eine gedankliche Nähe zu rassischer Überlegenheit war unverkennbar. Damit wurde alles Männliche zum Unwert erklärt. Die Entstehung einer misandrischen Kultur konnte voranschreiten.
Während Amendt klar ist, dass der Feminismus im Laufe der letzten Jahrzehnte in den staatlichen Institutionen angekommen ist und sich dort nun vor jeder Kritik, ja jeder offenen Debatte verschanzt, beobachtet Amendt auch, dass gerade weil sich diese Ideologie damit in eine selbstgewählte Quarantäne begibt, sie endgültig auf einer intellektuellen Schwundstufe angekommen ist und, was ihre intellektuelle Kraft angeht, auf dem letzten Loch pfeift. Gerade das immer wildere Um-sich-Schlagen von FeministInnen gegen die Männer im allgemeinen und die Männerrechtsbewegung im besonderen lege diesen Zustand bloß (Seiten 60-62):
Zum einen beobachten wir die Abrechnung der Journalistin Bascha Mika mit der Generation der jungen Frauen, die am Feminismus desinteressiert sind. Amerikanische Universitäten schließen wegen mangelnder Nachfrage reihenweise Genderkurse. (…) Ein Prozess der Desillusionierung ist ebenso am Werk, wenn kritische Äußerungen zum Feminismus als „populistisch, misogyn und rechtsradikal und homophob“ geschmäht werden. Beispiele dafür liefern die Ebertstiftung der SPD oder die Gunda-Werner-Stiftung der Grünen/Bündnis 90, die in Kooperation mit Genderlehrstühlen und „pro-feministischen“ Männern wie dem „Bundesforum für Männer“ die Marginalisierung aufzuhalten versuchen. (…) Feministische Zirkel, die von Fall zu Fall für hilfreiche Argumente mobilisiert werden konnten, sind weggebrochen. Und die Sonderbehandlungen von Frauen in Unternehmen, Verwaltungen, Massenmedien, Schulen und Universitäten führen zunehmend zu Konflikten unter den Peers und innerhalb der Institutionen.
(…) Jene Rechtfertigungen, die in den vergangenen 20 Jahren den Opfermythos als „essentialistische Seinsbestimmung“ von Frauen festzuschreiben schienen, haben zwar ein buntes Arrangement von Sonderregelungen und Sondereinrichtungen für Frauen und Mädchen entstehen lassen, allerdings wird deren Fortschreibung zusehends prekärer. Nicht nur werden Zweifel an den vorgebrachten Begründungen laut, sondern Menschen hegen auch zusehends Zweifel an den Opfergemälden in den Medien. Ökonomische Probleme werden für immer mehr Menschen bedrohlicher, sodass das willkürliche Zuweisen eines Opferstatus in Zeiten von schweren sozialen Konflikten als irritierend erlebt wird. Ebenso brechen schuldzuweisende Argumente weg, mit denen Männer als ein Kollektiv von „Tätern“ beschrieben wurden. Was unwidersprochen über mehr als zwei Jahrzehnte Bestand hatte und von Kritik geschützt schien, stellt sich in einer um sich greifenden Aufklärung als wahrheitswidrig oder manipulierte Forschung heraus. Auch schwindet die Angst vor den aggressiven Repräsentanten des „Freund-Feindverhältnisses“ in der Öffentlichkeit, den Medien und ganz besonders den Universitäten. Das erleichtert die Kritik ihrer Zahlenwerte erheblich. Am überlieferten Drohcharakter feministischer Politik hat sich allerdings nichts geändert. Er nimmt sogar zu, je mehr sich die alten Argumente als unhaltbar herausstellen. Beispielhaft dafür sind die Aufrufe von 2010 und 2012, die die Männerkongresse an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf verhindern wollten und Referenten wie Veranstalter bedrohten. Die männliche Perspektive der Geschlechterarrangements sollte nicht erörtert werden, damit die Mythen nicht mit kritischer Forschung konfrontiert werden können.
Der Widerlegung beliebter feministischer Mythen, von häuslicher Gewalt als Verkörperung patriarchaler Männergewalt über die Behinderung der braven Mädchen durch böse Buben in der Schule bis hin zur vermeintlichen Gehaltsdiskriminierung von Frauen ist ein weiteres Kapitel von Amendts Buch gewidmet. Langjährigen Männerrechtlern und Forschern, die sich intensiv mit diesem Bereich beschäftigt haben, wird dieses Kapitel wenig Neues sagen, aber thematisch unkundigen Lesern muss natürlich erst einmal erklärt werden, warum das, was sie ständig in den Medien hören, bei näherer Überprüfung nicht stichhaltig ist. Auf die erwähnten Männerrechtsvereine und deren Umfeld geht Amendt übrigens auch kurz ein, wobei er exemplarisch MANNdat, AGENS, pappa.com und den Väteraufbruch erwähnt (Seite 64):
Es gibt zwar solidarische Hilfe für Männer, aber sie beruht, im Gegensatz zu den staatlichen Hilfen für Frauen, auf Eigeninitiative und Selbstorganisation. Sie ist NGOs vergleichbar, die Interessen thematisieren, die gesellschaftspolitisch im System der etablierten Parteien nicht aufgenommen werden.
Im folgenden Kapitel beschäftigt sich Amendt mit Sonderrechten für Frauen, die ansonsten gängige Gesetze und moralische Richtlinien außer Kraft setzen. In einem Exkurs kommt er sodann auf die Situation an amerikanischen Universitäten zu sprechen, die auch auf Genderama schon mehrfach Thema war (Seite 116):
Peter Berkowitz beschreibt das mit geharnischter Kritik (…) als Zerfall der demokratischen Kultur und der institutionalisierten Schuldzuweisung an junge Männer. Er weist auf das Schweigen der Wissenschaftler hin, die eine McCarthyartige Atmosphäre der Verfolger der 1950er-Jahre von jungen Männern begünstigen.
(Die Parallelen zwischen dem jetzigen repressiven Meinungsklima und der Zeit unter McCarthy sind in der Tat für jeden offensichtlich, der sich näher mit beiden Phasen der amerikanischen Geschichte beschäftigt hat. Nicht ohne Grund habe ich meine Serie von männerpolitischen Interviews im Frühling 2012 jeweils mit dem Abschiedsgruß „Gute Nacht und viel Glück!“ beendet.)
Im folgenden Teil des Buches geht Amendt dazu über, gegen diese Analyse einer verheerenden Vergangenheit und Gegenwart seine Vorstellung einer konstruktiveren Zukunft zwischen den Geschlechtern zu setzen. Dazu führt er beispielsweise, was häusliche Gewalt angeht, näher aus (Seiten 146-147):
Wir brauchen keine Frauenhäuser. Aber ebenso wenig brauchen wir Männerhäuser für geschlagene Männer und Jungen. Was wir brauchen, ist ein Netz von Beratungsstellen für Familien mit Gewaltsproblemen. Denn Gewalt in Familien hat systemischen Charakter. Wenn eine Frau ihren Mann und ein Mann seine Frau schlägt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie auch ihre Kinder schlagen. Was wir brauchen, sind gut ausgebildete Männer und Frauen in Familienberatungsstellen, die familienbezogen kooperieren und berufsethische Standards praktizieren, die in gewalttätigen Familienkrisen unmittelbar intervenieren und in Notfällen Männern wie Frauen mit Kindern vorübergehend sicheren Aufenthalt bieten. Wir brauchen Familienberatungsstellen, die in den Zyklus der Weitergabe von Gewalt am Ort seiner Entstehung eingreifen können. Eine Öffentlichkeit, die entsetzt über Kinderleichen ist, über desinteressierte Jugendämter und Mordaktionen an Schulen erstarrt, sollte wohlfahrtstaatliche Finanzierung von Einrichtungen nur akzeptieren, wenn sichergestellt ist, dass Ratsuchende professionelle Hilfe erhalten. Beratung und Therapie sind nun einmal von politischen Ideologien freizuhalten. Anders ist das nur totalitären Gesellschaften und eben in Frauenhäusern. Einerseits brauchen wir einen Diskurs an Universitäten und Fachhochschulen, der das von der political correctness etablierte Denkverbot über frauenhäuslerische Gewaltideologien mit den Erkenntnissen der internationalen Forschung konfrontiert. Andererseits brauchen wir eine Atmosphäre, die es Männern erleichtert, auf eigene Gewalterfahrungen zuzugreifen.
Mit seinem Plädoyer dafür, Frauenhäuser in der bestehenden Form abzuschaffen, erntete Amendt in den vergangenen Jahren bekanntlich einigen Unmut – bezeichnenderweise nicht nur von Feministinnen, die in ihre Ideologie vom weiblichen Opfergeschlecht vernarrt waren, sondern auch von so manchem Mann, der sich selbstverliebt als „neuer Mann“, als geschlechtersensibler, emanzipatorischer Mann präsentierte und Amendt als patriarchalen Unmenschen diffamieren wollte, wobei er selbst aber ironischerweise genau jene archaische Männlichkeit verkörpert, die in der Gestalt des starken, weißen Ritters der schwachen, unschuldig bedrohten Frau zu Hilfe eilen möchte. Amendt macht auf diesen Widerspruch zwischen Selbstinszenierung und Handeln aufmerksam (Seite 147-148):
Dem Paternalismus wurde die Basis durch den Hinweis auf eine symmetrisch verteilte Gewaltbereitschaft in partnerschaftlichen Beziehungen entzogen. Weil viele Männer sich nicht eingestehen können, dass genauso viele Männer wie Frauen geschlagen werden, haben sie begonnen, die Gewaltlosigkeit der Frauen zu verteidigen. Indirekt machten sie sich stark dafür, dass nur Männer schlagen. Besonders auffällig war das in der „Männerarbeit der Evangelischen Kirche Deutschland“, die auf Leitungsebene ein ausgeprägt traditionelles Männlichkeitsverständnis vertritt, das den Mann als wachsamen Beschützer auch des guten Rufs von Frauen auftreten lässt. Auf die Kritik an meinem Essay in Die Welt habe ich deshalb den Geschäftsführer der EKD, Martin Rosowski, am 19. November 2009 in einem Offenen Brief geantwortet.
(Wenn Amendt hier kritisiert, dass es gerade das durch Roswoski & Co. verkörperte überholte Männerideal ist, das einer zukunftsweisenden Männerpolitik und einer realistischen Sicht auf Geschlechterbeziehungen im Wege steht, befindet er sich natürlich in Übereinstimmung mit derselben Kritik, die vom linken Maskulismus unter anderem auf Genderama vertreten wird.)
Im letzten Kapitel seines Buches, „Wie soll das alles weitergehen“, kommt Amendt auf die hämische Schadenfreude zu sprechen, die viele feministisch gegen Männer positionierte Frauen gegenwärtig zur Schau tragen (siehe etwa diese Erwiderung Birgit Kelles auf die hämischen Triumphgesänge Silke Burmesters auf Spiegel-Online). Amendt erklärt hierzu (Seiten 184-186):
Da diese Betrachtungsweise sich in Bereichen der Gesellschaft wie Pädagogik, linken Parteien, Medien und Teilen der Sozialwissenschaften durchgesetzt hat, werden persönliche Erfolge von Frauen durch Bildung und Anstrengung nicht gefeiert, sondern als Sieg über den Feind – nämlich das andere Geschlecht – empfunden. Statt ihnen Anerkennung für ihre Erfolge zu zollen, hat sich ein gehässiger Triumphalismus breitgemacht, der die Vorstellung genießt, Männern etwas weggenommen, ihnen eins ausgewischt zu haben, besser als sie zu sein. Oder sie fantasieren sogar das „Ende des Mannes“, dem die Erlösung durch die Frauen folgt. Mit dem Gefühl des Triumphalismus über den „Mann“ berauben sie sich des Genusses an erfolgreichen eigenen Anstrengungen. Aber nicht nur das. Sie verzichten auf den Blick auf die Konflikte, die die Gesellschaft lösen muss. So wird der „feministisch gleichstellungspolitische Triumphalismus“, der sich über belanglose narzisstische Kleinigkeiten freut, zu einem erheblichen Hindernis für Männer wie Frauen, an gemeinsamen Lösungen zu arbeiten. Der Triumphalismus genügt sich stattdessen mit Befriedigungen des Augenblicks und steht den langen Perspektiven sinnvoller Umgestaltungen im Wege, zumal narzisstische Befriedigungen ein äußerst kurzes Verfallsdatum haben. Darüber hinaus entkoppeln sich die Triumphalismusabhängigen von den entscheidenden Versuchen, gesellschaftliche Probleme zu verstehen. Sie geraten ins narzisstische Abseits, weil sie das Persönliche nach dem anatomischen Geschlecht denken.
Amendt argumentiert weiter:
Noch durchzieht der eigentümliche Triumphalismus wesentliche Bereiche der Geschlechterdebatte. Er leistet keinen Beitrag zur Modernisierung der Arrangements, weil er anstelle anspruchsvoller gemeinsamer Debatten unter Männern allenfalls Schamgefühl und Verärgerung ausgelöst. Denn Triumphalismus ist immer das Siegesgeheul über einen anderen. Erfahrungsgemäß sind Schamgefühle aber lähmend und lassen den Beschämten eher im Erdboden versinken als dass sie ihn zu klugen Lösungen und zum gemeinsamen Gespräch erheben. Triumphalismus der Frauen entspricht den Schuld- und Beschämungsgefühlen unter Männern, vorausgesetzt, sie lassen den Beschämungsversuch nicht an sich abperlen. Beides beschreibt den Zustand, den es überwinden gilt. Triumphieren, um zu bestimmen, blockiert Männer wie Frauen.
Zum Ende seines Buches (Seiten 192-193) gelangt Amendt zu folgendem Fazit:
In dem Maße, wie die abwertenden Mythen über Männer an Glaubwürdigkeit einbüßen, verliert die Manipulation des öffentlichen Bewusstseins an Kraft. Aber ebenso muss die nicht minder weit verbreitete Idealisierung der Frauen als Superfrauen, Alleskönner und Menschheitserlöser durch ein realistisches Bild ihrer Möglichkeiten ersetzt werden. Diese Wende hat in den USA bereits eingesetzt. Sie lässt sich nur gemeinsam erreichen (…) Dem Polarisierenden muss ein Ende gesetzt werden, das in die Erziehung außerhalb der Familie, angefangen vom Kindergarten über die Schulen bis in die Universitäten eingesickert ist. Erst dann werden sich nach vielen Jahren erstmals wieder die Chancen erweitern, mit den Problemen im Alltag wie partnerschaftlicher Gewalt, konfliktreichen Scheidungen, Jungendiskriminierung und den Unterschieden auf dem Arbeitsmarkt konfliktlösend und versöhnend umzugehen.
Professor Gerhard Amendts Buch stellt ein wichtiges Signal für diesen Aufbruch hin zu einer konstruktiveren Geschlechterdebatte dar. Es kann jedem ans Herz gelegt werden, der die Unkultur einseitiger oder auch gegenseitiger Schuldzuweisungen zwischen Frauen und Männern überwinden und gemeinsame Arbeit an den beide Geschlechter verbindenen Herausforderungen und Problemen an deren Stelle setzen möchte.
Die Rezension erschien zuerst auf Genderama.