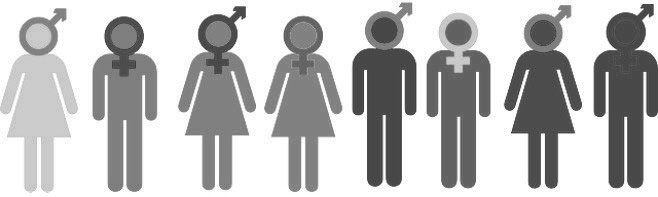Fördert endlich die Jungen!
Ein Sammelband beschäftigt sich mit der Frage, ob wir eine Männerquote in Kitas und Schulen brauchen, anstatt endlich ideologiefreie Konzepte zur Jungenförderung zu entwickeln.
Seit Jahren stagnieren die schulischen Leistungen von Jungen. Sie haben im Schnitt schlechtere Noten als Mädchen, brechen die Schule wesentlich häufiger ab. Die Mehrzahl der Abiturienten und Studenten sind weiblichen Geschlechts. Die Bildungsnachteile von Jungen werden von einigen Pädagogen auf den hohen Anteil von Frauen in Kinderkrippen, Kindertagesstätten, Kindergärten und Grundschulen zurückgeführt. Es ist allerdings umstritten, ob die hohe Repräsentanz von Frauen in erzieherischen Berufen die besagten Nachteile verursacht.
Lässt sich die Frage positiv beantworten, so scheint die Forderung nach einer Erhöhung des Männeranteils in dem genannten Berufsfeld berechtigt zu sein. Daran würde sich wiederum die Frage anschließen, auf welche Weise die Erhöhung des Männeranteils erreicht werden könnte. Die Einführung einer Männerquote wäre eine denkbare Lösung.
In dem von Klaus Hurrelmann und Tanjev Schultz herausgegebenen Sammelband „Jungen als Bildungsverlierer: Brauchen wir eine Männerquote in Kitas und Schulen?“ argumentieren Pädagogen, Soziologen, Psychologen und Journalisten für und gegen eine Männerquote in Kitas und Schulen.
Betrachten wir zunächst die Argumente der Quotenbefürworter. Auffallend ist, dass viele Quotenbefürworter die Forderung nach einer Männerquote in erzieherischen Berufen mit der Forderung nach einer Frauenquote in Führungspositionen von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft verbinden. Da eine Frauenquote in prestigeträchtigen Arbeitsbereichen ihrer Meinung nach gut sei, wäre auch eine Männerquote in Kitas und Schulen erstrebenswert. Somit instrumentalisieren sie die Debatte zu Bildungsnachteilen von Jungen.
Die Argumente, die für eine Frauenquote in prestigeträchtigen Bereichen vorgebracht werden, sollen auch zur Einführung einer Männerquote im erzieherischen Bereich gelten. So schreibt Hurrelmann der herrschenden Ideologie folgend: „Bekanntlich verbessert sich in Betrieben und Behörden das Betriebsklima, wenn in der Belegschaft die Dominanz eines Geschlechts zurückgedrängt wird.“ „Die Erhöhung des Anteils des ´Minderheits-Geschlechts` zahlt sich für ein Unternehmen aus.“ „Genauso ist es bei den zwar nicht gewinn- aber doch ergebnisorientierten öffentlichen Dienstleistungseinrichtungen von der Kinderkrippe bis zur weiterführenden Schule.“ (S. 61)
Und in einer kaum zu überbietenden Naivität, die in einem wissenschaftlichen Sammelband eigentlich nichts zu suchen hat, schreibt Jeanne Rubner: „Es ist ungut, wenn Teile der Gesellschaft oder des Arbeitsmarktes von einem Geschlecht dominiert werden. So wie Manager nicht alle männlich sein müssen, brauchen Lehrer nicht alle weiblich zu sein.“ (S. 75) Die Vorstellungen von Hurrelmann und Rubner werden durch empirische Studien von Kenneth R. Ahrn und Amy K. Dittmar, Øyvind Bøhren und Øyvind Strøm sowie Antje Buche u.a. widerlegt. Diese Studien weisen nach, dass die Erhöhung des Frauenanteils im Management viele negative Folgen für die Unternehmen hat.
Auch in dem Artikel von Michael Cremers und Jens Krabel fehlt es nicht an dem obligatorischen Lobgesang auf eine Frauenquote für prestigeträchtige Positionen. Beide sprechen sich auch für eine Männerquote in Care-Bereichen aus. Diskursideologisch bringen sie ihre Vision einer Quotengesellschaft folgendermaßen auf den Punkt: „Die Frauenquote auf der Leitungsebene sollte mit der Männerquote im Care-Bereich diskursiv verknüpft werden.“ (S. 91)
Ihre Argumentation ist umso grotesker, als sie einen kapitalismuskritischen Ansatz vertreten: Einerseits lehnen sie den „vorherrschenden Ökonomismus“ und „Wachstumsfetischismus“ ab, andererseits sprechen sie sich für eine Frauenquote in den Vorständen von Unternehmen, also in den Zentren des Kapitalismus, aus. Sie plädieren somit für eine Quote, von der ca. 200 Frauen aus oberen Schichten profitieren würden. Sie möchten auf der anderen Seite eine Männerquote in Care-Bereichen einführen, weil die unbezahlte Sorgearbeit ein Armutsrisiko für Frauen darstellt. Diese Quote soll demnach nicht für Jungen und Männer gut sein, sondern Frauen entlasten und ihre Lebenssituation verbessern.
Einige Autoren (Hurrelmann, Cremers, Krabel) möchten traditionelle Rollenbilder von Jungen aufheben und ihnen dazu Alternativen anbieten. Nach Hurrelmann sollten junge Männer darin trainiert werden, „´feminine` Anteile in ihrem Verhalten zuzulassen“ (S. 60). Das stellt ein wichtiges Ziel der Jungen- und Männerförderung im pädagogischen Bereich dar. Wie dieses Ziel jedoch mit der von Hurrelmann geforderten Männerquote erreicht werden kann, bleibt nicht geklärt.
Den Jungen sollen bestimmte Geschlechterrollen vermittelt werden, Geschlechterrollen, denen traditionell Frauen folgen bzw. die als „feminin“ bzw. „weiblich“ gelten. Was für Mädchen und Frauen abgelehnt wird (die Befolgung von traditionellen, als „weiblich“ geltenden Rollenbildern), wird für Jungen und Männer propagiert. Das ist nicht der einzige Widerspruch, in den sich die Quotenbefürworter verstricken.
Ein weiterer Widerspruch besteht darin, dass sie sich einerseits für „Heterogenität“, „individuelle Förderung von Schülern“ aussprechen, andererseits aber in den Genderismus zurückfallen, indem sie nach „spezifischen Bedürfnissen von Jungen und Mädchen“ fragen (Katja Irle). Sie schwadronieren einerseits über den „individuum- und subjektzentrierten Unterricht“, sprechen aber andererseits von einem „geschlechtersensiblen Blick“ und setzen sich für weitreichende Geschlechterquotierungen ein (Cremers/Krabel).
Charakteristisch für die Quotenbefürworter ist der tief in ihrem Denken sitzende Paternalismus. Katja Irle zitiert in ihrem Artikel Pia Friis: „Wir brauchen den Musiker, den Philosophen, den Poeten, wir brauchen den spielerischen und emphatischen Mann. Der ´Pfadfinder` sollte nicht das einzige Modell von Männlichkeit sein.“ (S. 25). „Wir“ – das ist hier der Staat in Gestalt des Bildungssystems, der von oben Einfluss auf die Berufswahl von jungen Männern nehmen soll. Auch für Cremers/Krabel scheint es selbstverständlich zu sein, dass der Staat von oben alles regelt und als Quotenverteiler- und regulierer agiert.
Eine besondere Rolle spielen für einige Quotenbefürworter psychoanalytische Modelle. Frank Dammasch hebt hervor: „Dem männlichen Pädagogen kommt häufig die Funktion zu, die väterlich-männliche Position ersatzweise für den nur unzureichend präsenten Familienvater einzunehmen.“ (S. 187) Jungen brauchen männliche Identifikationsfiguren, um sich u.a. von der Mutterbindung zu lösen. Die Anwesenheit von Männern in Kitas eröffnet einen „ödipalen Kosmos“, der die Phantasiewelt von Jungen und Mädchen erweitern soll.
Die Quotengegnerin Gisela Steins betont hingegen, dass hier eine psychoanalytische Sozialisationstheorie als wahr angenommen und mit Bildungserfolg verbunden wird. Es ist nicht berechtigt, Mechanismen der familiären Eltern-Kind-Beziehung auf die Lehrer-Schüler-Beziehung zu übertragen. Während im familiären Bereich „die besondere Nähe zum eigenen Kind, spontane Kommunikationsweise und intuitives Einfühlungsvermögen“ gefragt sind, sind es im professionell-erzieherischen Bereich „ein breites Fachwissen und professionell geschultes Kommunikations- und Einfühlungsvermögen“ (S. 266/267).
Holger Brandes vertritt sogar die These, dass die Kommunikation zwischen Kleinkind und Eltern auf einer von Geschlecht weitgehend unabhängigen Grundlage stattfindet. Wichtiger als das Geschlecht sind Empathie und Feinfühligkeit der Eltern gegenüber dem Kind.
Die meisten Quotengegner sind sich darin einig, dass im Unterricht das Geschlecht der Lehrkräfte keine wesentliche Rolle spielt. Einer britischen Studie zufolge ist es Schülern und Schülerinnen egal, welchem Geschlecht die sie unterrichteten Lehrkräfte angehören (die Studie wird in dem Artikel von Robert Baar u.a. zitiert). Sie erwarten von ihren Lehrkräften in erster Linie „geschlechtsneutrale Qualitäten“. Als „gut“ werden von ihnen die Lehrkräfte bezeichnet, die gerecht sind und Lerninhalte gut vermitteln können. Dementsprechend sollte in einer individualistischen Gesellschaft die Förderung von Jugendlichen geschlechtsunabhängig sein (Steins).
Für die Quotengegnerin Heike Diefenbach ist die Debatte um eine Männerquote in erzieherischen Berufen von vornherein verfehlt, denn man geht in ihr davon aus, dass es die Jungen bzw. die Männer und die Mädchen bzw. die Frauen als homogene, „quasi-natürliche Interessengruppen“ gibt, die in einem antagonistischen Verhältnis zueinander stehen.
Es gibt zwar einen „positiven Zusammenhang“ zwischen den Schulerfolgen von Jungen und dem Unterricht durch männliche Lehrer. Warum dies so ist, bleibt jedoch auf dem heutigen Stand der Forschung nicht erklärt, weshalb alle Forderungen, die sich auf diesen Zusammenhang berufen, einen blinden, ideologisch motivierten Aktionismus darstellen.
Entscheidend ist für Diefenbach, dass man mit der Einführung einer Männerquote im erzieherischen Bereich – oder irgendeiner anderen Quote – die Individualrechte zugunsten von Gruppenrechten aufheben würde. Das hätte wiederum zur Folge, dass man gesellschaftlich wertvolle Güter, zu denen auch „Bildung“ gehört, nach leistungsfremden und individuell nicht attributierten Kriterien (Geschlecht) verteilen würde. Alle Quoten setzen das Leistungsprinzip und das Prinzip der Bestenauslese außer Kraft.
Ähnlich argumentiert Josef Christian Aigner: In allen Bereichen, in denen es um Qualität und Qualifikation geht, ist eine Quote nicht sinnvoll. Sie ist überdies rechtlich unzulässig, denn besser qualifizierte Bewerber würden bei Anwendung der Quote nicht die Stellen erhalten, die sie eigentlich erhalten sollten. Daher ist die Forderung nach einer Männerquote in Kitas und Schulen abzulehnen.
Trotzdem sind sich einige der Quotengegner darin einig, dass die Forderung nach mehr Männern in erzieherischen Berufen durchaus als sinnvoll erachtet werden kann (Aigner, Tim Rohrmann, Brandes). Aigner macht daher einige Vorschläge, wie die Anzahl von Männern in dem genannten Bereich erhöht werden könnte. An erster Stelle wäre der „Abbau männerentwertender Haltungen“ zu nennen. Als Folge der Dämonisierung von Männern besteht der generelle Verdacht, Männer würden zu sexuellen Übergriffen auf Kinder neigen. Notwendig ist es daher aufzuklären, wie selten es zu sexuellen Übergriffen von Erziehern auf Kinder kommt. Dabei sollen auch „positive Vater- und Männerbilder“ als Kontrast zur Dämonisierung des Mannes verbreitet werden.
Aigner nennt noch weitere Maßnahmen zur Erhöhung des Männeranteils: umfangreiche Berufsinformation, Aufwertung erzieherischer Arbeit, gezielte Kampagnen und Ermöglichung von Quereinstiegen.
Zusammenfassend kann Folgendes festgehalten werden: Die Debatte um eine Männerquote ist von nicht gesicherten Erkenntnissen, ideologischen Annahmen und Instrumentalisierungen geprägt. Solange der Zusammenhang zwischen den Schulerfolgen von Jungen und dem Unterricht durch männliche Lehrkräfte nicht erklärt ist, wäre die Einführung einer Männerquote nicht angebracht. Statt über eine Männerquote in Kitas und Schulen zu diskutieren, sollten endlich ideologiefreie, nicht auf Umerziehung, sondern auf Verbesserung von schulischen Leistungen ausgerichtete Konzepte zur Jungenförderung entwickelt und so schnell wie möglich praktisch umgesetzt werden. Nur auf diese Weise könnten die bestehenden Bildungsnachteile von Jungen beseitigt werden.
Klaus Hurrelmann/Tanjev Schultz (Hrsg.), Jungen als Bildungsverlierer: Brauchen wir eine Männerquote in Kitas und Schulen? Beltz Juventa Verlag, Weinheim Basel 2012.
Ich studierte Philosophie, Soziologie und Sprachwissenschaften.
Meine Doktorarbeit schrieb ich über den Begriff der Lebenswelt.
Ich stehe in der Tradition des Humanismus und der Philosophie der Aufklärung. Ich beschäftige mich vorwiegend mit den Themen "Menschenrechte", "Gerechtigkeit", "Gleichberechtigung" und "Demokratie".
In meinen Büchern lege ich besonderen Wert auf Klarheit und Verständlichkeit der Darstellung. Dabei folge ich dem folgenden Motto des Philosophen Karl Raimund Popper: „Wer’s nicht einfach und klar sagen kann, der soll schweigen und weiterarbeiten, bis er’s klar sagen kann“.