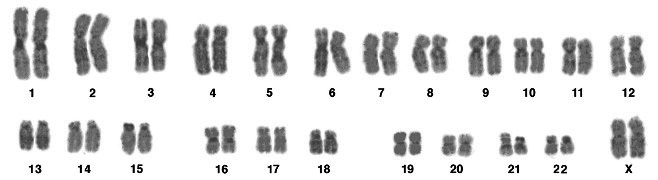Vom praktischen Wert der Männertränen (Wozu ist Männerhass eigentlich gut? Teil 2)
Möglicherweise klingt es übertrieben, über Männerhass zu schreiben – anstatt über Wut, über Ressentiments, über Vorurteile, also über irgend etwas weniger Dramatisches und Plakatives.
Es ist nicht übertrieben. Und natürlich wollte ich diesen Text auch mit vielen Belegen dafür versehen. Ich habe dann aber so viele gefunden, dass sie den Umfang gesprengt hätten und ich eine Auswahl in eine kleine Materialsammlung ausgelagert habe, die ich gleichzeitig veröffentliche.
Natürlich geht es dabei nicht um die Behauptung, dass alle Frauen Männer hassen würden – die wäre ebenso ressentimentgeladen wie die Unterstellung, alle Männer würden Frauen hassen. Und natürlich gibt es auch einen Männerhass von Männern selbst, beispielsweise den Hass auf Homosexuelle. Dass er hier nicht das Thema ist, leugnet ihn nicht.
Ich unterstelle auch nicht, dass alle Feministinnen Männer hassen würden. Allerdings geht es mir darum, dass der Hass offenkundig ein integraler Bestandteil des Feminismus war und ist. Wenn Emma Watson sich in der im ersten Teil zitierten Rede gegen diese Feststellung verwahrt und sich dabei auf eine realitätsferne Lexikondefinition zurückzieht, ist das zu wenig.
Nach Watson ist es höchste Zeit, dass Menschen aufhören, Feminismus mit Männerhass zu assoziieren. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist höchste Zeit, dass seine Vertreterinnen und Vertreter sich ehrlich damit auseinandersetzen, wie bedeutend der Hass in all seiner Destruktivtät und Niedrigkeit für den Feminismus war und ist.
Sollte ein humaner Feminismus möglich sein, dann nur auf diesem Weg. Billiger ist er nicht zu haben.
„Hass ist nur da mies, wo er grundlos oder fehlgeleitet ist. (…) Wer den Hass abschaffen will, muss die Gründe zum Hass abschaffen! Wer etwas gegen Männerhass hat, muss gegen die Frauenunterdrückung kämpfen!“
Wer wie Alice Schwarzer hier den miesen und grundlosen Hass vom guten Hass mit guten Gründen unterscheidet, steht dabei vor einem ernstzunehmenden Problem: Wer hasst, hat ohnehin immer das Gefühl, dass der eigene Hass begründet sei. Schließlich gehört es zum Hass, sich dessen Objekt in einer Weise vorzustellen, die ihn legitimiert – als gewalttätig, als schmutzig, verdorben, unmoralisch, als herrschsüchtig, als gefährlich, und natürlich selbst als hasserfüllt.
Gerade die Unterstellung, dass die Objekte des Hasses Herrscher – Weltherrscher, Weltverschwörer, Hegemone – wären, erfüllt dabei eine zentrale Funktion. Wer herrscht, braucht schließlich kein Mitgefühl und keine Rechte, weil er sich ja ohnehin beschaffen kann, was er will. Die Vorstellung des Feindes als Herrscher schließt die eigenen Reihen zum angeblich so dringenden Widerstand zusammen – sie eliminiert Selbstkritik, die ja doch dem Feind in die Hände spielen würde – und sie enthebt die Mitglieder der eigenen Gruppe moralischer Skrupel.
Es gehört daher zum politischen und sozialen Hass traditionell dazu, sich den Feind als Herrscher vorzustellen. Antisemiten fantasieren eine „jüdische Weltverschwörung“, weiße Rassisten eine Zerstörung der „weißen Rasse“ durch die Schwarzen, Fremdenfeinde sind fixiert auf die Idee der Überfremdung des eigenen Landes, Nationalisten und Kriegstreiber sind davon überzeugt, dass die feindliche Nation die eigene zumindest unterjochen, wahrscheinlich aber zerstören will.
Hass lässt sich also eben nicht durch die Idee legitimieren, dass die Objekte dieses Hasses Herrscher und Unterdrücker wären: Diese Vorstellung ist nämlich selbst traditionell ein wesentliches Element des politischen Hasses.
Ist Obdachlosigkeit eine Form der Herrschaft?
Das gewöhnliche feministische Argument gegen solche Überlegungen ist, dass Rassisten oder Antisemiten mit Phantasien und Projektionen arbeiten würden, dass aber die Rede vom „Patriarchat“, von der „Männerherrschaft“ doch unbezweifelbar durch Tatsachen gestützt sei. Schließlich ist es offenkundig, dass ein weit überwiegender Großteil der Machtpositionen in Politik und Wirtschaft von Männern besetzt ist.
Dieses Argument ist bestenfalls auf den ersten Blick haltbar. Die meisten Männer sind von Machtpositionen ebenso weit entfernt wie die meisten Frauen. Die gefährlichsten Berufe sind durchweg Männerberufe, Obdachlose sind zum weitaus größten Teil Männer, Männer sind im Schnitt dreimal häufiger als Frauen drogensüchtig, sie begehen auch dreimal so oft Selbstmord, im Sorge- und Umgangsrecht haben Männer deutlich schlechtere Chance als Frauen. Männer sterben im Schnitt sechs Jahre früher als Frauen, Jungen haben in der Schule einen deutlich schlechteren Stand als Mädchen. Allein über die öffentlichen Kassen fließen nach Berechnungen von MANNdat pro Jahr fast 92 Milliarden Euro von Männern zu Frauen. Neben einer unüberschaubaren Menge an Institutionen zur Frauen- und Mädchenförderung finden sich kaum Institutionen, die Männern oder Jungen bei spezifischen Problemen helfen würden.
Angesichts solcher Daten, die noch durch viele andere ergänzt werden könnten, ist die Rede vom „Patriarchat“ bestenfalls uninformiert, eigentlich aber zynisch und propagandistisch.
Wenn die Daten überhaupt einen gemeinsamen Schluss erlauben, dann den, dass Männer im Schnitt deutlich riskantere Leben führen als Frauen, aus welchen Gründen auch immer. Wer vom „Patriarchat“ redet, ist dann ganz auf die wenigen Männer fixiert, für die sich das Risiko auszahlt, nimmt aber wohl selbst in diesen Fällen allein den Gewinn und nicht den dafür nötigen Einsatz wahr.
Er übersieht zugleich den Großteil der Männer, für die sich das Risiko nicht auszahlt oder die ernsthaften Schaden erleiden: eine sehr traditionelle Sichtweise auf Männer, die nur sehr wenige Gewinner wahrnimmt und alle anderen ignoriert.
Wer vom „Patriarchat“ oder einer „Männerherrschaft“ redet, fantasiert also das eigene, traditionelle Männerbild in die Strukturen der Gesellschaft hinein. Eben hier ist auch die Nähe zum Rassismus, zum Antisemitismus, zur Fremdenfeindlichkeit deutlich – die Verhärtungen und Widersprüche der eigenen Position werden nicht reflektiert, nicht als Teile der eigenen Perspektive wahrgenommen, sondern als Eigenschaft der „Feinde“ bekämpft.
Als Faustregel lässt sich das wohl so ausdrücken: Politischer und sozialer Hass hat mit dem, der hasst, immer sehr viel mehr zu tun als mit dem, der gehasst wird. Der hat dann allerdings in aller Regel die Folgen dieses Hasses zu tragen.
Wie Hass sich die Realität schafft, die zu ihm passt
So lässt sich auch die Vorstellung nicht halten, dass Männerhass im Unterschied zum Fremdenhass, zum Judenhass, zum Rassenhass, auch zum Frauenhass auf einer realen sachlichen Grundlage basiere: Männer seien nun einmal, LEIDER, Vergewaltiger, Unterhaltspreller, Rabenväter, häusliche Gewalttäter etc. Das übersieht schon, dass Rassisten und Antisemiten natürlich in gleicher Weise ganz davon überzeugt sind, tatsächlich etwas über die Realität auszusagen und nicht nur Klischees zu reproduzieren.
In jedem Fall ist diese „Realität“ Resultat einer extrem selektiven Wahrnehmung – die soziale Wirklichkeit wird beständig gescannt nach Bestätigungen des eigenen Ressentiments, während die Masse der Informationen, die dem Bild widerspricht, ausgeblendet bleibt. Der Hass schafft sich die Wirklichkeit, die zu ihm passt.
Schon in den weitgehend alltäglichen Beispielen aus dem ersten Teil dieses Artikels wird das deutlich. Schrupp beispielweise formuliert zwar extrem harte Urteile über die Väterbewegung, ist aber an dieser Bewegung tatsächlich überhaupt nicht interessiert. Sie unterstellt ihr ohne Beleg unlautere Motive und verwendet diese Unterstellungen dann als Belege für ihre ohnehin immer schon feststehende Meinung.
In Maischbergers Talkshow sitzt Bräunig als Einziger nicht von Anfang an dabei, gehört nicht zur echten Gesprächsrunde dazu, sondern wird erst spät dazugebeten. Seine Meinung zu den anderen ist nicht gefragt, seine eigenen Fragen werden nicht beantwortet. An dem, was er selbst sagt, interessiert die Moderatorin nur das, was zu dem schon vorher festgelegten Motiv passt: Rabenväter, die den Staat jährlich viele Millionen kosten. Bräunig ist als Fallbeispiel dabei, nicht als Gesprächspartner – und so wird er als Repräsentant vieler Väter aufgebaut.
Im Unterschied zu den vielen Beispielen offenen Hasses, die ich in der Vorbereitung auf diesen Text gefunden und in der kleinen Auswahl zusammengefasst habe, wirkt Maischbergers Verhalten sogar noch relativ alltäglich. Möglicherweise ist aber der Hass auf Männer so sehr zu einer medialen Normalität geworden, dass er als Hass gar nicht mehr auffällt.
Beunruhigend ist es ja insbesondere, dass die in der Auswahl gesammelten Beispiele nicht etwa von anonymen Internet-Trolls stammen, aus der wilden Welt des Netzes, gegen die sich etablierte Medien gern rituell abgrenzen – sondern fast durchweg von Frauen, die sich erfolgreich in politischen und sozialen Institutionen etabliert haben.
Was wäre aber wohl geschehen, wenn einer der weltweit erfolgreichsten männlichen Journalisten per Twitter an Hunderttausende seiner Anhänger ein Bild verschickt hätte mit dem strahlend dargeboteten Spruch „Ich bade in Frauentränen“? Es ist kaum vorstellbar, dass das für ihn folgenlos geblieben wäre. Wenn ein solcher Spruch aber von Jessica Valenti gegen Männer gerichtet wird, nehmen viele die offen vorgeführte Freude am Leid anderer gar nicht als Problem wahr und ratonalisieren sie notfalls als „Ironie“.
Wie ist es aber möglich, dass eine so öffentlich vorgeführte, bittere soziale Feindschaft zur Normalität werden kann?
Natürlich spielen auch hier gewohnte Geschlechterklischees eine Rolle. Wer Frauen als grundsätzlich soziale, liebe Wesen wahrnimmt, traut ihnen keinen Hass zu – wer sie als grundsätzlich harmlose Wesen wahrnimmt, findet ihren Hass eher niedlich als beunruhigend. Wer Sprüche wie die Valentis als „Ironie“ beschreibt, blendet das reale Leid von Männern aus und baut darauf, dass richtige Männer eigentlich nicht weinen.
Wer Männerhass unproblematisch findet, bewegt sich damit ganz im Rahmen traditioneller, verhärteter Geschlechterbilder.
Das erklärt aber noch nicht, warum denn eigentlich eine solche erbitterte soziale Feindschaft so erfolgreich sein kann. Schließlich haben wir aus der Auseinandersetzung mit Ideologien der Feindschaft viel gelernt – aus der Auseinandersetzung mit Rassismus, Antisemitismus, Faschismus, Chauvinismus, Fremdenfeindlichkeit, Sexismus, auch mit dem totalitären Kommunismus.
Wir wissen, dass es fatal ist, Individuen nur noch als Teile von Gruppen wahrzunehmen und ihnen nur dann Rechte zuzusprechen – oder sie eben zu verweigern.
Wir wissen, dass es fatal ist, diese Gruppen dann auch noch moralisierend nach einfachen Schwarz-Weiß-Mustern zu ordnen: die Guten und die Bösen, die Sozialen und die Asozialen, die Friedfertigen und die Gewalttätigen, die Unterdrückten und die Herrschsüchtigen, die Zivilisierten und die Barbaren, die Vernünftigen und die Instinktgesteuerten, die Aufbauenden und die Destruktiven, die Moralischen und die Monstren, wir und die.
Wir wissen, dass es fatal ist, angesichts einer solchen Fantasie des erbitterten Krieges unterschiedlicher Gruppen allgemeine, universelle Menschenrechte oder basale gemeinsame Interessen zurückzustellen.
Und schon Schulkinder lernen, dass diese Freund-Feind-Strukturen Sündenböcke produzieren, die benutzt werden, um von der Verantwortung für reale politische Konflikte und Probleme abzulenken.
All das wissen wir, und all das spielt plötzlich keine Rolle mehr, wenn es nicht um Rassismus oder Fremdenhass, sondern um Männerhass und Feminismus geht. Dann erscheinen die primitiven Gut-Böse-Strukturen, deren Destruktivität uns doch eigentlich vollkommen bewusst ist, plötzlich als Ausweis einer progressiven, menschenfreundlichen Gesinnung. Was soll das?
Vom Bedürfnis nach Antihumanität
Humanität und Achtung der universellen Menschenrechte sind für uns Selbstverständlichkeiten. Das ist auch sinnvoll – dass Menschen als Menschen basale Rechte haben, muss so nicht wieder und wieder argumentativ begründet werden, sondern wird schlicht vorausgesetzt. Wäre es anders, dann müssten gerade die Schwächsten beständig darum fürchten, dass ihnen selbst grundlegende Rechte streitig gemacht werden.
In anderer Hinsicht aber sind Humanität und die Verpflichtung gegenüber Menschenrechten überhaupt nicht selbstverständlich – sie sind Resultat beständiger Anstrengungen.
Es gehört ja nicht nur dazu, abstrakte Regeln anzuerkennen. Eine humane Position baut auf der Bereitschaft, zur eigenen Position und zu den eigenen Interessen zumindest gedanklich Abstand nehmen zu können. Anzuerkennen, dass die Position und die Interessen anderer rational und legitim sein können.
Es gehört überhaupt die Bereitschaft dazu, sich eine Situation auch aus der Perspektive anderer vorzustellen.
Es gehört dazu, eigene Impulse zu kontrollieren, anstatt sie auszuleben und dann nachträglich zu rationalisieren.
Es gehört die Bereitschaft dazu, auf die unmittelbare Durchsetzung eigener Interessen und Überzeugungen zu verzichten und stattdessen in Gesprächen zu gemeinsamen Positionen zu kommen – eine Bereitschaft, die beispielsweise in politischen Debatten um das Sorgerecht von Lobbygruppen wie dem VAMV systematisch untergraben wird.
Tatsächlich ist eine humane Haltung, die an einer Universalität der Menschenrechte orientiert ist, mit einer erheblichen Kränkung verbunden: Ein Mensch sieht sich damit nicht als rundweg Besonderes, als Mittelpunkt der Welt, der er für sich selbst ja grundsätzlich ist – sondern als einen Menschen unter vielen, die allesamt dieselben Rechte haben wie er.
Mehr noch: Die Auseinandersetzungen um ökonomische und politische Ressourcen, die öffentliche Debatten prägen, sind mit einer antihumanen Gruppenethik wesentlich besser vereinbar als mit einer humanen Menschrechtsethik. Dabei ist natürlich nicht jedes Gruppeninteresse inhuman – inhuman aber wird es, wenn Individuen nur noch als Teile von Gruppen wahrgenommen werden und die Idee gemeinsamer Rechte keine Rolle mehr spielt.
Es ist angesichts all dessen nicht rational, davon auszugehen, dass alle oder auch nur die meisten Akteure unerschütterlich human orientiert und den Menschenrechten verpflichtet sind. Rationaler ist es, vorauszusetzen, dass es ein verbreitetes Bedürfnis nach Antihumanität gibt – danach, von den Zumutungen humaner Positionen zumindest zeitweilig befreit zu werden und so agieren zu können, als ob Rechte und Würde anderer nicht beachtet werden müssten.
Männerhass wäscht weißer
Dieses Bedürfnis aber ist natürlich gerade in solchen Milieus erheblich tabuisiert, deren Angehörige sich auf ihre eigene Bildung, ihre Aufgeklärtheit und ihre Zivilisiertheit viel zugutehalten. Wer gleichwohl antihumane Bedürfnisse befriedigen möchte, braucht etwas, das ihn von diesen Tabus erlöst. Eben hier erfüllen Männerhass und Feminismus offenbar eine wichtige Funktion.
Der Feminismus ist dabei nicht rundweg inhuman oder antihuman – auch wenn immer nur einzelne seiner Vertreterinnen, wie Wendy McElroy, Elisabeth Badinter oder Christina Hoff Sommers, in einer ausdrücklich humanen Perspektive argumentieren. Der Feminismus ist auch nicht die Ursache für Männerhass – Christoph Kucklick hat ja gezeigt, dass eine radikale Männerfeindlichkeit schon lange vor den ersten Feministinnen kulturell gepflegt wurde.
Männerhass und Feminismus erfüllen aber eine wichtige Funktion, weil sie das Bedürfnis nach Antihumanität salonfähig machen. Die bloße Behauptung, für den Schutz unterdrückter Frauen einzutreten, wirkt wie ein Persilschein – was immer auch sonst dann noch behauptet und getan wird, es dient immer irgendwie guten Zwecken und kann gar nicht ganz schlecht sein.
Zugleich können alle anderen Konfliktfelder verdeckt oder relativiert werden. Wer behauptet, dass Geschlechterkategorien „omnirelevant“ seien, der spielt eben mit der Vorstellung, in Konflikten zwischen Männern und Frauen einen gesellschaftlichen Hauptwiderspruch zu beschreiben, von dem alle anderen Widersprüche abhängig seien. Damit werden Menschen darauf reduziert, Geschlechtsinhaber zu sein.
Es ist bei alledem offensichtlich, dass eine maskulistische Gruppenethik im Prinzip mit eben denselben Gefahren verbunden ist wie eine feministische. Eine sinnvolle, humane Geschlechterpolitik muss offensichtlich zwei Grundsätze beachten – ganz gleich, ob sie von Männern oder Frauen, mit maskulistischer oder feministischer Betonung betrieben wird.
Einerseits ist die Geschlechtszugehörigkeit eines Menschen nur einer von vielen möglichen Gründen für Rechtsverletzungen oder massive Ungerechtigkeiten. Wer Menschen und ihre soziale Position vorwiegend nach ihrem Geschlecht bestimmt, schränkt ihr Menschsein maßlos ein.
Andererseits können von sexistischen Rechtsverletzungen und Benachteiligungen natürlich Männer und Frauen betroffen sein. Wer Sexismus als Benachteiligung von Frauen durch Männer definiert und männliche Benachteiligungen per definitionem ausschließt, agiert offenkundig selbst sexistisch. Andersherum, und das gilt auch für diesen Artikel: Dass es einen immensen Männerhass gibt, bedeutet natürlich nicht, dass es keinen Frauenhass gibt.
Eben in diesem Punkt übrigens sind die zitierte Rede Emma Watsons und die UN-Kampagne „HeForShe“ entschlossen inhuman. Sie spiegeln gerade damit aber eine politische Situation wieder, in der Menscherechte oberflächlich von allen Beteiligten gepriesen, tatsächlich aber zu Gunsten von Gruppeninteressen weitgehend ignoriert werden.
HeForShe, nicht etwas HeForShe-SheForHe, oder OneForAllForOne: Es ist ohnehin verrückt, wie hier eine UN-Kampagne klarstellt, dass die eine Hälfte der Menschheit für die andere da zu sein habe, nicht aber umgekehrt. Noch verrückter ist es, dass ausgerechnet eine solche Kampagne als Einsatz für Gleichberechtigung verkauft wird.
Beunruhigend ist dabei nicht, dass im politischen Feld Reden und Handeln auseinanderklaffen – damit rechnen wohl ohnehin die meisten, die sich mit Politik beschäftigen. Beunruhigend ist aber, wie offen sichtbar die Widersprüche der Kampagne sind, ohne dass das die Verantwortlichen beunruhigen müsste. Es ist, als wären wir schon ganz an ein Orwell’sches Doublespeak gewöhnt, bei dem wir das eine und gleichzeitig das andere glauben, ohne noch über unbequeme Widersprüche nachzudenken.
Auch hier immunisiert die Behauptung, etwas für den Schutz unterdrückter Frauen zu tun, die Kampagne offenbar gegen alle möglichen und naheliegenden Einwände. Dabei ist keineswegs der Wunsch problematisch, sich für Unterdrückte zu engagieren –
schrecklich aber ist die enorme hasserfüllte Feindseligkeit, die in unübersehbar vielen Fällen durch solche Behauptungen gegen notwendige Widersprüche immunisiert wird.
Der Artikel erschien zuerst auf man tau.