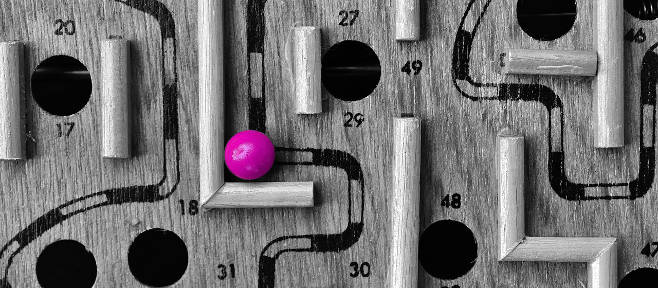Marcel Helbig und die Aggressionen gegen Jungen
In ihrem Buch Das faule Geschlecht beschrieb die Journalistin und Grünen-Politikerin Claudia Pinl 1994 Strategien, die von arbeitsscheuen Männern entwickelt worden seien, um Frauen für sich schuften zu lassen. Pinl hatte damit so viel Erfolg, dass sie noch zwei Bücher zum selben Thema folgen lassen konnte (Männer können putzen. Strategien gegen die Tricks des faulen Geschlechts und Männer lassen arbeiten. 20 faule Tricks, auf die Frauen am Arbeitsplatz hereinfallen).
Dass Pinl damit ohne Scheu das rassistische Klischee vom angeblich „faulen Neger“ einfach auf Geschlechterverhältnisse übertrug, fiel schon 1994 auf, ohne dass das für die Autorin Konsequenzen gehabt hätte. Ganz in diesem Sinn zitierte Prof. Dr. Michael Reeken sie in diesem Jahr im „Zentralblatt für Jugendrecht“ und beschrieb, wie sie in der Diskussionssendung Talk im Turm
„unwidersprochen das männliche Geschlecht als das faule Geschlecht bezeichnete und an einer Stelle ausrief, die faulen Hunde müssten endlich zum Arbeiten gebracht werden. Es gab unüberhörbar Beifall aus dem Publikum.“
Der englische Begriff One Trick Pony bezeichnete ursprünglich ein Zirkuspony, das nur einen einzigen Trick beherrschte. Heute wird der Begriff fast ausschließlich metaphorisch gebraucht, nämlich für Menschen, die anscheinend nur ein einziges Talent besitzen. Als ein wissenschaftliches One Trick Pony betätigt sich seit Jahren Marcel Helbig, der am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, in der Projektgruppe von dessen Präsidentin Jutta Allmendinger arbeitet, bei der er promoviert hat und die ihn seit Jahren protegiert.
Helbigs Trick, den er wieder und wieder vorführt, besteht darin, vor aller Augen die eigentlich unübersehbaren schulischen Nachteile von Jungen verschwinden zu lassen. Im Vergleich zu Mädchen sind Jungen an Gymnasien erheblich unterrepräsentiert, an Haupt- und Förderschulen erheblich überrepräsentiert, und sie verlassen die Schule deutlich häufiger ohne Abschluss.
Helbig aber erklärt, warum das kein Problem der Schule sei, und greift dabei auf die Argumentation Pinls zurück. Er übertragt deren Argumentation einfach weiter in den Bereich der Schulpädagogik, und er hat damit so großen Erfolg, dass überregionale Zeitungen freudig über seine Thesen berichten. „Zu faul fürs Gymnasium“, titelt beispielweise die vorgeblich so progressive taz genüsslich und meint damit, dass Jungen sich durch ihre Arbeitsscheu ihre Probleme selbst zuzuschreiben hätten. „Die Krise der Jungen ist ein Mythos“, hat Helbig selbst schon vor zwei Jahren im Berliner Tagesspiegel behaupten können, und dieselbe Zeitung referierte vor einer Woche erneut Helbigs Thesen, und erneut distanzlos.
Wäre die akademische Landschaft im Bereich der Erziehungswissenschaften einigermaßen intakt, dann würden Helbigs Arbeiten nicht erfolgreich sein, sondern als der wissenschaftliche Skandal herausgestellt werden, der sie sind. Es lohnt sich gleichwohl, einen näheren Blick in sie zu werfen, weil so an einem konkreten Beispiel gezeigt werden kann, wie ungeheuer problematisch das Hantieren mit Gender-Konzepten sein kann: Nicht einfach nur „Gaga“, wie Birgit Kelle behauptet, sondern gefährlich und folgenreich.
Es sind die schlimmsten Traditionen autoritärer, kinderfeindlicher Schulpädagogik, an die Helbig mit seinen Schriften ganz ohne Scheu und Bedenken anknüpft.
Wie ernstzunehmende Wissenschaftler untersuchen, ob Jungen schlechter sind
Sind Mädchen besser? Der Wandel des geschlechtsspezifischen Bildungserfolgs in Deutschland: Die Titelfrage von Helbigs Dissertation spielt durchaus nicht ironisch mit Klischees, sondern ist ganz ernst gemeint – so dass Michael Klein zurecht fragt, warum die Arbeit nicht gleich mit „Sind Jungen schlechter?“ betitelt worden ist.
Damit, dass Mädchen nun einmal zum begabteren Geschlecht gehörten, hatte ja schon Jürgen Trittin als grüner Fraktionsvorsitzender im Bundestag die Bildungsnachteile von Jungen wegerklärt. Helbig bietet eine Variation an – für ihn gehören Jungen nicht zum unbegabteren, aber zum fauleren Geschlecht. Beide Positionen sind geeignet, um – so formuliert es Klein –
„dem Bildungssystem als solchem, also Lehrern, Schulen und vor allem Kultusministerien, Absolution zu erteilen. Helbig liefert damit ein erneutes Beispiel dafür, wie Wissenschaft zur Magd politischer Interessen degradiert wird.“
Wie Helbig das macht, lässt sich mit der Anekdote von einem Ehepaar illustrieren, dem der Hund davongelaufen ist. Während aber die Frau ungeheuer an diesem Hund hängt, ist er dem Mann schon lange auf die Nerven gegangen. Doch um Konflikten aus dem Weg zu gehen, sagt er das seiner Frau selbstverständlich nicht. So macht er sich auf den Weg, um lange und ausdauernd, Stunde um Stunde nach dem davongelaufenen Hund zu suchen – achtet aber sorgfältig darauf, überall nur dort nachzuschauen, wo der Hund gewiss nicht sein kann. Immer wieder kehrt er danach zu seiner Frau zurück und verkündet ihr traurig, aber innerlich jubilierend, dass das geliebte Tier trotz allergrößter Mühen einfach nicht zu finden sei.
Helbig forscht nach Bildungsnachteilen von Jungen ebenso, wie dieser Mann nach dem Hund sucht. Er sammelt große Menge an Daten, achtet aber sorgfältig darauf, sie nur dort zusammenzutragen, wo sie die erwünschten Ergebnisse nicht stören können.
Heike Diefenbach und Michael Klein kritisieren in eben diesem Sinn schon die Dissertation scharf. Zu den Bildungsnachteilen von Jungen würde wesentlich die Tatsache gehören, dass ein großer Teil der Jungen im mehrgliedrigen Schulsystem in Haupt- und Förderschulen sortiert wird und dass viele von ihnen im Gymnasium – auch wenn sie die gleichen Leistungen erbringen wie die Mädchen – gar nicht erst ankommen. Ausgerechnet diese Jungen aber spielen in der Dissertation, die sich auf Daten über das Erreichen des Abiturs konzentriere, keine Rolle.
Mit einem ganz ähnlichen Kniff hatte auch schon Thomas Viola Rieske in einer Passage seiner GEW-Studie Bildung von Geschlecht Bildungsnachteile von Jungen kaschiert: Er hatte sich darauf beschränkt, Mädchen und Jungen jeweils derselben Schulform zu vergleichen – und so gerade den wesentlichen Faktor ausgeblendet, dass Jungen überproportional häufig eben in die Schulformen sortiert werden, deren Bildungsabschlüsse einen geringeren Wert haben.
Selektiv erhebt Helbig seine Daten auch, wenn er zu zeigen versucht, dass mehr männliche Lehrer die Situation für Jungen nicht verbessern würden. Er konzentriert sich auf Grundschuldaten – und damit auf die Daten von Schulen, deren Männeranteil notorisch extrem gering ist.
Damit kann er aber eben gerade nicht überprüfen, ob es die Möglichkeiten von Jungen einschränkt, wenn ihr Kollegium fast oder ganz vollständig aus Frauen besteht. Es fehlen in Helbigs Daten die dafür nötigen Vergleichsgruppen von Schulen mit einem ausgeglichen Anteil von Männern und Frauen und Schulen mit einem Männerüberschuss.
In seinem mit Michael Neugebauer und Andreas Landmann veröffentlichten Text Unmasking the Myth of the Same-Sex Teacher Advantage erwähnen die Autoren zwar kurz, dass der Anteil der Lehrerinnen im Sample zwischen 78% (Mathematik) und 86% (Naturwissenschaften) gelegen hätte (Neugebauer et.al., S. 12), gehen dann aber auf diesen deutlichen Überschuss überhaupt nicht ein. Gleichwohl erwecken sie den Eindruck, ungeheuer skupulös vorzugehen, weil sie in der Folge ihre Daten wieder und wieder auf einzelne Störfaktoren hin untersuchen und aus ihnen komplexe Formeln basteln.
Tatsächlich verhalten sie sich wie ein Zauberkünstler, der viele Ablenkungen produziert, weil die Zuschauer sonst etwas wahrnehmen würden, das ohne diese Ablenkungen überhaupt nicht zu übersehen wäre. Viele Kinder erleben heute erst mit etwa elf Jahren, wenn sie nämlich in die weiterführenden Schulen eintreten, einen stabilen Kontakt zu männlichen Erwachsenen. In den Kindergärten sind männliche Erzieher ungeheuer seltene Ausnahmen, in den Grundschulen auch, und viele Kinder haben zudem keinen oder nur unregelmäßigen und spärlichen Kontakt zu ihren Vätern.
Die Erwachsenenwelt, die sie kennenlernen, ist über mehr als die Hälfte ihrer Kindheit und Jugend hinweg eine weitgehend männerfreie Welt.
Es ist naheliegend, dass das Folgen hat. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechtsidentität ist schließlich ein wesentlicher Aspekt der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Die Welt der Erwachsenen, und insbesondere die Bildungsinsitutionen, können Mädchen daher als eine Welt erleben, IN und MIT der sie sich entwickeln – für Jungen ist es eher eine Welt, zu der sie Distanz in ihrer Entwicklung suchen, GEGEN die sie sich entwickeln müssen.
Eben das kann Helbig mit seinen Ko-Autoren aber gar nicht messen. Ihre Daten erlauben bestenfalls ein Urteil darüber, ob jeweils einzelne männliche Lehrer für Schüler gut und einzelne Lehrerinnen für Schüler schlecht sind – das aber behauptet ohnehin kaum jemand ernsthaft. Eigentlich stellt Helbig lediglich fest, dass in einem Schulklima, aus dem Männer fast vollständig ausgeschlossen sind, einzelne männliche Lehrer auch keine nennenswerte Wirkung mehr haben.
Eben solche Zusammenhänge erkennt Helbig auch ausdrücklich an – aber nur, wenn es um Mädchen geht. In seinem gerade veröffentlichten Text Brauchen Mädchen und Jungen gleichgeschlechtliche Lehrkräfte? schreibt er:
„Solange (…) in MINT-Fächern nur wenige weibliche Lehrkräfte an einer Fakultät lehren, ändern auch einzelne weibliche Lehrkräfte nichts an dem eher maskulinen Image dieser Fächer bzw. Fakultäten (…). Somit wäre auch nicht nur das Geschlecht einer Lehrkraft wichtig, sondern die Geschlechterkomposition einer Fakultät.“ (Helbig, S. 8)
Ebenso einseitig setzt auch Simone Schmollack in ihrem schon erwähnten taz-Text Prioritäten.
„An einem Punkt könnten Lehrerinnen jedoch sehr wohl einen Einfluss auf Mädchen haben, so in naturwissenschaftlichen Fächern: Wenn Mädchen in der Schule erlebten, wie cool eine Physik- und eine Chemielehrerin experimentiert, würden sie eher dazu animiert, ebenfalls ein sogenanntes MINT-Fach zu wählen.“
Dass Mädchen im begrenzten Bereich der MINT-Fächer also unbedingt Vorbilder brauchen, wird hier auf keinen Fall in Zweifel gezogen. Dass aber die Ent-Maskulisierung ganzer Bildungsinstitutionen, ja überhaupt des Aufwachsens von Kindern irgendetwas mit den deutlich messbaren Bildungsnachteilen von Jungen zu tun haben könnte – das ist ein Gedanke, der so wie selbstverständlich nicht stehenbleiben kann.
Wie Marcel Helbig das pädagogische Tomatometer entwickelte
Dabei würde sich damit leicht erklären lassen, warum Jungen – so Ergebnisse einer Studie von Andreas Hadjar und anderen – deutlich stärker von der Schule entfremdet sind als Mädchen. Doch statt zu fragen, welche Aspekte der Institution Schule zu dieser Entfremdung beitragen, suchen Hadjar et.al. die Gründe bei den Jungen selbst. Verantwortlich seien nicht etwa problematische Strukturen der Schule, sondern „hegemoniale Praktiken der Männlichkeit“, mit denen die Jungen nicht in die modernen, aufgeklärten Bildungsinstitutionen passen würden. (Hadjar et.al., S. 94)
Das wiederholt unverdrossen das wesentliche Credo der autoritären, kinderfeindlichen Schulpädagogik: Die Schule ist richtig, nur die Kinder sind falsch. Auch Marcel Helbig stimmt dieses Credo in immer neuen Varianten an.
Seine oben zitierte, gerade erschienene „Vergleichsstudie“ zu „42 Studien mit Daten zu 2,4 Millionen SchülerInnen aus 41 Ländern aus acht Jahrzehnten“ (Helbig, S. 1) wird sofort in überregionalen Zeitungen aufgegriffen. Die schon zitierte Simone Schmollack schreibt irritierend kritiklos:
„Nicht weil männliche Lehrer fehlen, sind Jungs in der Schule schlechter als Mädchen. Schuld sind ausschließlich die Jungs selbst.“
Sie setzt nach:
„Mädchen sind eher leistungsbereit und Jungen eher faul. (…) Erfolg ohne Mühen ist nach wie vor männlich konnotiert.“
Dass das offensichtlich nicht stimmt, stört hier nicht weiter. Anstrengungslose Wirkung ist in der klassischen Literatur weiblich konnotiert, als „Anmut“, die Friedrich Schiller der männlichen „Würde“ gegenüberstellt, welche ihrerseits immer mit Leid und Anstrengung verbunden sei. Das bedeutet nun nicht, dass Schiller Recht und Schmollack Unrecht hätte – es zeigt aber, wie beliebig die klischeehaften Gender-Zuordnungen sind, mit denen Schmollack, Helbig und andere operieren. „Wissenschaft“ ist hier wie eine große unaufgeräumte Schublade, aus der immer das herausgeklaubt werden kann, was gerade gebraucht wird und politisch opportun ist.
Der Tagesspiegel schreibt ähnlich unkritisch über Helbigs Text, aber wenigstens erspart er sich die offen triumphierenden Untertöne Schmollacks.
„Eine Analyse von weiteren 369 Studien habe unter anderem ergeben, dass sich die Notenunterschiede zwischen Mädchen und Jungen von 1914 bis 2011 nicht verändert haben. ‚Mädchen bekamen schon immer bessere Noten’, stellt Helbig fest. Dies sei auf eine größere Leistungsbereitschaft zurückzuführen.“
Tatsächlich hat Helbig seine 42 Studien keineswegs „analysiert“, und die weiteren 369 Studien hat er nicht selbst überprüft. Er zitiert lediglich eine Überblicksstudie, der sie zu Grunde lagen. (Helbig, S. 25) Er sichtet Rohdaten nicht, er überprüft nicht die Vergleichbarkeit der Studien aus ganz unterschiedlichen Zeiten und Ländern, und er geht über den wesentlichen Unterschied zwischen Benotung und Leistungen nonchalant hinweg (mehr dazu unten). Dabei ist eben das ein wesentlicher Aspekt der schulischen Nachteile von Jungen, dass sie bei gleichen Leistungen schlechter bewertet werden als Mädchen.
Sein wissenschaftliches Vorgehen: Helbig skizziert einfach knapp, welches für ihn die wesentlichen Ergebnisse jeder Studie sind, und listet diese Notizen dann auf. Ganz ähnlich operiert auch die amerikanische Webseite Rotten Tomatoes, die Filmkritiken sammelt, verlinkt und auf einfache Weise kategorisiert. Ein Lob wird mit einer roten, vollen Tomate symbolisiert, ein Verriss mit einer verfaulten und zerplatzten Tomate, die gleichsam nach dem Film geschmissen wurde. Mit dem so erstellten „Tomatometer“ lässt sich dann leicht illustrieren, wie gut ein Film bei der Kritik angekommen ist.
Das Tomatometer ist ein nützlicher Spaß, den keiner der Beteiligten ernsthaft als eine wissenschaftliche „Analyse“ bezeichnen würde. Dabei sind diese Ergebnisse durch die verlinkten Kritiken deutlich leichter zu überprüfen als die Ergebnisse von Helbigs Schulforschungs-Tomatometer, mit dessen Hilfe er es als wichtiges Forschungsergebnis darstellt, dass Mädchen ohnehin schon immer besser in der Schule gewesen seien als Jungen und dass deren schulische Nachteile allein auf ihre eigene Arbeitsscheu zurückzuführen seien.
Wie Heinrich Mann einmal Simone Schmollack erfand
Helbig hat, soweit dies in seinem Lebenslauf zu erkennen ist, keine Erfahrung in der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Sonst wüsste er, wie ungeheuer ausdauernd, begeistert und engagiert Jungen lernen, wenn sie Interesse an etwas haben. So kommt er auch gar nicht auf den einfachen Gedanken, dass die geringere Leistungsbereitschaft, die er Jungen zuschreibt, tatsächlich eine geringere Anpassungsbereitschaft an die Erwartungen der Institution Schule sein könnte.
Dabei ist dieser Gedanke angesichts der größeren Schulentfremdung von Jungen sehr naheliegend. Unter den angeblich so jungentypischen „hegemonialen Praktiken der Männlichkeit“ führen schon Hadjar et.al. allen Ernstes unter anderem „rebellisches Verhalten gegenüber Schulaufgaben, das Hinterfragen/Herausfordern von Regeln und Autoritäten“ (rebellious attitudes towards schoolwork, challenging rules and authority, S. 94/95) auf.
Helbig wiederum verlangt eine selbstkritische Einschätzung von den Akteuren in der Schule nicht einmal angesichts des Sachverhalts, dass Jungen bei gleicher Leistung im Durchschnitt schlechtere Noten bekommen als Mädchen. Über sie schreibt Helbig:
„Mit einem höheren Maß an Leistungsbereitschaft können so auch etwas schlechtere schulische Kompetenzen bei der Notengebung ausgeglichen werden.“ (Helbig, S. 26)
Das bedeutet übersetzt: Weil Mädchen leistungsbereiter seien, würden sie auch bessere Leistungen erbringen. Und selbst wenn ihre Leistungen nicht besser sind als die der Jungen, seien bessere Noten zu rechtfertigen, weil die Mädchen ja eine höhere Leistungsbereitschaft gezeigt hätten. In seinem Tagesspiegel-Artikel formuliert Helbig das so:
„Über die Frage, ob Motivation und Verhalten in die Benotung einfließen sollte, lässt sich streiten. Aus Sicht der meisten Lehrkräfte ist das aber offenbar sinnvoll.“
Tatsächlich lässt sich keineswegs darüber streiten, jedenfalls nicht im Rahmen bestehender Gesetze. Eine schulische Leistungsbewertung bewertet die schulischen Leistungen – ob ein Schüler für diese Leistungen wochenlang gelernt oder sie mit dem Gestus größter Langeweile aus dem Ärmel geschüttelt hat, ist dabei nicht relevant. Laut Gerichtsurteil können Lehrkräfte zwar in Einzelfällen die Lernentwicklung von Schülern bei der Notengebung berücksichtigen – bei dem, was Helbig beschreibt, geht es aber weder um Einzelfälle, noch geht es um die Lernentwicklung von Schülern.
Zudem wird das Arbeits- und Sozialverhalten in vielen Bundesländern eigens in den Kopfnoten festgehalten. Es wäre eine doppelte Belastung der Schüler, wenn es zudem noch in die Fächernoten einfließen würde.
Dass Jungen bei gleichen Leistungen tendenziell schlechtere Noten erhalten, ist also nicht korrekt, es ist ein diskriminierendes Verhalten von Lehrkräften, und es ist ein Problem der Schulen, nicht der Jungen – aus dem die Schulen allerdings ein Problem der Jungen machen. Dass ein Wissenschaftler der Schule nicht die nötige Selbstkritik abverlangt, sondern stattdessen eine problematische Tendenz der Institution auf Kosten der betroffenen Kinder mit irreführenden Gründen rechtfertigt – das ist an sich schon skandalös.
Schlimmer noch sind aber die Hintergründe dieser Position.
„Sich für gute schulische Leistungen anzustrengen und selbst zu disziplinieren, passt nicht in das geschlechtstypische Konzept von Männlichkeit. Jungen wird suggeriert, dass sie anstrengungslos aufgrund ihrer natürlichen Begabung die Lerninhalte verstehen könnten.“ (Helbig, S. 29)
Da Jungen von ihren Eltern vermittelt würde, dass sie intelligenter als Mädchen seien, würden Jungen in dem Glauben leben, Leistungsbereitschaft sei nur zum Ausgleich fehlender Intelligenz nötig. Wer sich leistungsbereit zeige, stelle sich damit gleichsam als minderbegabt dar.
Mit dieser hochspekulativen Argumentation erscheinen dann sogar die schulischen Nachteile von Jungen als Symptom ihrer patriarchalen Privilegien. Mädchen hingegen seien eben deswegen in der Schule besser, weil ihre Eltern es ihnen nicht so leicht machen würden wie den Jungen und sie so von Beginn an daran gewohnt seien, sich ihre Position erarbeiten zu müssen.
Erst vor diesem Hintergrund wird die Häme verständlich, mit der hier Erwachsene über Kinder und Jugendliche schreiben. Simone Schmollack beispielweise tritt in der taz auf wie eine Wiedergängerin von Heinrich Manns Untertan Diedrich Heßling, wenn sie mit unverhohlener Freude darüber schreibt, wie Jungen durch eine im Vergleich zu den Mädchen geringere Anpassung an schulische Erwartungen in Schwierigkeiten geraten. „Zu faul fürs Gymnasium“
Ich selbst bin Gymnasiallehrer, arbeite aber schon lange an einer Gesamtschule. Ein Grund dafür, dass ich an die Gesamtschule wollte, war, dass Sätze wie „Der/Die gehört hier nicht her“ zum Alltag in den gymnasialen Lehrerzimmergesprächen über Schüler gehören. Dieselbe autoritär-herablassende Haltung gegenüber Kindern und Jugendlichen verbreitet nun eine Tageszeitung, die sich allen Ernstes als progressiv verkauft.
Die Ressentiments gegenüber Jungen, an die Schmollack, Helbig und andere anknüpfen, sind nicht neu, und sie sind keine Erfindung von Feministinnen. Dass Jungen schwieriger seien als Mädchen, aufmüpfiger, lauter, konfliktfreudiger, selbstherrlicher, arroganter – das gehört schon lange zu den schulischen Jungenklischees. Jungen werden von Lehrkräften traditionell – und durchaus angstbesetzt – in stärkerem Maße als Mädchen als Störungen im System Schule wahrgenommen.
Helbig aber vertieft diese Ressentiments, ideologisiert sie und immunisiert sie gegen offenkundige Einwände. Er schützt die Institution Schule und ihre Lehrkräfte vor naheliegender Kritik und stellt stattdessen männliche Kinder und Jugendliche auf eine Weise dar, die zu Aggressionen, ja Hass auf sie einlädt.
Jungen nämliche erscheinen hier als Menschen, die von Beginn ihres Lebens an gepampert wurden, die mit einem erheblichen Anspruchsdenken durch ihr Leben gehen, das sie durch eigene Leistungen nicht beglaubigen können, und die sich generell für etwas Besseres halten – und die selbst Schuld sind, wenn sie damit, endlich, in heftige Schwierigkeiten geraten.
Der angemessene Ausdruck für eine solche pauschale Darstellung von Menschen, gar Kindern ist nicht „Wissenschaft“, sondern „gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“. Auch hier – wie bei der Ausgrenzung von Vätern, wie bei den einseitigen Darstellungen von häuslicher Gewalt oder „Sexismus“ – sind feministische Positionen keineswegs „progressiv“ oder „emanzipatorisch“, sondern ganz im Unterschied zu ihrem Selbstbild tief reaktionär.
Denn auch wenn Helbig überzeugt davon ist, nachweisen zu können, dass mehr männliche Lehrer männlichen Schülern keineswegs gut tun würden – der Sprung zu den pauschalen Unterstellungen der Arbeitsscheu von Jungen wäre damit noch lange nicht erklärt. Er geht nicht aus dem Text hervor, sondern baut auf Vorstellungen von Kindern, die Helbigs Texten offenbar immer schon zu Grunde liegen.
Diese autoritäre Kinderfeindlichkeit legitimiert sich absurderweise ausgerechnet dadurch, dass sie zu allem Überfluss auch noch sexistisch daherkommt: Als ob genüssliche Aggressionen Erwachsener gegenüber Kindern und Jugendlichen irgendwie ganz in Ordnung wären, solange diese Aggressionen allein männliche Kinder treffen.
Was aber unterscheidet eine Gender-Forschung dieser Art eigentlich grundsätzlich von der heute zurecht verachteten Pseudo-Wissenschaft der „Rassenkunde“? Sicherlich, die Rassenkunde klassifizierte Menschen nach Rassen und baute auf einem kruden Verständnis der Biologie auf, während diese Art der Gender-Forschung Menschen nach Geschlechtern klassifiziert und auf einem kruden Verständnis sozialer Konstruktionen aufbaut.
Beide aber setzen an bei gruppenbezogenen Ressentiments – teilen Menschen in wertvolle und weniger wertvolle – ja, hier wird sogar ein Unterschied etabliert zwischen Kindern, die der Unterstützung wert sind und Kindern, die keine Unterstützung verdient haben.
„Wissenschaft“ hat auf dieser Basis dann nur noch die Funktion, aus großen Mengen von Daten eben gerade die herauszuklauben, mit denen sich die Ressentiments scheinhaft unterstützen und legitimieren lassen.
Der Artikel erschien zuerst auf man tau.