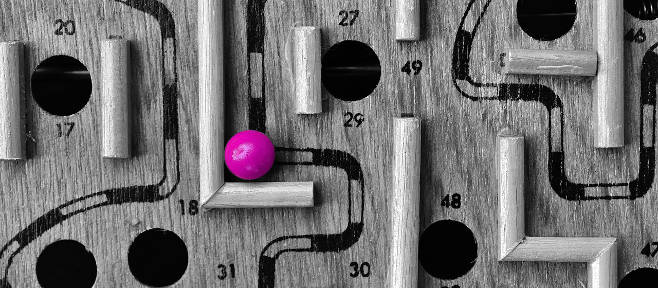Rechts, links, Feminismus
Warum der Feminismus weder rechts noch links oder vielleicht auch beides ist
Als ich in Göttingen studierte, hielt die NPD dort regelmäßig Demonstrationen ab. Deren Hintergrund: Während Rechtsaußen-Akteure im südniedersächsischen Umland gut vertreten waren, schafften sie es nicht, in der Studentenstadt Fuß zu fassen. Wir verstanden die regelmäßigen Demonstrationen also als eine Art Kampfansage, und so nahmen wir – viele Freunde und ich – regelmäßig an den Gegendemonstrationen teil.
Regelmäßig waren wir auch zufrieden, dass diese Gegendemonstrationen jedes Mal, und trotz der ermüdenden Wiederholung des Geschehens, um ein Vielfaches größer waren als die recht kleinen NPD-Aufmärsche. Das war in unseren Augen ein Erfolg, wir hatten nie den Ehrgeiz, mit unserer Demonstration die der NPD zu verhindern. Natürlich sahen wir die nicht als Demokraten an, und wir machten uns sicher keine Illusionen darüber, dass NPD-Leute umgekehrt auch unser Demonstrationsrecht achten würden. Wir waren uns aber wohl einig, dass eine gezielte Verletzung der Demonstrationsfreiheit schließlich allen schaden könnte, nicht nur den NPD-Leuten.
Das ist heute anders. In sozialen Netzwerken wird es reihenweise als linker Erfolg gefeiert, dass der „Frauenmarsch“, der von der AfD-Politikerin Leyla Bilge angemeldet worden war, aufgrund von Wegblockaden durch Gegendemonstranten frühzeitig abgebrochen werden musste. Die etwa 550 Teilnehmer, darunter laut Tagesspiegel viele Männer, sind überzeugt davon, dass Frauen sich „wegen der Migrationspolitik der Bundesregierung nicht mehr sicher im öffentlichen Raum bewegen könnten.“
Warum reichte es Linken nicht, deutlich zu machen, dass sie die Ziele der Demonstration klar ablehnen? Warum war es für sie grundsätzlich unerträglich, dass solch eine relativ kleine Demonstration überhaupt stattfand? Sie war zum Beispiel deutlich kleiner als die radikale antisemitische Demonstration zum Jahresende, die ohne Probleme quer durch Berlin geführt werden konnte.
Über das unbedingte Recht, nicht mit den eigenen Widersprüchen konfrontiert zu werden
Tatsächlich konfrontierte der „Frauenmarsch“ eine heutige postmoderne Linke durchaus konsequent mit eigenen Widersprüchen. Das Credo der Definitionsmacht zum Beispiel, nach der allein das – fast immer: weibliche – Opfer eine Situation sexueller Gewalt gültig beschreiben könnte, spielte hier plötzlich keine Rolle mehr. Plötzlich pochen Linke nicht einmal einfach auf die Unschuldsvermutung, so wie es eine traditionelle rechtsstaatliche Kritik des Definitionsmacht-Konzeptes tut. Sie unterstellen sogar schlankweg Frauen, die von Erfahrungen sexueller Gewalt oder ihrer Angst davor berichten, eigentlich bloß von rassistischen Motiven geprägt zu sein.
Noch dazu organisiert mit der Deutsch-Kurdin Leyla Bilge eine Frau die Demonstration, die als Person of Color eigentlich zu den Menschen gehört, denen unbedingte Solidarität zustehe – die jedenfalls keine Kritik durch privilegierte Weiße ertragen müsse.
Ganz offensichtlich haben sich die Organisatoren mit linker Identitäts- und Geschlechterpolitik beschäftigt und beziehen nun Positionen, gegen die Linke sich eigentlich nur wenden können, wenn sie mit sich selbst in Widerspruch geraten. Die linke Reaktion darauf ist, auch im Hinblick auf ihre eigenen Interessen, leider destruktiv: Anstatt die eigenen Positionen zu überprüfen und zu klären, warum sie Rechten Futter für deren Aktionen liefern können, werden schlicht die Aktionen von Rechten unterbunden. Dies übrigens, ohne sich überhaupt dafür zu interessieren, ob es denn tatsächlich alles „Rechte“ sind, die hier demonstrieren – und ob nicht doch einige Menschen dabei sind, die sich einfach ernsthafte Sorgen machen.
Kurz: Linke marschieren hier nicht für eine humane Einwanderungspolitik auf, sondern für das Recht, nicht mit den eigenen Widersprüchen konfrontiert zu werden. Dabei werden diese Widersprüche schon seit Jahren offen thematisiert, auch hier im Blog. Wer das stumpfe fremdenfeindliche Klischee vom vergewaltigenden arabischen Mann stumpf in das männerfeindliche, aber opportunere Klischee übersetzt, dass rundweg alle Männer potenzielle Vergewaltiger wären – der bleibt eben auf der Ebene der Klischees hängen und lädt zur rechten Rück-Übersetzung ein.
Über die Erledigung von Wirklichkeit durch Sprache
Die Verhinderung der Demonstration zum Zwecke der Selbstbilderhaltung war schon vorher massenmedial orchestriert worden. In der Süddeutschen Zeitung hatte sich Julian Dörr über die „Frauen der identitären Bewegung“ mokiert: Sie schienen „auf den ersten Blick progressiv. Selbstbewusst und selbstermächtigt.“Natürlich sehe das tatsächlich ganz anders aus, denn tatsächlich gehe es ihnen
nicht um Feminismus und auch nicht um Gleichberechtigung. (…) Die Rechten (…) kämpfen für den Schutz der deutschen, der europäischen Frau.“
Für Rechte kommen Dörs Argumente offenkundig nicht überraschend. Die prominente Engagement Bilges ist wohl auch schon eine Reaktion auf diesen Vorwurf, und die rechte Rede vom „wahren Aufschrei“ kopiert den linken Anspruch, den wahrenFeminismus zu vertreten. Dörr wiederum argumentiert fast wortgleich mit Margarethe Stokowski, die kurz vor ihm im Spiegel gefragt hatte, ob es einen Feminismus von rechts geben könnte.
Die Antwort steht und fällt natürlich mit der Definition von Feminismus. Wenn Feminismus heißt, sich ab und zu irgendwie für irgendwelche Frauen einzusetzen, dann kann es rechten Feminismus geben, Grüße an Ivanka Trump, aber ansonsten nicht. Wenn Feminismus bedeutet – meine Definition -, dass alle Menschen die gleichen Rechte und Freiheiten haben sollten, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Sexualität und ihrem Körper, dann ist diese Haltung unvereinbar mit rechtem Denken.“
Stokowski, deren Text hier schon eingehend diskutiert wurde, klärt so ein politisches und soziales Problem schlicht durch die Wahl der passenden Definition, nicht durch die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Feminismus oder mit seinen heutigen Positionen. Solch ein Verweis auf Definitionen ist eine beliebte Reaktion auf Kritik, aber als linke Position in sich widersprüchlich.
Der Philosoph und Pädagoge John Dewey, der sich selbst als demokratischer Sozialist verstand, hatte schon vor hundert Jahren an mehreren Stellen seines Werks klassische Widersprüche der Philosophie – Körper/Geist, Praxis/Theorie, Realismus/Idealismusetc. – als Widerspiegelung soziale Spaltungen verstanden. Philosophen hätten schon in der griechischen Antike von einer sozial privilegierten Position aus argumentiert, in der sie insbesondere durch die Arbeit von Sklaven von pragmatischen Handlungszwängen befreit gewesen wären. Nur so hätte etwa Platons Idee einer Welt des rein Geistigen plausibel werden können.
Wer soziale Probleme allein durch das Beharren auf angemessenen sprachlichen Bezeichnungen und Definitionen zu klären vorgibt, der reproduziert ebenso soziale Spaltungen, die er – oder eben: sie – zugleich nicht einmal wahrnimmt. Klassische Linke, die sich dialektische Argumentationen von Hegel abgeschaut hatten, hätten Stokowski leicht einen Widerspruch zwischen Form und Inhalt nachweisen können: Ausgerechnet in der Art und Weise, in der sie auf ihrer linken Position beharrt, verrät sie eine privilegierte Position, derer sie sich offenbar überhaupt nicht bewusst ist.
Was, bitte, ist daran links?
Wer sich zudem ihre Definition anschaut, merkt schnell, dass sie auf den größten Teil des real existierenden Feminismus gar nicht zutrifft. Dass gleiche Rechte und Freiheiten aller Menschen durch Feministinnen bekämpft und nicht erkämpft werden, habe ich als Trennungsvater intensiv erlebt. Das gilt nicht für alle Feministinnen, aber es gilt für einflussreiche, sei es nun die Wissenschaftlerin Anita Heiliger, seien es die Frauen der Verbands der Alleinerziehenden, seien es Frauen der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen.
Die SPD hatte sich als einzige Partei gegen die leichten Verbesserungen der Rechte nichtverheirateter Väter gestemmt und darin ganz selbstverständlich keinen Widerspruch zu ihrem Selbstbild gesehen, für Geschlechtergerechtigkeit und gleiche Rechte einzutreten. Nichts davon ist links – die Partei steht für die zugespitzte Version eines konservativen Familienbildes, nach dem die Frau für die Kinder und der Mann für’s Finanzielle sorgt.
Ich habe sogar einmal die örtliche Bundestagsabgeordnete der SPD in ihrer Bürgersprechstunde besucht und ihr erzählt, dass ich allein für die Aufrechterhaltung des Umgangs mit unserem 500 Kilometer von mir entfernt wohnenden Kind etwa 700 Euro pro Monat aufbringe, zusätzlich zum Unterhalt, dem Schulgeld und anderem. Ich hatte ihr auch erzählt, dass ich trotz eines Studienratsgehalts den Umgang finanziell nicht mehr stemmen konnte, als ich noch Betreuungsunterhalt an die Mutter zahlen musste. Ich hatte den Umgang damals nur weiter führen können, weil ich einen Kredit von 4000 Euro aufnahm, den ich nach meiner Betreuungsunterhaltspflicht Stück für Stück zurückzahlte, den ich als Beamter aber wenigstens problemlos bekam.
Meine Pointe war: Mit einem Facharbeitergehalt, also mit dem Gehalt eines Mannes aus der klassischen Wählerschaft der SPD, hätte ich keine Chance gehabt, den Kontakt zu unserem Kind aufrecht zu erhalten. Ich dachte, dass das für Sozialdemokraten doch eigentlich relevant sein müsste.
Natürlich aber sind solche Zusammenhänge in der SPD bekannt, sie sind ja auch leicht nachvollziehbar und beruhen auf allgemein zugänglichen Informationen – sie interessieren dort nur niemanden.
Was, bitte, ist daran links?
Stokowski, Dörr und viele andere bauen sich ein Bild des Feminismus, das reale soziale Erfahrungen von Menschen nur dann integriert, wenn sie zur Bestätigung des Bildes zu gebrauchen sind. Sie nehmen gar nicht wahr, dass schon Feministinnen der ersten Generation Positionen bezogen, die nicht nur nach heutigem Verständnisweit rechts ausschlugen. Elitären Positionen der britischen Suffragetten-Bewegung zum Beispiel, auch von Emmeline Pankhurst, nach denen ärmeren Männern und Frauen das Wahlrecht versagt bleiben sollte.
Weiße US-amerikanische Suffragetten bezogen sowohl antirassistische als auch deutlich rassistische Positionen. Rebecca Ann Latimer Felton, erste Senatorin der USA, trat offen für das Lynchen von Schwarzen ein – um den „teuersten Besitz einer Frau vor den tollwütigen menschlichen Tieren zu schützen“. ( to protect woman’s dearest possession from the ravening human beasts) Die Suffragette Cary Chapman Catt, Gründerin der League of Women Voters, trat für das Frauenwahlrecht mit dem Argument ein, dass damit die weiße Überlegenheit – white supremacy – gesichert bleibe. Allein diese Liste ließe sich noch weit fortsetzen.
Feministinnen traten für eugenische Kontrolle des Männeranteils in der Gesellschaft ein, die bis heute immer wieder aufgelegte Manifest „Scum“, ein düsteres feministisches Kultbuch, knüpft direkt an die Massenmord-Politik des Nationalsozialismus an. In der „Matriarchatsforschung“ bezogen Feministinen wie Chrira Mulack oder Gerda Weiler antisemitische Positionen, weil sie die Entstehung des verhassten „Patriarchats“ an das Judentum knüpften.
Diese Liste von Rechtsaußen-Positionen im Feminismus ließe sich ebenfalls noch lange fortsetzen. Aber auch einige gemäßigtere Positionen sind politisch gewiss nicht „links“. Die Vorstellung der unschuldigen Frau, die vom männlichen Unhold verfolgt, bedrängt und vergewaltigt wird, bevölkerte viktorianische Geschlechterphantasien ebenso wie die Fantasien weißer Lynchmobs. Wenn MeToo heute darauf zurückgreift, dann ist die Spiegelung dieser Positionen bei Rechten kein Missbrauch der integren MeToo-Positionen, sondern ihr konsequenter Gebrauch. Zudem braucht MeToo überhaupt keine Rechten, um in faschistoide Positionen zu kippen – dass die Aktivistinnen das auch selbst schaffen, war hier gerade erst Thema: Fashion und Faschismus.
Wie aber ist es überhaupt zu erklären, dass rechte und linke Positionen so einfach ineinander zu spiegeln sind, ohne dabei auf das einprägsame, aber inhaltsleere Bild eines Hufeisens zurück zu greifen?
Spieglein, Spieglein an der Wand: Wer ist die Reinste hier im Land?
Progressive und reaktionäre Positionen können auf spiegelbildliche Weise eine andere, bessere Zeit die gegenwärtige soziale und politische Situation ausspielen: Der Reaktionär entdeckt in der Vergangenheit eine Zeit, in der die Welt noch in Ordnung war – der Progressive arbeitet für eine lichte Zukunft. Die Unübersichtlichkeit der Gegenwart sieht dagegen zwangsläufig wirr aus, widersprüchlich, unvollkommen, unrein.
Zuverlässig finden sich in ihr finden aber immer Menschen, die sich als Repräsentanten einer besseren Zeit verstehen lassen. Sie seien eben naturgemäß in der schlechten Gegenwart unterdrückt, marginalisiert, an die Seite geschoben, vergessen. Sowohl mit einer reaktionären als auch mit einer progressiven Logik kann sich der Kampf für eine reinere, bessere Welt so als Kampf für die Unterdrückten der Gegenwart darstellen lassen.
Da es aber zumindest in bürgerlichen Kreisen zur traditionellen männlichen Funktion gehört, sich mit den Unvollkommenheiten, Zwängen, Anforderungen und Widersprüchen der gegenwärtigen Welt einzulassen und auseinanderzusetzen, sind Männer in der Regel als Repräsentanten politischer Reinheitsideologien eher ungeeignet. Sie sind – Chaleks Schweinemasken sind dafür ein Sinnbild – dafür schlicht zu unrein, zu wirklichkeitskontaminiert.
Frauen, und insbesondere bürgerliche Frauen, eignen sich als Trägerinnen politischer Reinheitsphantasien deutlich besser. Natürlich aber geht es hier kaum um reale Frauen – die haben eine Funktion als Projektionsfläche, müssen aber mit wütenden Reaktionen ihre engagierten Vorkämpfer rechnen, wenn sie diese Projektion stören. Ich habe schon von Linken wie von Rechten Vergewaltigungswünsche gegen Frauen gelesen, die sich in den Augen der Verfasser allzu bereitwillig mit dem Feind – Ausländer, Mann schlechthin – eingelassen hatten. Wird sie schon sehen, was sie davon hat.
Nicht jede linke und auch nicht jede feministische Politik ist also in der Gefahr, in Rechtsaußen-Positionen abzurutschen, ohne es zu merken. Diese Gefahr besteht für politische Reinheitsphantasien, die in der Gegenwart lediglich ein zu überwindendes Übel erkennen können, ein allumfassendes „Patriarchat“, eine omnipräsente „heterosexistische Matrix“, eine „Rape Culture“. Wer die menschliche Gesellschaft wolle, müsse die männliche überwinden.
Dass heutige postmodernen Linke oder heutige Feministinnen keine klare Grenzlinie zu Rechtsaußen-Positionen ziehen können, dass Rechte gar lustvoll die Parallelen zwischen ihnen und Linken herausarbeiten – das liegt vor allem daran, dass kaum noch linke und feministische Positionen erkennbar sind, die sich engagiert, vorurteilsfrei und empathisch mit sozialen Realitäten auseinandersetzen, anstatt sich in leeren Reinheitsphantasien zu verstricken.