Zwanzig Jahre Srebrenica: Massenmord an Männern bis heute nicht aufgearbeitet
Dieser Tage veröffentlichen viele Medien Artikel zum zwanzigsten Jahrestag des Massakers von Srebrenica. Mit den geschlechterpolitisch relevanten Aspekten dieses Massenmords habe ich mich in meinem Buch Plädoyer für eine linke Männerpolitik beschäftigt:
So stürmte im Juni 1995 die serbische Armee die Stadt Srebrenica im Osten Bosnien-Herzegowinas und schlachtete fast 8000 Männer und ältere Jungen systematisch ab und war damit für das schlimmste Massaker seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verantwortlich. Zwei Jahre vor diesem Massaker hatte der Hohe Flüchtlingsrat der Vereinten Nationen mehrere tausend Zivilisten aus der belagerten Stadt evakuiert.
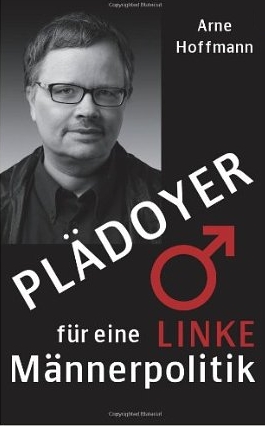
Frauen, Kinder und Senioren war die Flucht über die UN-Konvois gestattet worden; erwachsene Männern aus der Zivilbevölkerung hatte man in der Stadt belassen – dies obwohl den Verantwortlichen der Vereinten Nationen bekannt war, dass in solchen Fällen fast routinemäßig vor allem die männliche Bevölkerung massenweise umgebracht wird. Männer im Alter zwischen 15 und 60 Jahren, die versucht hatten, sich unter den Scharen der Flüchtlinge zu verbergen, wurden von Verantwortlichen des UNHCR entfernt, die sich weigerten, für deren Schutz die Verantwortung zu übernehmen.
Vier Jahre nach dem Massaker, im Jahr 1999, traf sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, um über den Schutz der Zivilbevölkerung in Kriegsgebieten zu diskutieren. Während im Kosovo erneut vor allem männliche Zivilisten massakriert wurden, einigten sich die Delegierten darauf, dass Frauen und Kinder ein besonderes Recht auf humanitäre Unterstützung haben. Eine Studie der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch über 3453 Hinrichtungen im Rahmen des Kosovo-Konflikts führte zu dem Ergebnis, dass 92 Prozent aller Opfer, von denen man das Geschlecht kannte, männlich waren. Zu anderen Menschenrechtsverletzungen, von denen weit überwiegend Männer betroffen waren, zählten Gefangennahme und schwere Folter. Dies bestätigen auch Berichte anderer Organisationen zur Menschenrechtslage im Kosovo. Ein Helfer, der in den zurückgebliebenen Dörfern tätig war, sprach von einem „Planeten ohne Männer“, einer Welt, in der es nur noch Frauen und Kinder gab. Die Männer waren verschleppt oder umgebracht worden.
Als der Genderzid-Experte Professor Adam Jones während des Kosovokonflikts seine Sorge über die mit dem Tode bedrohten Männer der Region dem Präsidenten des dafür zuständigen Menschenrechts-Zentrums der Vereinten Nationen mitteilte, erhielt er als Antwort drei Sätze eines Assistenten, der Jones dankte, aber erklärte, derartige Fragen seien nicht Teil des UN-Mandats. Die Frauen wurden in Sicherheit gebracht, reagierten aber sichtlich verzweifelt darüber, dass sie ihre Männer in einer Situation zurücklassen mussten, wo diesen mit hoher Wahrscheinlichkeit der Tod drohte. „Es war nicht leicht dabei zuzusehen, wie Frauen und Kinder von ihren Männern fortgeführt wurden“, zitiert Adam Jones die Reaktion eines holländischen Mitglieds der UN-Friedenstruppen im Kosovo und ergänzt: „Dieses Statement fasst die vorherrschende Einstellung gut zusammen.“ Bedauert wurden die verzweifelten Frauen, nicht die dem sich ankündigenden Massenmord ausgelieferten Männer. Acht Monate später fand das Massaker von Srebrenica statt. Ein Jahr danach gründete die von Jones angeschriebene Institution der UN eine Internationale Koalition zum Schutz der Menschenrechte von Frauen in Konfliktsituationen.
Die Expertin für internationale Beziehungen Paula Drummond untersuchte in einem Aufsatz über „unsichtbare Männer“ speziell die Gender-Mainstreaming-Politik der Vereinten Nationen im Zusammenhang mit dem Völkermord im Kongo, dem Männer so stark zum Opfer fielen, dass in manchen Regionen die Überlebenden zu achtzig Prozent aus Frauen und Kindern bestehen. Das Ergebnis von Drummonds Analyse: Grundlage der UN-Politik ist die Übernahme des sogenannten Gender-Mainstreaming-Prinzips, das der offiziellen Definition zufolge den Bedürfnissen beider Geschlechter zugutekommen soll, de facto aber fast ausschließlich zugunsten von Frauen eingesetzt wird. Obwohl die Vereinten Nationen beispielsweise in Ruanda und dem früheren Jugoslawien immer wieder Zeuge davon wurden, wie sich geschlechtspezifische Gewalt vor allem gegen Männer und Jungen richtete, besteht für sie „Geschlechterpolitik“ darin, Frauen und Mädchen zu schützen.
Drummond zeigt auf, dass, wenn beispielsweise Jungen und Männer durch Morddrohungen gezwungen werden, eigene Familienmitglieder zu vergewaltigen, Hilfe der UN danach lediglich den vergewaltigten Frauen zuteilwird. Wenn das massenhafte Abschlachten von Männern überhaupt in einen Bericht der UN Eingang findet, dann nur, weil die daraus „resultierende Unterrepräsentation von Männern dazu führt, dass Familien mit nur noch einer Frau als Haushaltsvorstand weniger sicher sind“ – also weil tote Männer das Leben von Frauen beeinträchtigen. Entgegen sämtlicher vorliegender Erkenntnisse wird immer wieder betont, dass Frauen und Kinder in den geschilderten Konflikten besonders gefährdet gewesen seien. Generell sei bei der Beschäftigung mit dem Konflikt im Kongo insofern eine feministische Perspektive vorherrschend, die Drummond aber als nicht zu Ende gedacht betrachtet, da die Marginalisierung männlicher Opfer das Klischee von Frauen als verwundbar und kontinuierlich hilfsbedürftig verstärke.
Wären die Genderstudien tatsächlich ein seriöses akademisches Fach, müssten diese Aspekte dort zu den zentralen Inhalten von Forschung und Lehre gehören. Stattdessen werden sie von den Anliegen eines einzigen Geschlechtes beherrscht. Für Wissenschaftler in anderen Fachbereichen gilt zum Beispiel Professor Adam Jones als einer der international führenden Experten beim Thema Völkermord, aus Sicht der Genderstudien ist er offenbar ein nicht zitierenswürdiger „alter weißer Mann“.
Aggressiver geht man in diesem Lager gegen Menschenrechtler vor, die das Leiden auch von Männern auf die politische Tagesordnung setzen möchten: Solche Aktivisten werden von den Ausputzern der Genderszene als „Rechte“ diffamiert, weil sie eine Opferideologie wie die Nationalsozialisten betrieben (die tatsächlich einseitige feministische Opferideologie hinterfragt man im Gender-Lager nicht). Man solle mit diesen Menschenrechtlern gar nicht erst sprechen, forderte etwa Thomas Gesterkamp, sondern um sie einen „Cordon Sanitaire“ ziehen. Öffentlich-rechtliche Journalisten wie Ralf Homann und Nina Marie Bust-Bartels verbreiten diesen Hass gerne. Und auch sie scheinen für dezidiert an Männern begangene Massenmorde kaum einen Gedanken übrig zu haben.
So wird auch das nächste Massaker dieser Art ungehindert über die Bühne gehen können. Denn die Grundlage dafür findet man nicht nur in anderen Kulturen, sie ruht auch tief im Herz der westlichen Gesellschaft: Es ist die Überzeugung, dass nur das Leden von Frauen zählt und derjenige, der über das Leiden von Männern spricht, zur Unperson gemacht und auf sozialer Ebene hingerichtet werden muss.
Die Denkweise, dass selbst der Tod vieler Menschen wenig gilt und das Durchsetzen des eigenen politischen Lagers alles, kennen wir bereits von mehreren Ideologien, denen auch Intellektuelle des linken und rechten Randes gefrönt haben: dem Nationalsozialismus, dem Stalinismus, dem Maoismus und jetzt eben Feminismus und Gender. Diese Denkweise kehrt wieder und wieder zurück, und trotzdem sollten wir alles dafür tun, sie endlich zu überwinden. Selbst wenn uns das nur um so mehr zur Zielscheibe des Hasses macht.
Grotesk ist es, wenn bei derlei Abscheulichkeiten von uns gefordert wird, emotional vollkommen gleichgültig und unbeteiligt zu bleiben. Andernfalls wird man als ein „angry white man“ diffamiert, und die eigene Meinung ist keinen Pfifferling wert. Andererseits funktioniert dieser Mechanismus nur im Kopf der Ideologen. Ich persönlich bin in diesem Zusammenhang eher für Wut. Besser als Depression ist Wut allemal.
Dieser Beitrag erschien zuerst auf „Genderama“






