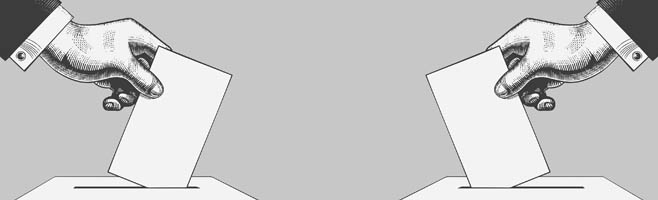Die Zukunft der Demokratie
„Deutschland (und mit ihm vermutlich ganz Westeuropa) wird sich (…) der Auseinandersetzung mit der Frage ‚Wie hältst du´s mit dem Kapital?‘ demnächst stellen müssen.“
— Rainer Rotermund 1997
1 Herrschaft des Volkes ?
Die moderne Demokratie ist jung; entstanden erst zur Zeit der einsetzenden Industriellen Revolution durch den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und durch die Französische Revolution, und mit geistigem Rückgriff auf die Antike: auf die Römische Republik und die Polis von Athen; von dort her beispielgebend und ausgreifend auch auf andere Gesellschaften. Das Bürgertum suchte eine politische Form, die seiner gesellschaftlichen, insbesondere seiner ökonomischen Führungsrolle entsprach, und es fand sie im Parlamentarismus, in der Staatsform der Republik. Die politische Gleichheit aller Staatsbürger war, z.B. im Hinblick auf die Wahlberechtigung, keineswegs von Beginn an gewährleistet, sondern die diskriminierten Klassen, Schichten und Gruppen mussten sich das Allgemeine Wahlrecht erst erkämpfen.
Wenn heute aufgrund eines oberflächlichen Augenscheins behauptet wird, dass die Marktwirtschaft die Demokratie begünstige und diese den Frieden, dann wird übersehen, verkannt oder verleugnet, dass eine kapitalistische Marktwirtschaft keineswegs eine Demokratie erfordert, wohl aber einen Staat.
Aber was ist überhaupt der Staat? Diese Frage führt zunächst zu einer Betrachtung seiner historischen Entstehung und Entwicklung. In welchem Verhältnis steht der Staat zur Ökonomie einerseits und zur Demokratie andererseits? Wie wirken sich in der Ära der „Globalisierung“ die ökonomischen und politischen Veränderungen auf die Demokratie aus? Welche politischen Risiken bestehen, und wie kann ihnen begegnet werden? Es sind diese Fragen, die hier besonders interessieren.
2 Gesellschaft und Staat in der europäischen Geschichte
2.1 Feudale Gesellschaft
Die bürgerliche Gesellschaft ist aus einer inneren Selbsttransformation der historisch älteren, auf die Fronhofswirtschaft zentrierte und dabei auf der bäuerlichen Leibeigenschaft aufbauende, politisch dezentralisierten Feudalgesellschaft sowie der nachfolgenden Ständegesellschaft hervorgegangen. (Krieser 1990; Hoffmann 2000)
Die Feudalgesellschaft entwickelte sich über einen Zeitraum von etwa 1000 Jahren ausschließlich in Westeuropa, und zwar etwa ab Mitte des ersten Jahrtausends (500 n. Chr.) auf der Grundlage des politischen Zerfalls des weströmischen Reiches. Germanische Stämme überschichteten die weströmischen Gesellschaften und passten sich zugleich weitgehend an deren spätantike römisch-christliche kulturelle Tradition an. Durch die offensive Christianisierung auch anderer europäischer Gebiete wurden auch diese an die spätantiken Traditionen angeschlossen. Weil damit aber die Feudalisierung, d. h. die Einführung des Lehenssystems mit persönlicher Unfreiheit der unmittelbaren Produzenten in Form der Leibeigenschaft und in Kombination mit einer feudalen und klerikalen Hierarchie direkter Herrschaft verbunden war, lief dies nur gegen Widerstände ab, z. B. der Sachsen unter Widukind gegen das Karolingische Reich.
Die Feudalgesellschaft beruhte politisch-strukturell auf prekären, wechselseitig-vertikalen Loyalitätsbeziehungen zwischen den persönlichen Trägern der gesellschaftlichen Herrschaft. Störungen dieser Loyalitäten wurden immer wieder zur Quelle von Konflikten innerhalb des Adels einschließlich der hohen Geistlichkeit. Ein typisches Beispiel hierfür ist der Konflikt des Welfen Heinrich des Löwen mit dem deutschen Kaiser Friedrich I. Barbarossa; aber auch die Königsdramen Shakespeares reflektieren dieses strukturelle Problem des Feudalismus. Hinzu traten zusätzlich horizontale Konflikte zwischen Mitgliedern der feudalen Hierarchie. Diese innere Widersprüchlichkeit und Instabilität des feudalen Herrschaftsgefüges tendierte daher im Grenzfall zur „feudalen Anarchie“, deren Überwindung erst – mit dem Übergang zur „ständischen Gesellschaft“ – durch den Absolutismus erfolgte.
Die sozioökonomische Voraussetzungen des Absolutismus waren insbesondere die Entwicklung des Fernhandels mit Luxuswaren für die adlige und geistliche Oberschicht, die Herausbildung der „freien“ mittelalterlichen Städte durch Handwerk und Handel, in denen sich das Bürgertum herausbildete, z. B. der Städtebund der Hanse, die allenthalben ansteigende Produktivität und damit der Anstieg der gesellschaftlichen Produktion und des gesellschaftlichen Überschusses, d. h. des Mehrprodukts, sowie der besonders wichtige Übergang von der Natural- zur Geldwirtschaft, d. h. zum auf Märkten regelmäßig durch (Silber-) Geld vermittelten Gütertausch: also zur „einfachen Warenzirkulation“ (Motteck 1973).
2.2 Ständische Gesellschaft
Mit dem Beginn der Neuzeit, der mit dem ökonomisch motivierten maritimen Ausbruch der Europäer aus ihrer geographischen Isolation durch Portugal – gefolgt von Spanien – einsetzte und sofort in Eroberungen mündete (Mittel- und Südamerika) wurde nun einerseits immer mehr Geld in Form von Edelmetallen benötigt – und durch Raub angeeignet (Galeano 1980), andererseits boten dieses Gold und Silber als Geld innovative Möglichkeiten. Es wurden damit stehende Heere ebenso wie eine neuartige, mit Personen aus dem Bürgertum besetzte Verwaltungsbürokratie unter zentralem, absolutistischem Kommando ermöglicht, die wiederum die Machtzentrale von den dezentralen Machtzentren unabhängig machte und damit zugleich deren Entmachtung ermöglichte. Dieser Machtverlust wurde jedoch für den Adel erträglich gestaltet, indem die alten feudalen Rechte in eine zentral abgesicherte Privilegienstruktur übergeleitet wurden. Das typische Beispiel hierfür ist Frankreich unter Ludwig dem XIV. In Deutschland lief später ein ähnlicher Prozess auf der mittleren Ebene des Adels, jener der Landesfürsten, ab – z. B. in Brandenburg / Preußen. (Anderson 1979)
 Diese ständische Gesellschaft, die geistig-kulturell bereits der Neuzeit angehört, war nicht mehr feudal, sondern „postfeudal“, und sie war noch nicht bürgerlich, sondern „protobürgerlich“. In dieser Gesellschaft, deren Privilegiensystem – ein System rechtlicher Ungleichheit – ein Erbe des Feudalismus war, wurden aber gleichwohl alle Voraussetzungen entwickelt, die zur Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaft führen sollten.
Diese ständische Gesellschaft, die geistig-kulturell bereits der Neuzeit angehört, war nicht mehr feudal, sondern „postfeudal“, und sie war noch nicht bürgerlich, sondern „protobürgerlich“. In dieser Gesellschaft, deren Privilegiensystem – ein System rechtlicher Ungleichheit – ein Erbe des Feudalismus war, wurden aber gleichwohl alle Voraussetzungen entwickelt, die zur Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaft führen sollten.
In soziopolitischer Hinsicht sind einerseits die mehr oder weniger gewaltförmige Umwandlung der Kleinbauern in die eigentumslose Lohnarbeiterschaft, in ökonomischer Hinsicht die Entwicklung des Handwerks zu kaufmännisch geführten Verlagen und Manufakturen, aus denen später die mechanisierten Fabriken hervorgehen sollten (Marx 1890 [1972] ), andererseits die vermittelten und vermittelnden Wandlungen des gesellschaftlichen Bewusstseins, bezeichnet durch Renaissance und Protestantismus sowie den Neuansatz der Philosophie und der Wissenschaften von Bedeutung. Hierdurch wurde die Ablösung von der mittelalterlichen Geisteswelt eingeleitet und vollzogen. Die postfeudale gesellschaftliche Totalität wandelte sich allmählich um in eine neue, eine bürgerliche. Durch diesen Wandel schuf sich das aufsteigende, in den Städten ansässige Bürgertum die Voraussetzungen für seine spätere gesellschaftliche Führungsrolle.
Die Dialektik der merkantilistischen Wirtschaftspolitik des absolutistischen Staates bestand darin, dass sie einerseits nur zur Förderung des Reichtums des Monarchen bzw. Fürsten dienen sollte, dazu aber alles tun musste, um die Wirtschaft des Landes, also Landwirtschaft, Handwerk, Gewerbe, Transportwesen usw. zu fördern – damit aber zwangsläufig zugleich den Reichtum des städtischen Bürgertums, und eben dadurch wurde dieses befähigt, zu gegebener Zeit die Machtfrage zu stellen.
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts setzte in England die Industrielle Revolution ein, die einen schnellen, tiefgehenden und anhaltenden gesellschaftlichen Wandel ausgelöst hat. Erst als diese Prozesse evolutionär bereits weit fortgeschritten waren, kam es gelegentlich auch zu sozialen Revolutionen, die die bürgerliche Gesellschaft dann endgültig durchsetzten. Der typische Fall ist wiederum Frankreich (1789 und die Napoleonische Ära).
2.3 Ökonomisches System und bürgerlicher Staat
Das auf individuellem Privateigentum an Kapital beruhende, daher durch Privatinteressen und Wettbewerb bestimmte ökonomische System der bürgerlichen Gesellschaft soll aus Sicht der bürgerlichen Theorie zwar durch Bildung eines Systems von stabilen Gleichgewichtspreisen auf allen Märkten über selbstregulative Marktmechanismen verfügen, bleibt aber aufgrund seiner methodisch ausgeblendeten sozialen Klassenstruktur, die die ökonomische Verteilung der Vermögen und Einkommen bestimmt, in sich widersprüchlich und erzeugt daher ökonomische und soziale Krisen.
Der Wettbewerb ist in der bürgerlichen Gesellschaft wegen der Interessenskonflikte der Privateigentümer einerseits unvermeidlich, andererseits ist er aus Sicht der bürgerlichen Theorie auch notwendig, weil er wirtschaftliche Dynamik zur Folge haben soll. Er erfordert aber eine wirksame und allgemein gültige Beschränkung, denn deren Fehlen würde „den Krieg aller gegen alle“, also den destruktiven „Naturzustand“ im Sinn von Thomas Hobbes mit sich bringen – und damit letztlich die Ökonomie überhaupt unmöglich machen: denn die Bürger können nur dann ihren Geschäften nachgehen, wenn Recht und Ordnung herrschen, wenn also ein normativ und zugleich faktisch gesicherter, verlässlicher gesellschaftlicher Normalzustand besteht.
Dies gilt nicht nur im Hinblick auf die Austauschprozesse auf den Güter- und Finanzmärkten, sondern mehr noch im Hinblick auf den Arbeitsmarkt und die Arbeitskontrakte, auf deren Einhaltung (wegen des Interesses an der maximalen Nutzung des Gebrauchswerts der Arbeitskraft) unbedingt bestanden werden muss, weil hiervon die Wertschöpfung abhängig ist. Daher wurde gegen die frühen Streiks der Arbeiter umgehend die staatliche Gewalt mobilisiert, und daher auch ist das demokratisch gegen den bürgerlichen Staat und seine Gesellschaft durchgesetzte Streikrecht der Arbeiter für diese eine so zentrale Errungenschaft.
Die Ökonomie erfordert also sowohl aus Sicht der Marktprozesse und der Konkurrenz wie aus Sicht der Produktion (d. h. der Wertschöpfung) das Recht, aber dieses Rechtssystem „muss Zähne haben“: es muss wirklich gelten, muss also mittels einer Justiz durchsetzbar sein, in letzter Instanz eben auch mittels legaler physischer Gewalt (Polizeigewalt).
Notwendig ist somit ein das Recht garantierender „Gewaltmonopolist“ außerhalb der Konkurrenz und daher mit gleicher Geltung gegen alle Bürger: eben der bürgerliche Staat. Er erscheint als eine mit der bürgerlichen Gesellschaft nicht-identische, gesonderte Institution, als Rechtsstaat, der sich neutral gegenüber den gesellschaftlichen Individuen verhält, d.h. sie rechtlich als Gleiche behandelt. Und diese selbst nicht-ökonomische Instanz kodifiziert die Regeln, die für die Ökonomie erforderlich sind (z. B. Vertragsrecht), und nur sie ist in der Lage, deren Gültigkeit zu garantieren; eben deshalb ist sie für die Ökonomie in einer konstitutiven Art und Weise notwendig.
Nachdem infolge des I. Weltkrieges die Ära der Goldwährung (d. h. Umlauf von Edelmetallmünzen oder durch Edelmetalle „gedecktes“ Geld) zu Ende ging, trat die staatliche Garantie des Papiergeldes (Geldmengensteuerung) durch eine Notenbank an die Stelle der natürlichen Edelmetallknappheit, ergänzt durch die Kriminalisierung der Geldfälschung und – nach den Erfahrungen mit den kriegsfinanzierungsbedingten Inflationen – eine Politik der Geldwertstabilität. Mit der Institution der Zentralbank (Bundesbank bzw. Europäische Zentralbank) und der ergänzenden Regulierung des Bankensystems ist seither der Staat innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft als ebenso zentraler wie privilegierter ökonomischer Akteur permanent präsent.
Die Ökonomie braucht den Rechtsstaat, ohne ihn ist sie dauerhaft gar nicht möglich, aber umgekehrt gilt ebenso, dass der bürgerliche Staat die private Ökonomie benötigt, denn er muss sich finanzieren und nutzt dazu ihre Quellen, indem er, nun gerade nicht mittels des Äquivalententausches, sondern mittels des gegenteiligen Prinzips, der Steuern – die im Grunde eine legale Form der Aneignung bzw. Enteignung sind – diejenigen Mittel abschöpft, die der Staat für seine Aufgaben, deren Erfüllung der bürgerlichen Gesellschaft dient, benötigt. An diesen Sachverhalt, also an die scheinbare Enteignung durch staatliche Besteuerung und an die Furcht vor dem staatlichen Gewaltmonopol knüpft sich das auffällig ambivalente Verhältnis der liberal gesonnenen Bürger zur Besteuerung im Besonderen, aber auch zum Staat im Allgemeinen.
Im Falle des Nationalsozialismus, in dem der Rechtsstaat in den Gewaltstaat umschlug und dadurch totalitär wurde, hat sich diese Furcht als berechtigt erwiesen. Der totalitäre Gewaltstaat ordnete sich durch seine Exponenten Gesellschaft und Ökonomie unter. Die Märkte büßten ihre koordinierende Funktion zugunsten einer kriegswirtschaftlichen Planung ein. Nach dem zweiten Weltkrieg stellte sich daher die Aufgabe einer liberalen Rekonstruktion der bürgerlichen Gesellschaft, die hauptsächlich aufgrund des amerikanischen „Marshall – Plans“ gelang.
Die fundamentale ökonomische Abhängigkeit des bürgerlichen Staates von der privat- wirtschaftlichen Ökonomie zwingt ihn, sich der privatwirtschaftlichen Funktionslogik – d. h. den Anforderungen seitens der Kapitalverwertung – prinzipiell unterzuordnen, d. h. sich politisch an betriebswirtschaftlicher Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit zu orientieren. In der Sprache der angebotsorientierten Wirtschaftspolitik formuliert heißt dies, der Staat solle sich darauf beschränken, einen ausgeglichenen Haushalt anzustreben, die Geldpolitik einer unabhängigen Zentralbank zu überlassen, die öffentlichen Betriebe zu privatisieren und im Hinblick auf „die Wirtschaft“ für „günstige Rahmenbedingungen“ zu sorgen, insbesondere durch die Senkung von Steuern und Abgaben.
Es war, im Kontext der Weltwirtschaftskrise (1929 – 32), erst die 1936 mit der „Allgemeinen Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes“ erfolgte Entdeckung der makroökonomischen Kreislaufzusammenhänge durch John Maynard Keynes (Keynes 1936; [974] ), die dem Staat in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts die wirtschaftspolitische Möglichkeit eröffnete, insbesondere durch seine Fiskalpolitik eine – begrenzte – wirtschaftspolitische Lenkungsfunktion zu übernehmen, um die damalige weltwirtschaftliche Stagnation, ein „Gleichgewicht bei Unterbeschäftigung“ zu überwinden. Dieses kurzfristige Ziel dominierte, weil es unmittelbar um den Bestand der bürgerlichen Gesellschaft ging, während die langfristigen Überlegungen von Keynes im Hintergrund blieben; gerade sie verdienen heute besonderes Interesse.
Keynes´ trug als wirtschaftspolitischer Berater maßgeblich zur Etablierung des „Bretton Woods Systems“ bei, das nach dem 2. Weltkrieg die weltwirtschaftliche Expansion ermöglichte, aber in den 70er Jahren wegen der Finanzierung des Vietnam-Krieges erodierte, sowie der neuartigen „Stagflation“ (d. h. Stagnation und zugleich Inflation). Mit der schrittweisen Durchsetzung des Monetarismus (Milton Friedman, ab 1975), einer angebotsorientierten Wirtschaftspolitik und der Deregulierung der Finanz- und Gütermärkte („Globalisierung“) sind diese wirtschaftspolitischen Handlungsspielräume weitgehend wieder verlorengegangen.
2.4 Bürgerlicher Staat und Demokratie
Die bürgerliche Ökonomie braucht also das Recht und auch die das Recht garantierende Gewalt, sie braucht also den Staat, das Recht, die Justiz und die innere Staatsgewalt in Gestalt der Polizei, um ihren Bestand zu sichern. Und der Umstand, dass die Welt der Staaten sich trotz mancher supranationaler institutioneller Ansätze bis heute noch nicht wirklich aus dem „Naturzustand“ (Hobbes) herausgearbeitet hat, das es also noch kein allgemein verbindliches und zugleich wirksames, durchsetzbares Völkerrecht gibt, setzt die archaische Notwendigkeit, auch über ein äußeres Gewaltpotenzial in Gestalt des Militärs zu verfügen, das aber bis heute umgekehrt auch als Hindernis eines verbindlichen Völkerrechts erscheint, weil es eben auch ermöglicht, dieses zu brechen.
Der Staat, der als eine gesonderte Institution, oder als mit der bürgerlichen Gesellschaft nicht- identischer Rechtsstaat erscheint, ist als dialektischer Gegenpol des Verhältnisses von Kapital und Arbeit mit diesem zugleich identisch, wie die historische Entwicklung dieses Verhältnisses zeigt. Beide haben sich in engster Wechselwirkung – simultan und dynamisch – nicht nur miteinander, sondern auch durch einander widersprüchlich weiterentwickelt.
Es ist deshalb zwar nicht möglich, wie bereits die staatstheoretische Diskussion der 70er Jahre ergeben hatte, den Staat als Rechtsstaat und Gewaltmonopolist aus der „Logik des Werts“ ableiten, wie das für das ökonomische System möglich ist, aber da die Ökonomie ohne Staat sowenig bestehen kann wie auch umgekehrt, handelt es sich um eine Doppelstruktur wechselseitiger Bedingtheit und wechselseitiger Abhängigkeit, oder um eine Beziehung von Beziehungen.
Weil der bürgerliche Staat konstitutiv auf die sozioökonomische Struktur der bürgerlichen Gesellschaft – insbesondere ihre Eigentumsordnung – bezogen ist, kann er ihr gegenüber nicht „neutral“ sein. Als außerökonomische Seite des Kapitalverhältnisses, d. h. der dialektischen Beziehung von Kapital und Arbeit, ist der bürgerliche Staat normativer Garant der bürgerlichen Gesellschaft und zugleich selbst eine Beziehung, ein besonderes Feld gesellschaftlicher Konflikte (Poulantzas 2002).
Deshalb sind Staatseinnahmenpolitik (Steuerpolitik) und Staatsausgabenpolitik aufgrund der unterschiedlichen bis gegensätzlichen gesellschaftlichen Interessen stets umkämpft. Die schrittweise Herausbildung des (deutschen) Sozialstaats seit dem späten 19. Jahrhunderts und sein Rückbau seit Beginn des 21. Jahrhunderts zeigen, dass der Staat keine monolithische Institution, sondern ein umkämpftes besonderes Machtfeld ist, ähnlich der bürgerlichen Gesellschaft selbst (vgl. Müller/Neusüß 1971).
Unter den – keineswegs selbstverständlichen – Bedingungen einer politischen Demokratie verbessern sich für die abhängig Beschäftigten die Chancen, ihre Interessen zur Geltung zu bringen, und der demokratisierte bürgerliche Staat laviert deshalb beständig in dem Widerspruch, einerseits den Anforderungen seitens der Kapitalverwertung (d. h. „der Wirtschaft“) und andererseits den Interessen der abhängig Beschäftigten bzw. der beherrschten Wahlbürger und dem Anspruch demokratischer Führung zu entsprechen.
Die Dialektik von Gewalt und Recht hat den bürgerlichen Staat konstituiert: denn einerseits geht die Gewalt dem Recht vor, indem erst durch sie reale Machtverhältnisse geschaffen wurden, die um einer notwendigen Ordnung willen in ihr Gegenteil, das positive Recht umschlagen müssen, das aber wiederum, weil es faktisch gelten muss, auf die legale Gewalt als „letztes Mittel“ nicht verzichten kann.
Diese primäre Funktion des Staates, den Bestand der bürgerlichen Gesellschaft, d.h. im Kern das Kapitalverhältnis, d.h. den Bestand des Verhältnisses bzw. der dialektischen Beziehung von Kapital und Arbeit sowie die Konkurrenzbeziehungen normativ und auch praktisch zu garantieren, wird ergänzt durch die sekundäre Funktion, die sich innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft aus dem „Marktversagen“ ergibt. Dieses Marktversagen resultiert zum einen aus den Konkurrenzverhältnissen, die bedingen, dass nur direkt profitable Investitionen privat getätigt werden können. Notwendige, aber nur indirekt profitable Investitionen (in die sogenannte „Infrastruktur“) müssen daher, wenn sie nicht zum Schaden der Ökonomie ganz unterbleiben, vom bürgerlichen Staat getätigt und über Steuern finanziert werden.
Das Marktversagen ergibt sich zum anderen aus dem Umstand, dass der soziale Klassencharakter der bürgerlichen Gesellschaft zu sehr ungleichen Verteilungsverhältnissen führt, aus denen sich wiederum sozioökonomische Spannungen und ökonomische Krisen ergeben.
Unter solchen Umständen ist die gesellschaftliche Reproduktion zwar nicht zu jedem Zeitpunkt, wohl aber strukturell gefährdet, und diese Gefährdung erhöht die soziale Spannung innerhalb der sozialen Struktur der bürgerlichen Gesellschaft sowie zwischen ihr und dem bürgerlichen Staat, dem daher die Aufgabe der korrigierenden sozioökonomischen Stabilisierung zufällt (in Deutschland z.B. durch den Aufbau des „Sozialstaats“, durch den sehr lange erfolgreich soziale Spannungen reduziert und auch ökonomischen Ungleich- gewichten entgegengewirkt werden konnte).
Dies gewährleistet allerdings nicht, dass der bürgerliche Staat mit seinen Mitteln, dem Geld und dem Recht, diese funktionale Kompensation durchwegs auch zu leisten imstande ist. Im Gegenteil: durch „Staatsversagen“ kann das Marktversagen noch vertieft werden.
Insofern aber der bürgerliche Staat, sofern er demokratisch strukturiert ist, tatsächlich beansprucht oder suggeriert, er sei zur Kompensation oder Steuerung des Marktversagens grundsätzlich in der Lage, bringt ihn das Staatsversagen, das sich aus der Begrenztheit seiner Möglichkeiten ergibt, dadurch in zusätzliche Schwierigkeiten, dass er der übernommenen Verantwortung faktisch nicht oder nur eingeschränkt gerecht werden kann. Würden nun aber diese tatsächlich begrenzten Möglichkeiten zur Kompensation des Marktversagens offen eingeräumt, dann könnte sich das als Delegitimation des ökonomischen Systems auswirken. Aufgrund dieses Dilemmas ist die Demokratie für den bürgerlichen Staat durchaus problematisch.
Die neuzeitliche Demokratie ist denn auch für den bürgerlichen Staat weder konstitutiv gewesen, noch die Verwirklichung eines idealistischen politischen Konzepts, sondern sie hat sich aus inneren ständegesellschaftlichen Konflikten bis hin zu politischen und sozialen Revolutionen entwickelt.
In der Französischen Revolution trat beispielsweise zunächst das Bürgertum auf, als sei es das gesellschaftliche Ganze, indem es die funktionslos gewordenen Stände (Adel und Klerus) entprivilegierte, die Funktion des Monarchen aufhob und durch ein besitzbürgerliches Parlament ersetzte. Nach der gelungenen bürgerlichen Emanzipation geriet aber schnell die „Soziale Frage“, d.h. die Emanzipation des „Vierten Standes“ – oder der Arbeiterklasse – in den Brennpunkt der sozialen Auseinandersetzungen. Allgemeines Wahlrecht und Gleichberechtigung, Streikrecht und der Anspruch auf Existenzsicherheit (im Hinblick auf die Lebensrisiken Unfall, Krankheit, Alter, Arbeitslosigkeit), die Wahl der Regierung durch das Parlament, später auch die Demokratisierung der Wirtschaft (Naphtali 1977; Huber/Kosta 1978) waren daher die legitimen Forderungen.
Die bürgerliche Demokratie war demnach zunächst keineswegs offen gegenüber dem „Vierten Stand“ bzw. der Arbeiterklasse. Diese musste ihre diesbezügliche politische Gleichberechtigung vielmehr in jahrzehntelangen sozialen Kämpfen gegen staatliche Unterdrückung erst durchsetzen. Erst durch die Novemberrevolution 1918 erreichte die Arbeiterklasse zumindest im Prinzip ihre „Anerkennung als menschliches Subjekt“ in Gesellschaft und Staat (Verfassung der Weimarer Republik).
Die relative Stabilität der Demokratie erklärt sich daraus, dass unter normalen ökonomischen Reproduktionsbedingungen die Verfahren demokratischer Willensbildung für die Ökonomie durchaus funktional, d. h. mit dem Ergebnis der Befriedung und der Zustimmung, ausgestaltet werden können; denn der Staat unterliegt der Notwendigkeit, sein Handeln mit den politischen Bedürfnissen der Staatsbürger so zu vermitteln, dass für die strukturell ungleich bleibende Verteilung der Vermögen und der Einkommen Legitimation, d. h. Zustimmung oder Duldung erreicht werden kann.
In Zeiten ökonomischer Krisen aber erweist sich die demokratische Willenbildung als nicht länger funktional für die Privatökonomie – ganz im Gegenteil. Die politische Demokratie gerät dann unter Druck, wird tendenziell eingeschränkt und ausgehöhlt, oder, wie 1933, ganz beseitigt, um eine gesellschaftliche Transformation der bürgerlichen Gesellschaft zu verhindern. Die Demokratie muss daher von den demokratischen Staatsbürgern nicht nur erkämpft, sondern sie muss auch bewahrt werden – und vor dieser politischen Aufgabe stehen wir heute.
Die Beziehung zwischen der Bindung des bürgerlichen Rechtsstaates an das Kapitalverhältnis einerseits und seiner Bindung an den ihn fundierenden demokratischen Prozess andererseits ist aber deshalb asymmetrisch, weil sich die demokratische Willensbildung, auch soweit sie politische Konzessionsspielräume gegen das Kapital erweitern konnte, z.B. in Form der deutschen Mitbestimmung, strukturell der Dialektik von Staat und Kapitalverhältnis untergeordnet bleibt.
3 Bürgerlicher Staat und Wirtschaftspolitik
3. 1 Geschichte der Wirtschaftspolitik
Die Weltwirtschaftskrise ab 1929 war nicht nur eine der mehr oder weniger regelmäßig auftretenden konjunkturellen Krisen, sondern sie trug deutlich die Züge eines systemischen Zusammenbruchs. Dieser drückte sich zugleich sozioökonomisch, politisch und mental aus, insbesondere aber im Zerfall des Weltmarkts (James 2005). Unter diesen Voraussetzungen konnte in Deutschland der Rechtsstaat in den NS-Gewaltstaat umschlagen, welcher sich das gesellschaftliche Ganze unterordnen konnte: Abschaffung der Demokratie und der bürgerlicher Freiheiten, Zerschlagung der Arbeiterbewegung, Militarismus, Krieg, Rassenwahn, Auschwitz. (Neumann 1984).
Die reale Krise war aber auch die Grundlage für die Suche nach vernünftigen Auswegen. Keynes außerordentliche Leistung, die ihn zum mit Abstand bedeutendsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts machte, bestand darin, auf Grundlage einer Kritik der neoklassischen Gleichgewichtstheorie eine makroökonomische Kreislauftheorie zu entwickeln, die es ermöglichte, die Krise zu diagnostizieren und die Ansatzpunkte und Handlungsspielräume der staatlichen Wirtschaftspolitik neu zu bestimmen. Kurzfristig dachte Keynes hier an die Steigerung der „effektiven Nachfrage“ durch „deficit spending“, und langfristig an die „Sozialisierung der Investition“. Neu daran war nicht nur die Erkenntnis der Relevanz der „effektiven Nachfrage“, sondern mehr noch die Einsicht in eine makroökonomische Rationalität, die der mikroökonomischen Rationalität der Neoklassik ebenso wie der Rationalität der Betriebswirtschaftlehre übergeordnet ist. Im übergeordneten gesamtwirtschaftlichen Kreislaufzusammenhang gelten danach spezifisch makroökonomische Gesetzmäßigkeiten, die den unmittelbaren Erfahrungen der Wirtschaftssubjekte nicht und ihrer individuellen Handlungslogik nur teilweise entsprechen (Keynes 1936; Bofinger 2005).
Aus Keynes Einsicht in die Beschränktheit einer funktionsfähigen Selbststeuerung der Marktwirtschaft, in diesem Sinne also in das fundamentale Marktversagen, folgt die Notwendigkeit der Lenkung, die nur vom bürgerlichen Staat kommen kann. Dieser muss dazu die Geld- und Fiskalpolitik für eine indirekte Wirtschaftslenkung instrumentalisieren. Die so gelockerte Abhängigkeit des Staates von der Privatökonomie ruft allerdings deren Unbehagen ebenso hervor wie der Anspruch des Staates, gegenüber der privaten Ökonomie, wenn auch in deren Interesse, eine übergeordnete wirtschaftspolitische Lenkungsfunktion zu übernehmen (Hödl 1986).
Im Verlauf der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts begannen sich die institutionellen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen einer keynesianischen Wirtschaftspolitik, das Bretton – Woods – System, aufzulösen: maßgeblich waren hier der nicht zuletzt durch die Finanzierung des Vietnamkrieges bedingte währungspolitische Übergang zu einem System freier Wechselkurse und die auch durch die Vorherrschaft oligopolistischer, d. h. durch relativ wenige marktmächtige Großunternehmungen bestimmten Marktformen bedingte Heraus- bildung einer „Stagflation“, d.h. durch das unerwartete neuartige gleichzeitige Auftreten von Stagnation und Inflation.
Dieses Problem wurde in Verbindung mit den theoretischen Arbeiten Milton Friedmans zum praktischen Ausgangspunkt der „monetaristischen Konterrevolution“. Das Vordringen des „Monetarismus“ brachte die Anerkennung der neoklassischen Gleichgewichtstheorie zurück, die in Kombination mit der neoliberalen Wettbewerbstheorie (F. A. von Hayek) und der monetaristischen Geldpolitik als sogenannte „Angebotstheorie“ wirtschaftspolitisch dominant wurde.
Nach einer ca. fünfundzwanzigjährigen Praxis dieser angebots- und wettbewerbsorientierten Wirtschaftspolitik ist allerdings in Deutschland die Arbeitslosigkeit im Februar 2005 auf über 5 Millionen angestiegen, und das gesamtwirtschaftliche Wachstum ist nach wie vor so schwach, dass eine spürbar ansteigende Beschäftigung nicht erwartet werden kann, insbesondere weil das Investitionsverhalten auf immer wieder deutlich verbesserte steuerpolitische und rechtliche Rahmenbedingungen nicht positiv reagiert. Damit wiederum gerät das Problem der schwachen Binnennachfrage ins Zentrum der Überlegungen (Bofinger 2005, S. 225 ff.).
Die in der Praxis nachhaltig gescheiterte „Angebotspolitik“ wird paradoxerweise und interessebedingt dennoch nicht mit einem konzeptionellen wirtschaftspolitischen Wechsel beantwortet, sondern damit, dass weiterhin sogar eine vertiefte und erweiterte Angebotspolitik erforderlich sei. Allerdings verliert diese dogmatische Haltung trotz medialer Multiplikation zunehmend an Glaubwürdigkeit auch in einer breiteren Öffentlichkeit. Erste Ansätze eines grundlegenden Wandels sind erkennbar. Denn unübersehbar und unmittelbar erfahrbar ist, dass die versprochenen Erfolge immer wieder ausgeblieben sind. Auch deshalb ist der Boden für ein alternatives wirtschaftspolitisches Konzept bereitet. Zu lösen wäre in dessen Rahmen zunächst die teilweise wohl noch offene Frage, wie eine an die aktuellen weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen angepasste erneuerte makroökonomische Wirtschaftspolitik konkret auszugestalten wäre und wo genau deren Grenzen liegen.
3.2 Weltmarkt, Globalisierung und bürgerlicher Staat
Als Weltmarkt wurde traditionell die Gesamtheit der externen Austauschbeziehungen der Volkswirtschaften (Importe und Exporte von Waren und Dienstleistungen sowie zugehörige Finanzströme) bezeichnet. Die „Globalisierung“ oder „Mondialisation“ soll demgegenüber etwas Neues darstellen (Conert 2002). Aus ökonomischer Sicht wird postuliert, dass sich, ausgehend von der Finanzsphäre, ein die Volkswirtschaften dominierender, politisch und kulturell „entbetteter“, völlig verselbständigter Weltmarkt gebildet habe, der von den ökonomischen Aktivitäten der transnationalen Unternehmungen, den „global players“ getragen werde und dem zwar verschiedene supranationale Institutionen – Weltbank, Internationaler Währungsfonds, Welthandelsorganisation – aber kein bürgerlicher Staat gegenüber stünden.
Insbesondere der vereinheitlichte Weltfinanzmarkt gebe faktisch die maßgeblichen ökonomischen Entscheidungskriterien vor, der sich die Volkswirtschaften, die Unternehmungen und auch die Staaten zu beugen hätten. Die nationalen bürgerlichen Staaten seien geschwächt, der Weltökonomie untergeordnet und zum betriebswirtschaftlich orientierten „Wettbewerbsstaat“ transformiert worden. Wenn selbst rentable Unternehmen geschlossen und verlagert werden, weil andernorts eine noch höhere Rentabilität erwartet werde, dann müsse dies hingenommen werden.
Eine staatliche Lenkungsfunktion im keynesianischen Sinne sei nicht mehr denkbar. Einzig möglich sei nur noch die Herstellung wettbewerbsfähiger Rahmenbedingungen. Es gebe, und zwar unabhängig von der Frage, ob dies vernünftig sei oder nicht, nur noch eine einzige Möglichkeit, nämlich sich zu bemühen, in diesem weltweiten Wettbewerb möglichst erfolgreich zu werden.
Und dies ist tatsächlich das Credo der aktuellen Politik in Deutschland, sowohl seitens der traditionellen bürgerlichen Parteien als auch der derzeitigen Regierungsparteien, der Sozialdemokratie und der Grünen. Nuancierungen gibt es zwar, aber diese sind von nur begrenzter Bedeutung, und sie werden oft in irreführender Weise parteipolitisch aufgebläht.
Wesentliches Ergebnis dieser Entwicklung ist, dass den Wählern eine wirkliche inhaltliche Wahlalternative fehlt; sie quittieren das weitestgehend ohne Verständnis und reagieren mit Frustration, Ratlosigkeit, Wahlenthaltung, oder mit Protestwahlverhalten. Kaum verhüllte Rat- und Hilflosigkeit ist aber allem Anschein nach quer durch die Parteien weit verbreitet; und es ist dies nicht das unbedeutendste Moment der politischen Krise.
Als eine der Alternativen wird seit langem gefordert, diesen Prozess der durch ökonomische Globalisierung bedingten Schwächung des bürgerlichen Staates rückgängig zu machen und/oder ihm auf einer höheren Ebene, etwa der der Europäischen Union, zu begegnen. Durch „Re-Regulierung“, die die tendenzielle Weiterentwicklung der EU zu einem Bundesstaat voraussetzt, wäre aus dieser Sicht der Versuch zu unternehmen, die Möglichkeiten der politischen Steuerung auf zentraler Ebene zurück zu gewinnen (Röttger 1997).
Allerdings geben die demokratischen Defizite der Europäischen Union in diesem Zusammenhang Anlass zur Skepsis. Wenn auch die Tatsache, dass nunmehr ein – mittlerweile wohl als gescheitert anzusehender – Verfassungsvertragsentwurf für die Europäische Union vorliegt (Winkler 2005), prinzipiell wohl positiv einzuschätzen ist, bleiben doch erhebliche Bedenken, einerseits wegen dessen einseitig neoliberaler Prägung, andererseits wegen der teilweise fehlenden Volksabstimmungen und damit der fehlenden Basislegitimation.
4. Die Strategie der Demokratisierung
In der heutigen Ära der „Dominanz der Vermögensbesitzer“, einer wirtschaftlichen Stagnation, einer dauerhaften Massenarbeitslosigkeit und der Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums von unten nach oben haben sich die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse so verändert, dass nicht nur ein Prozess der Reallohnsenkung und ein Rückbau des Sozialstaats vorangetrieben werden kann, sondern auch die Demokratie selbst unter Druck gerät. Denn der langfristig anhaltende Umverteilungsprozess von unten nach oben setzt tendenziell voraus, dass die betroffene große Minderheit oder sogar Mehrheit darin gehindert wird, eine demokratische Gegenmacht zu bilden, mit der dieser Prozess gestoppt werden könnte.
In Deutschland lässt sich empirisch feststellen, dass die Freiheitsrechte der Staatsbürger gegenüber dem Staat einem langfristigen Erosionsprozess unterliegen, und dieser Prozess wird durch jede neue, in der Regel durchaus reale Gefährdung der Sicherheitslage verstärkt, eine Tendenz, die besonders von linksliberaler Seite völlig zu Recht immer schon kritisch beobachtet und bekämpft worden ist (Probleme z.B.: Großer Lauschangriff; z. Zt. geplante Zusammenführung von Polizei und Geheimdienst).
Die Aushöhlung der staatsbürgerlichen Schutzrechte schafft, nicht unbedingt der Absicht nach, wohl aber faktisch die Voraussetzungen für einen erneuten Verlust der Demokratie, vielleicht in der Weise, dass die Demokratie zwar nominell noch bestehen bleiben mag, der Inhalt aber ersetzt sein wird durch eine ebenso elitäre wie autoritäre kapitalorientierte politische Herrschaft; die jüngere bildungspolitische Entwicklung mit ihrer charakteristischen Beseitigung der Partizipation in den Hochschulen deutet beispielsweise klar in diese Richtung (Buchholz/Hellweg/Schiller 2004).
Als anderes Beispiel mag uns der höchst bedenkliche derzeitige Zustand der italienischen Demokratie warnen, in der eine dubiose Parteienkonstellation unter Einschluss der Neofaschisten die Regierung stellt und sich im permanenten Konflikt mit der eigenen Justiz befindet: angesichts der Massenarbeitslosigkeit und der ökonomischen Stagnation handelt es sich hierbei um ein Menetekel auch für andere europäische Demokratien.
Wolfgang Reinhard (1999) schrieb hierzu: „Es wäre naiv, allein von einer „freiheitlich-demokratischen Grundordnung“ die definitive Überwindung des totalen Staates zu erwarten, zumal sie wahrscheinlich ohnehin nur eine weiche Variante des totalen Staates ist, weniger wegen personeller Kontinuitäten, als wegen der strukturellen Verwandtschaft dieser beiden Endstufen von 1000 Jahren Wachstum europäischer Staatsgewalt. Wie der allmähliche Abbau der verfassungsmäßigen Grundrechte in der Bundesrepublik Deutschland zeigt, sind sie auch beim demokratischen Staat, dem das Grundgesetz ihre Garantie anvertraut hat, keineswegs in den besten Händen. Möglicherweise wurde dabei sogar der Bock zum Gärtner gemacht, denn von Haus aus stammen die Grund- und Freiheitsrechte ja aus dem Widerstand gegen die Staatsgewalt. Was von dieser und ihren Juristen unter Umständen zu erwarten ist, schrieb Ernst Rudolf Huber 1937: „Es gibt keine persönliche, vorstaatliche und außerstaatliche Freiheit des Einzelnen, die vom Staat zu respektieren wäre“.“
Im Freiheitsinteresse, aber auch im ökonomischen Interesse der großen Mehrheit der Staatsbürger muss daher vor allem dieser Tendenz eines weiteren Substanzverlustes der Demokratie entgegengewirkt werden, indem zuerst Widerstand gegen die weitere Aushöhlung von Grundrechten geleistet wird, und sodann, indem die Funktionsweise der repräsentativen Demokratie basisdemokratisch reformiert wird, z. B. im Hinblick auf den abgehobenen Status der Abgeordneten und die verselbständigte Rolle der Parteien, das zu wenig basis- demokratische Wahlrecht und die Bewahrung der vorhandenen institutionellen Partizipationsrechte, insbesondere der Mitbestimmung. Es ist das Verdienst des Staatsrechtlers Hans Herbert von Arnim, hierzu in zahlreichen Publikationen Kritik vorgetragen und konkrete Vorschläge unterbreitet zu haben, an die jederzeit angeknüpft werden kann.
Voraussetzung für den Erfolg wird jedoch sein, dass der passive, sich überwiegend nur in Wahlenthaltung manifestierenden Widerstand des Wahlvolks in Lernprozesse und aktivere Formen des Widerstands übergeht. Gegen den medial vermittelten Schein der angeblichen Alternativlosigkeit der Politik müssen aber, um die Desorientierung und die Resignation zu überwinden und um populistische Risiken zu vermeiden, erst einmal neue und zukunftsfähige Wege der Politik öffentlich aufgezeigt werden.
Der bürgerliche Rechtsstaat muss nicht notwendigerweise auch ein demokratischer sein. Er wird vielmehr überhaupt nur demokratisch, oder er bleibt es, soweit der Anspruch auf Demokratie von der Bevölkerung in der politischen Praxis zur Geltung gebracht wird. Dieser fundamentale demokratische Gestaltungsanspruch muss, um eine fortschrittliche gesellschaftliche Entwicklung zu ermöglichen, nicht nur aufrechterhalten, sondern offensiv verfochten werden.
Perspektivisch gilt, dass die halbierte Demokratie weiterentwickelt werden muss, indem – entgegen der gegenwärtigen Tendenz – Demokratisierungsprozesse auf die gesamte Gesellschaft und auf alle ihre Ebenen ausgedehnt werden. Es geht erstens darum, der Tendenz zu einer autoritären Herrschaft, vielleicht in Gestalt eines „Verordnungstotalitarismus“, entgegen zu wirken, zweitens die Gesellschaft zu befähigen, den sie – zu ihrem materiellen und kulturellen Schaden – praktisch wie ideologisch beherrschenden Ökonomismus zu überwinden, und drittens einen Entwicklungspfad in Richtung auf den Abbau politischer, sozialer und ökonomischer Ungleichheit zu öffnen.
Danksagung
Mein Dank gilt Herrn Hans-Jürgen Driemel und Herrn Dr. Alfred Müller für ihre konstruktiv-kritische Begleitung und für ihre inhaltlichen Anregungen.
Literatur
- Anderson, Perry (1979), Die Entstehung des absolutistischen Staates, Frankfurt/Main Bofinger, Peter (2005), Wir sind besser, als wir glauben, München Buchholz/Hellweg/Schiller (2004), Geschichte der Fakultät Wirtschaft (Hildesheim) an der Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen, in: Jahrbuch 2005 des Landkreises Hildesheim, S.145 ff.
- Conert, Hansgeorg (2002), Vom Handelskapital zur Globalisierung, Münster, S. 340 ff. Galeano, Eduardo (1989), Die offenen Adern Lateinamerikas, 7. Aufl., S. 20 ff. Gerstenberger, Heide (1990), Die subjektlose Gewalt: Theorie der Entstehung bürgerlicher Staatsgewalt, Münster
- Hödl, Erich (1986), Der Staat in der keynes´schen Theorie, Wuppertal, Arbeitspapiere des FB Wirtschaftswissenschaft der Universität – Gesamthochschule Wuppertal, Nr. 101.
- Hoffmann, Jürgen (2000), Politisches Handeln und gesellschaftliche Struktur – Grundzüge deutscher Gesellschaftsgeschichte, 2. Aufl., Münster, S. 14 ff.; Hoffmann stützt sich auf Gerstenberger (1990).
- Huber, J./Kosta J.(1978), Wirtschaftsdemokratie in der Diskussion, Frankfurt/Main
- James, Harold (200), Der Rückfall, München
- Keynes, J. M. (1936 [1974] ), Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des
- Geldes, Berlin; vgl. zur langen Frist: Kap. 24
- Krieser, Hannes (1990), Gesellschaftsordnung, feudale, in: Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften, Bd. 2, Hg. Hans Jörg Sandkühler, Hamburg, S. 405 ff. Marx, Karl (1890 [1972] ), Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Erster Bd., 13. Kapitel., S. 391 ff.; 24. Kapitel, S. 741 ff.; vgl. ferner
- Marx, Karl / Engels, Friedrich (1974), Staatstheorie, Frankfurt/Main – Berlin – Wien Motteck, Hans (1973), Wirtschaftsgeschichte Deutschlands, Bd. 1, Berlin, S. 119 ff. Müller/Neusüß (1971), Die Sozialstaatsillusion und der Widerspruch von Lohnarbeit und Kapital, in: PROKLA, Juni 1971, S. 7 ff.
- Naphtali, F. (1928 [1977] ), Wirtschaftsdemokratie, 4. Aufl., Frankfurt/Main
- Neumann, Franz (1984), Behemoth – Struktur und Praxis des Nationalsozialismus 1933 – 44
- Poulantzas, Nicos (2002), Staatstheorie, Hamburg, S. 154 ff.
- Reinhard, Wolfgang (1999), Geschichte der Staatsgewalt, München, S. 479
- Röttger, Bernd (1997), Neoliberale Globalisierung und eurokapitalistische Regulation, Münster; ergänzend zur Entwicklung der Staaten der Peripherie: Zerfallende Staaten, Aus Politik und Zeitgeschichte(APuZ), Beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament“, 28-29/2005. Zu beobachten ist, dass sich in den Metropolregionen einzelne Staaten mehr oder weniger imperial etablieren und viele andere geschwächt werden, während zugleich Staaten der Peripherie vielfach sogar einem Zerfallsprozess unterliegen.
- Rotermundt, Rainer (1997), Staat und Politik, Münster, S. 174
- Winkler, H. A.,(2005): Grundlagenvertrag statt Verfassung, in Frankfurter Allgemeine
- Zeitung vom 18. Juni 2005, S. 8
Bildnachweis: Europäisches Parlament
Prof. Dr. Güter Buchholz, Jahrgang 1946, hat in Bremen und Wuppertal Wirtschaftswissenschaften studiert, Promotion in Wuppertal 1983 zum Dr. rer. oec., Berufstätigkeit als Senior Consultant, Prof. für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Consulting an der FH Hannover, Fakultät IV: Wirtschaft und Informatik, Abteilung Betriebswirtschaft. Seit 2011 emeritiert.