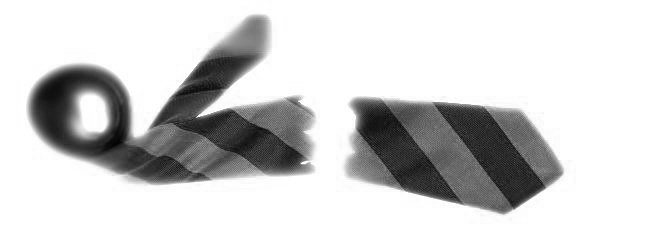#Aufschrei: Das Schweigen der Männer und vegane Schweinshaxen
Ich wollte ja immer schon einmal einen Text über „Gender Mainstreaming“ schreiben, hatte dabei aber das kleine Problem, dass ich auch nach langen Überlegungen und der Lektüre vieler Texte noch immer nicht so recht weiß, was das ist.
Also habe ich auf der Seite des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend nachgesehen, weil dort Gender Mainstreaming ja engagiert vorangetrieben wird, und festgestellt, dass das Ministerium auch nicht mehr weiß als ich. Doch dazu später.
Ich hätte mein Vorhaben also aufgegeben, wenn mich nicht einige Artikel, die in Zeitungen und Blogs zum einjährigen Aufschrei-Jubiläum erschienen sind, wieder daran erinnert hätten.
In der Süddeutschen Zeitung schreibt Lena Jakat beispielsweise über Frauen, die ihre „Erfahrungen über Alltagssexismus“ bei Twitter skizziert hätten:
„Sie sind sehr leise geworden, zum Schweigen gebracht von einer digitalen Front aus Aggression, die sich in den vergangenen Monaten bei Twitter aufgebaut hat. Dort schwappt dem Hashtag inzwischen so viel Hass entgegen, dass sich kaum noch jemand traut, ihn ernsthaft zu tippen. Dabei sollte das Schlagwort einst ebendiesen Hass bekämpfen.“
Jakat ist im vergangenen Jahr vermutlich ganz einfach nicht dazu gekommen, sich mit dem Thema, über das sie schreibt, näher zu beschäftigen. Sonst wäre ihr sicher aufgefallen, dass die „Erfahrungen über Alltagssexismus“ nur einen kleinen Teil der Aufschrei-Beiträge ausmachten, und dass es kein „Hass“ ist, wenn Männer sich darüber beschweren, dass ihre Erfahrungen mit anti-männlichem Sexismus in der Aufschrei-Kampagne geschlossen abgewehrt wurden.
Immerhin befindet sich Jakat damit in guter universitärer Gesellschaft – gerade hat schließlich auch die Osnabrücker Professorin Julia Becker in der Zeit deutlich gemacht, dass eine Aussage wie
„Wenn ständig über Diskriminierung von Frauen gesprochen wird, wird dabei die Diskriminierung von Männern vernachlässigt“
ausgesprochen sexistisch sei.
Zuvor hatte Hannah Beitzer ebenfalls in der Süddeutschen Zeitung freundlich eingeräumt: „Es gab Männer, die sich selbst im Alltag benachteiligt fühlten.“ Dass damit aber neben den unzähligen Frauen mit ihren realen Diskriminierungserfahrungen Männer mitmischen und sich auch einmal ein wenig diskriminiert füllen wollten, kann Beitzer natürlich nicht unkommentiert stehen lassen. Sie ist sich sicher, dass sich
„hier vor einem Jahr etwas entlud, das sich schon eine ganze Weile angebahnt hatte – nämlich die Unzufriedenheit darüber, dass Männer und Frauen in Deutschland noch immer nicht wirklich gleichberechtigt sind. Immer noch verdienen Frauen im Schnitt 22 Prozent weniger als Männer, immer noch ist ein Großteil der Führungspositionen in der Wirtschaft von Männern besetzt, während Frauen sich häufiger und intensiver als ihre Partner um Haushalt und Kindererziehung kümmern.“
Diskriminiert sein, bitteschön, ist Frauensache.
Das Schweigen der Männer, oder: Haben Männer eigentlich irgendwelche Gründe, aufzuschreien?
Es interessiert Beitzer nicht allzusehr, dass der Artikel, den sie zum Beleg ihrer „22 Prozent“-Angabe verlinkt, schon selbst klarstellt:
„Bei vergleichbarer Tätigkeit und Ausbildung reduziert sich der Unterschied allerdings auf rund acht Prozent, wie aus der vorhergehenden Erhebung zur Verdienststruktur im Jahr 2006 hervorging.“
Wer wiederum in dieser Erhebung nachliest, erfährt schon auf der ersten Seite nach dem Inhaltsverzeichnis, dass dieser Wert eine „Obergrenze“ ist und geringer ausgefallen wäre,
„wenn der Berechnung weitere lohnrelevante Eigenschaften – vor allem Angaben zu Erwerbsunterbrechungen – zur Verfügung gestanden hätten.“
Das ist schon so lange bekannt, dass sicherlich auch eine SZ-Journalistin irgendwann einmal davon gehört hat: Je ähnlicher die verglichenen Tätigkeiten von Männern und Frauen tatsächlich sind, desto mehr verschwindet der „Gender Pay Gap“.
Was aber wäre eigentlich, wenn Männer die Diskussion einmal umdrehen würden und statt des Versuchs, zum fünfhundertsten Mal die auch Beitzer und anderen schon längst bekannnte Haltlosigkeit des „Gender Pay Gap“-Geredes nachzuweisen, entschlossener die Frage stellen würden, warum Frauen eigentlich immer noch so viel weniger als Männer zum Bruttosozialprodukt und zum allgemeinen Steuereinkommen (hier, gleich auf S. 1) beitragen? Was wäre wohl, wenn sich auch hier der Staat verpflichtet fühlte, für „Gleichstellung“ zu sorgen?
Ich habe neulich eine sehr kurze, schnell abgebrochene Diskussion erlebt, in der Kollegen darüber redeten, wie sehr der hohe Anteil von Kolleginnen im Mutterschutz die Ressourcen des Kollegiums insgesamt belasten würden. Eine Frau fragte daraufhin scharf, ob denn wohl Frauen nicht mehr eingestellt werden sollten – und die Diskussion war beendet. Nur einer sagte noch leise, dass er den Eindruck habe, es gäbe auch so etwas wie eine Flucht in die Schwangerschaft, dass darüber aber nicht laut geredet werden dürfe.
Niemand hatte verlangt, dass eine Frau nicht eingestellt werden oder dass der Mutterschutz abgeschafft werden sollte. Die Unzufriedenheit, die sich erst sehr kurz offen und dann, nach der erwartbaren Zurechtweisung, nur noch grummelnd äußerte, basierte vielmehr darauf, dass der Preis dafür ebenso wenig wahrgenommen wird wie diejenigen, die ihn zahlen. Denn zu leistende Arbeit löst sich schließlich nicht plötzlich in Luft auf, wenn die Gründe, von ihr fernzubleiben, gute Gründe sind – dass die Arbeit von irgendjemandem zusätzlich übernommen werden muss, wird mit erstaunlicher Selbstverständlichkeit übersehen.
Das Einspringen für andere wäre wohl ein wesentlich geringeres Problem, wenn dieser zum großen Teil von Männern geleistete Anteil überhaupt als Leistung wahrgenommen und nicht als Diskriminierung von Frauen präsentiert würde. Das gilt keineswegs nur für den Mutterschutz: Laut DAK Gesundheitsreport ist der Krankenstand bei Frauen in fast allen Lebensaltern, außer bei den ganz Jungen, deutlich höher als bei Männern (S. 13). Was wird denn hier eigentlich für „Gleichstellung“ getan?
Als es aber darum ging, für Versicherungen – und das hat gerade für Krankenversicherungen große Konsequenzen – Unisex-Tarife einzuführen, stellte die Generalanwältin Juliane Kokott in ihrem Schlussplädoyer vor dem Europäischen Gerichtshof klar, eine „unmittelbare Ungleichbehandlung“ von Männern und Frauen sei nicht zulässig,
„wenn Versicherungsprämien und -leistungen allein oder jedenfalls maßgeblich unter Zugrundelegung von Statistiken für Männer und Frauen unterschiedlich berechnet werden.“ (Absatz 60/61)
Im Klartext: Bloß statistische Ungleichheiten würden keine Ungleichbehandlung ganzer Gruppen rechtfertigen.
Ein wesentlicher Hintergrund war die Praxis von privaten Krankenversicherungen, von Frauen deutlich höhere Tarife zu fordern als von Männern, da das Risiko der Versicherungen bei Frauen – aufgrund ihrer höheren Lebenserwartung und den auch damit verbundenen höheren Kosten – deutlich größer als bei Männern ist. In den gesetzlichen Krankenkassen zahlen Männer ohnehin traditionell erheblich mehr ein, nehmen aber wesentlich weniger Leistungen in Anspruch (hier, S. 6).
Dass also die Lebenserwartung von Männern deutlich geringer ist als die von Frauen, dass es dafür natürlich auch Gründe gibt, die möglicherweise behoben werden könnten – das ist kein Problem der Gleichstellungspolitik. Sobald aber Männer dadurch, dass sie im Durchschnitt deutlich kürzere Leben haben als Frauen, auch einen kleinen Vorteil haben, erkennt eine bedeutende europäische Institution sogleich eine unrechtmäßige Ungleichbehandlung, die beseitigt werden müsse.
Kein Grund, gleich aufzuschreien.
Von veganen Schweinshaxen und gerechter Geschlechterpolitik
„Gender Mainstreaming bedeutet, bei allen gesellschaftlichen Vorhaben die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern von vornherein und regelmäßig zu berücksichtigen, da es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt.“
Warum ausgerechnet das Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das Männer schon in seinem Titel sorgfältig ausklammert, sich in dieser Weise für die „Interessen von Frauen und Männern“ stark macht, ist nur auf den ersten Blick rätselhaft.
Der Begriff „Gender“ bedeutet, dass Mann und Frau als soziale Konstruktionen, nicht als biologische Tatsachen betrachtet werden. Es ist eine Lieblingsidee der Gender-Forschung, dass es dementsprechend nicht nur zwei dieser „Konstrukte“, sondern noch beliebig viele mehr geben könnte.
Die „Gender Mainstreaming“-Politik hingegen greift stur auf bestehende Konzepte von Mann und Frau zurück, die sich anhand biologischer Merkmale eindeutig und klar unterscheiden lassen. Mit „Gender“ hat das also gar nichts zu tun – was ja auch im Prinzip nicht schlimm wäre, nur ist die Namensnennung eben ungefähr so passend, als würde eine saftige Schweinshaxe ab sofort „veganer Snack“ heißen, oder als würden die Grünen sich als „Arbeiterpartei“ bezeichnen.
„Zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist die Bundesregierung durch Art. 3, Abs. 2, Satz 2 GG ausdrücklich verpflichtet“,
heißt es weiter im Text. Ich verstehe nun nicht ganz, wie eine nicht-tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung aussehen könnte. Jedenfalls geht es irgendwie darum, dass Männer und Frauen nicht nur gleiche Rechte haben sollten: Das haben sie ja auch nicht, Männer sind im Kindschaftsrecht, im Recht zur Wehrpflicht, Jungen sind im Beschneidungsgesetz benachteiligt, von weiteren Regelungen ganz abgesehen – beispielsweise davon, dass nur Frauen, ausgerechnet, Gleichstellungsbeauftragte werden können.
Die Idee dabei ist wohl: Frauen sind Männern gegenüber zwar nicht mehr rechtlich benachteiligt, aber da wir, irgendwie, in einer Männergesellschaft lebten, seien sie immer noch diskriminiert, und diese Diskriminierung müsse abgebaut werden. Daher also fühlt sich für „Gender Mainstreaming“ auch vor allem und ausgerechnet das Frauenministerium zuständig – da Männer ja ohnehin im Vorteil seien, kann nach dessen Verständnis eine Balance zwischen Männer- und Fraueninteressen nur durch eine gezielte Stärkung von Frauen hergestellt werden.
Eine Graswurzelbewegung von oben
Von der Lebenserfahrung der meisten Männer, und wohl auch eines Großteils der Frauen, sind diese Vorstellungen sehr weit entfernt. Die Abgehobenheit dieser Politik zeigt sich schon im Desinteresse der Verantwortlichen, den weithin unverständlichen und bei näherem Hinsehen auch widersprüchlichen Begriff des „Gender Mainstreaming“ durch Begriffe zu ersetzen, die allgemein nachvollziehbar und so für eine demokratische Diskussion brauchbar wären.
Je weniger aber eine Politik, die offen oder stillschweigend von der Idee einer „Männerherrschaft“ oder eines „Patriarchats“ ausgeht, noch allgemein plausibel ist, desto mehr zieht sie sich auf institutionelle Herrschaftspositionen zurück, von wo aus dann die „tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung“ in einem Top-Down-Prozess durchgesetzt werden kann.
Für Hanna Beitzer hat sich die Aufschrei-Kampagne dadurch ausgezeichnet, dass dort „mal jemand mit dem allgemeinen Konsens“ gebrochen habe. Das Gegenteil ist richtig. Aufschrei hat geradezu prototypisch einen Konsens gespiegelt, der Geschlechterdebatten in der Medienlandschaft und politischen Institutionen prägt, der aber außerhalb davon kaum noch vermittelbar ist.
Aufschrei war die Simulation einer Graswurzel-Bewegung, die eine institutionell verfestigte Geschlechterpolitik brauchte, um sich und andere über ihren eigenen Realitätsverlust täuschen zu können.
Wie angreifbar aber diese Politik ist, lässt sich vielleicht mit einem Hinweis auf eine Diskussion deuten, mit der die politische Philosophie schon seit Jahrhunderten – zum Beispiel lange in der Liberalismus-Kommunitarismus-Debatte, die in den achtziger Jahren begann – beschäftigt ist: eine Diskussion darüber nämlich, ob eine legitime und sinnvolle Politik vor allem die Interessen des Individuums oder die des Gemeinwohls im Auge haben sollte. Die etablierte Geschlechter-Politik wendet sich von wesentlichen Grundlagen BEIDER Seiten ab.
Die Orientierung am individuellen Wohl macht sie unmöglich, weil sie Individuen stur unterschiedlichen Gruppen unterordnet – die Orientierung am Gemeinwohl macht sie unmöglich, weil sie diese Gruppen grundsätzlich in einen permanenten und bitteren Konflikt miteinander schiebt.
Diese Politik ist also sowohl in einem liberalen Sinn wie auch im Sinne des Gemeinwohls sinnlos und vermutlich auch schädlich. Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass sie sich nicht in offenen demokratischen Prozessen durchsetzen, sondern nur über gezielte Ausschlüsse vieler aus der Diskussion und über institutionelle Herrschaftspositionen etablieren konnte.
Eigentlich gäbe es daher gute Gründe für Männer und Frauen, die diesen Konsens nicht teilen, dieses Spiel nicht mitzuspielen, das beständig ein Geschlecht gegen das andere ausspielt – und Vertrauen darauf zu haben, dass die eigenen Investitionen in das öffentliche Leben sich zumindest auf längere Sicht auszahlen.
Der Gender Mainstreaming-Politik hingegen gelingt das Kunststück, sowohl Männern wie auch Frauen das beständige Gefühl zu geben, zu kurz zu kommen. Frauen, weil sie ihnen den Eindruck vermittelt, grundsätzlich und strukturell unterdrückt zu werden – und Männern, weil diese die Erfahrung machen, dass ihre eigenen Leistungen systematisch übersehen, dass ihre rechtlichen Benachteiligungen für irrelevant erklärt und dass sie selbst dabei zwanghaft weiterhin als „Herrscher“ oder „Sexisten“ präsentiert werden.
Sich diesem Spiel völlig zu verweigern, ist allerdings wohl aussichtslos. Angesichts eines Artikels, in dem wieder einmal eine Journalistin wider besseres Wissen vom „Gender Pay Gap“ schreibt, einfach nur freundlich darauf hinzuweisen, dass dieser Gap eine haltlose statistische Konstruktion und dass das beständige Ausspielen eine Geschlechts gegen das andere eher schädlich als nützlich ist – das wirkt gegen die wütend vorgebrachte Behauptung der Diskriminierung von Frauen regelrecht hilflos, abstrakt und ausweichend.
Vermutlich haben Gegner dieser Politik nur eine Chance: Gender Mainstreaming beim Wort zu nehmen, Gegenrechnungen wie diese aufzumachen, zu zeigen, wo und wieviel Männer gesellschaftlich draufzahlen – und klarzustellen, dass „Geschlechtergerechtigkeit“, wenn man es ganz genau nimmt, eigentlich kein Privileg von Frauen ist. Der Vorschlag, dafür den Aufschrei-Hashtag zu nutzen, wäre vielleicht ein guter Anfang.
Der Artikel erschien zuerst auf man tau.