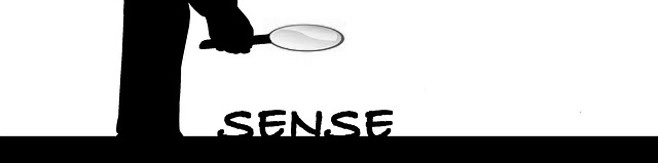Paradigma und Inkommensurabilität
Wie kaum ein anderer hat Thomas S. Kuhn mit seinem Werk Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen die Debatte zur Entwicklung von wissenschaftlichen Theorien beeinflusst. Dabei standen die Begriffe „Paradigma“ und „Inkommensurabilität“ im Zentrum der Auseinandersetzung.
 Die beiden Begriffe wurden zu Modebegriffen in vielen Bereichen der Geistes- und Sozialwissenschaften, u.a. in der Postmoderne und in einer bestimmten Richtung des Feminismus.
Die beiden Begriffe wurden zu Modebegriffen in vielen Bereichen der Geistes- und Sozialwissenschaften, u.a. in der Postmoderne und in einer bestimmten Richtung des Feminismus.
Im ersten Schritt werden wir die von Kuhn vorgenommenen Bestimmungen von „Paradigma“ und „Inkommensurabilität“ vorstellen. Zweitens werden wir die Verwendung der beiden Begriffe in der Postmoderne und in einer bestimmten Variante des Feminismus analysieren. Schließlich möchten wir durch die Einführung von Differenzierungen die Rede von „Paradigma“ und „Inkommensurabilität“ präzisieren.
Begriffsbestimmungen
Thomas S. Kuhn liefert in seinem folgenreichen Werk Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen folgende Grundbestimmungen von „Paradigma“:
„Darunter verstehe ich allgemein anerkannte wissenschaftliche Leistungen, die für eine gewisse Zeit einer Gemeinschaft von Fachleuten maßgebende Probleme und Lösungen liefern.“ (1)
„Einerseits steht er (der Paradigma-Begriff, A. U.) für die ganze Konstellation von Meinungen, Werten, Methoden usw., die von den Mitgliedern einer gegebenen Gemeinschaft geteilt werden. Andererseits bezeichnet er ein Element in dieser Konstellation, die konkreten Problemlösungen, die, als Vorbilder oder Beispiele gebraucht, explizite Regeln als Basis für die Lösung der übrigen Probleme der ´normalen Wissenschaft` ersetzen können.“ (2)
Paradigma kann als herrschende Theorie bestimmt werden. Herrschend in dem Sinne, dass sie mehr und exakter als andere Theorien erklären kann und von den meisten Wissenschaftlern eines Faches akzeptiert wird.
Kuhn unterscheidet zwischen der Phase normaler Wissenschaft und der Phase wissenschaftlicher Revolutionen. In der ersteren werden im Rahmen eines nicht bezweifelbaren Paradigmas wissenschaftliche Probleme gelöst. Wenn durch das Auftreten von Anomalien eine Krise entsteht, versuchen Wissenschaftler, neue Modelle und Lösungen zu finden, die mit dem bestehenden Paradigma vereinbar wären. Erst durch immer wieder auftretende Anomalien bildet sich ein neues Paradigma heraus. Meist wird es durch jüngere Wissenschaftler vertreten. Eine wissenschaftliche Revolution tritt dann ein, wenn ein Paradigma durch ein anderes, mit ihm nicht zu vereinbarendes ersetzt wird. Ein Paradigmawechsel als Folge einer wissenschaftlichen Revolution bringt mit sich die Änderung der Maßstäbe der wissenschaftlichen Forschung und der Lösung von wissenschaftlichen Problemen. Der Wechsel ändert das wissenschaftliche Denken und somit die Sicht auf die Welt, in der Wissenschaft betrieben wird. (3)
„Und doch, Paradigmawechsel veranlassen die Wissenschaftler tatsächlich, die Welt ihres Forschungsbereiches anders zu sehen. Soweit ihre einzige Beziehung zu dieser Welt in dem besteht, was sie sehen und tun, können wir wohl sagen, dass Wissenschaftler nach einer Revolution mit einer anderen Welt zu tun haben.“ (4)
Das bedeutet, dass sich aufgrund eines Paradigmawechsels auch die Wahrnehmung eines Wissenschaftlers ändert. Er muss lernen, neue „Gestalten“ zu sehen bzw. neue Wahrnehmungsmuster zu adaptieren. Das ist für Kuhn auch ein Grund dafür, dass zwei Paradigmen als miteinander nicht vergleichbar erscheinen und dass Wissenschaftler, die zwei unterschiedliche Paradigmen vertreten, oft „aneinander vorbeireden“. (5)
Kuhn führt in diesem Zusammenhang den Begriff der Inkommensurabilität ein. Paradigmen sind zueinander inkommensurabel. Das bedeutet, dass sie miteinander unvereinbar und ihre Komponenten, insbesondere ihre grundlegenden Begriffe, ineinander nicht übersetzbar sind. (6) Inkommensurabel sind beispielsweise das Ptolemäische und das Kopernikanische Weltbild sowie die Newtonsche Physik und die Einsteins Relativitätstheorie.
Mit der These von der Inkommensurabilität von Paradigmen möchte Kuhn zeigen, dass wissenschaftlicher Fortschritt nicht kumulativ, d.h. als Anhäufung von wissenschaftlichen Erkenntnissen, aufzufassen ist. Vielmehr gibt es in der Wissenschaftsgeschichte Rückschritte und Brüche. Kuhn leugnet jedoch nicht, dass man Theorie/Paradigmen miteinander vergleichen kann und sagen kann, welche Theorie „besser“ ist. Entscheidend ist dabei, dass sich die Theorie empirisch besser bewährt als andere, konkurrierende Theorien.
Die empiristische Sichtweise wird durch Behauptung wie die folgende bekräftigt:
„Erst wenn Experiment und heuristische Theorie beide so weit artikuliert werde, dass sie übereinstimmen, kann es zur Entdeckung kommen und die Theorie zu einem Paradigma werden.“ (7)
Nicht nur die empirische Beobachtbarkeit und Überprüfung, sondern auch die Durchführung von Experimenten sind somit konstitutiv für ein Paradigma. Anders formuliert: Beobachtung und Experiment sollen mit Hilfe eines Paradigmas „erfolgreich erklärt“ werden. Kuhn spricht auch von einer „Exaktheit des Zusammenspiels von Beobachtung und These“, die ein Paradigma gewährleisten soll. (8) Erfolg scheint somit als Kriterium für die Wahl von Paradigmen zu fungieren. Er kann dabei nicht in einem außerwissenschaftlichen, sondern in einem innerwissenschaftlichen Sinne verstanden werden. Ein Paradigma ist erfolgreicher als ein anderes, wenn es sowohl die Phänomene des alten Paradigmas als auch die Anomalien des alten Paradigmas zufriedenstellend erklären kann.
Ein Paradigma ist mit einer wissenschaftlichen Gemeinschaft (engl. scientific community) verbunden. Es wird durch eine wissenschaftliche Gemeinschaft akzeptiert. Sie verteidigt und propagiert es. Kuhn betont in diesem Zusammenhang, dass die Wahl zwischen konkurrierenden Paradigmen wie die Wahl zwischen „unvereinbaren Lebensweisen der Gemeinschaft“ ist. An einer anderen Stelle geht er so weit, wissenschaftliche Revolutionen mit politischen zu vergleichen:
„Wie bei politischen Revolutionen gibt es auch bei der Wahl eines Paradigmas keine höhere Norm als die Billigung durch die jeweilige Gemeinschaft.“ (9)
Der Streit zwischen Paradigmen kann anhand von Kriterien entschieden werden, die „außerhalb der normalen Wissenschaft liegen“ (10). Das bedeutet den Verzicht auf eine theorieinterne Begründung und die Legitimation eines Paradigmas durch wissenschaftsexterne Faktoren. Die wissenschaftsexternen Faktoren, zu denen z.B. soziale und politische, religiöse und weltanschauliche Faktoren gehören, kommen zusätzlich zu den wissenschaftsinternen Faktoren hinzu. Sie sind für die Entstehung eines Paradigmas mitverantwortlich. Letztlich aber muss sich ein Paradigma empirisch/experimentell ausweisen.
Missverständnisse und Fehldeutungen
Die Vieldeutigkeit des Kuhnschen Paradigma-Begriffs schafft Raum für Missverständnisse und Fehldeutungen. Solche Missverständnisse und Fehldeutungen finden wir vorwiegend in der Postmoderne und im Genderkonstruktivismus. Modernes Wissen wird nach Jean-François Lyotard, einem der prominentesten Vertreter der Postmoderne, durch den Rekurs auf „Metaerzählungen“ legitimiert. Sie zeichnen sich durch den totalisierenden Anspruch, das Ganze der Welt (Gesellschaft, Geschichte usw.) zu erklären, den Universalismus (Anspruch auf Allgemeingültigkeit von Erkenntnissen) und das Systemdenken aus.
Zu den Metaerzählungen zählt Lyotard in erster Linie den Hegelianismus und den Marxismus, aber auch die Aufklärung, die Emanzipation und die Wissenschaft, insofern sie den Anspruch auf universelles Wissen stellt. Lyotard lehnt auch die Habermassche Diskursethik ab, denn in ihr werden universelle Geltungsansprüche gestellt. (11) Metaerzählungen können dementsprechend als universelle, auf die Erklärung der Welt ausgerichtete Theorien bzw. Metatheorien verstanden werden.
Postmodernes Wissen zeichnet sich hingegen durch eine „Skepsis gegenüber Metaerzählungen“ (12) und durch die „Heterogenität der Sprachspiele“ aus. Anders formuliert: Die Metaerzählungen sollen zugunsten von partialen, gleichberechtigt nebeneinander existierenden Sprachspielen aufgehoben werden.
In Anlehnung an den späten Wittgenstein und die Sprechakttheorie (J. L. Austin, J. Searle) behauptet Lyotard, dass eine Aussage nicht nur eine denotative, also bezeichnende und feststellende Funktion haben kann. Vielmehr kann sie ein Versprechen, eine Bitte oder ein Befehl ausdrücken, also eine performative Wirkung haben, eine Wirkung auf die Kommunikation und die soziale Welt.
Damit wird eine einziges, ausgezeichnetes Wahrheitskriterium abgelehnt und für eine Vielfalt von Kriterien plädiert. (13)
Nach Lyotard gibt es kein universelles, übergreifendes Sprachspiel, sondern eine Pluralität von Sprachspielen, die nebeneinander gleichwertig und gleichberechtigt existieren. Sie sind miteinander inkommensurabel. Das postmoderne Wissen „verfeinert unsere Sensibilität für die Unterschiede und verstärkt unsere Fähigkeit, das Inkommensurable zu ertragen“ (14).
Während Lyotard in dem Buch „Das postmoderne Wissen“ von Sprachspielen spricht, verwendet er in seinem späteren Werk „Der Widerstreit“ den Begriff „Diskursart“ (franz. genre bzw. genre de discours). Der Übersetzer betont, dass der Begriff im Sinne von „Gattung“ und „Genre“ verwendet wird. (15) Eine Diskursart bildet einen „Komplex möglicher Sätze“, wobei jeder dieser Sätze einem „Satz-Regelsystem“ angehört.
Lyotard zählt zu den Diskursarten z.B. die wissenschaftliche Diskursart und die ökonomische, des Weiteren spricht er vom pädagogischen Diskurs, Dialog, Tragödie, Lied und Technik. (16) Unter Diskursart bzw. Diskurs fallen somit sehr heterogene Kommunikationseinheiten. Es gibt keine „universale Urteilsregel“ in Bezug auf ungleichartige Diskursarten, also keine universale Diskursart, die zwischen den Diskursarten vermitteln könnte. Mit Inkommensurabilität meint Lyotard in diesem Zusammenhang offensichtlich Ungleichartigkeit. Aufgrund ihrer Inkommensurabilität besteht zwischen den Diskursarten „Widerstreit“.
Der Begriff des Paradigmas wird auch in genderkonstruktivistischen Ansätzen, die sich an die Postmoderne anlehnen, verwendet. Eine der wichtigsten Vertreterinnen des Genderkonstruktivismus, Judith Lorber, beansprucht es, Gender zu einem neuen Paradigma zu erheben. Sie setzt in ihrer Analyse nicht beim Individuum oder bei interpersonalen Beziehungen an, vielmehr versteht sie unter Gender eine „soziale Institution, die die Erwartungsmuster für Individuen bestimmt, die sozialen Prozesse des Alltagslebens regelt …“ (17).
Als soziale Institution kann Gender als ein Ordnungsprinzip aufgefasst werden, das alle Lebensbereiche des Menschen bestimmt: Familie, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft usw. Gender-Zeichen und -Symbole sind nach Lorber „allgegenwärtig“ (18). Den sozial Handelnden kann immer ein Gender-Status zugesprochen werden. Entscheidend ist dabei, dass Gender nicht naturgegeben, sondern sozial konstruiert ist.
Die Konstruktion von Gender beginnt schon bei der Geburt, setzt sich dann in der Kindheit und im Erwachsenenalter fort, umfasst demnach den ganzen Sozialisationsprozess. An einer anderen Stelle bestimmt Lorber die soziale Institution Gender als eine soziale Struktur (19), die allen konkreten Handlungen von Männern und Frauen zugrunde liegt. Sie äußert sich in historisch spezifischen Situationen.
Lorber versteht demnach unter „Paradigma“ Gender als Ordnungsprinzip (eine soziale Institution), als Konstruktion und eine soziale Struktur. Andererseits kann die von Lorber durchgeführte Analyse bzw. der von ihr vertretene Ansatz als ein Paradigma bezeichnet werden. Doch selbst die Verfasserinnen der Einleitung zu Gender-Paradoxien betonen, dass Lorber es versäumt aufzuzeigen, „worin denn nun der Paradigmawechsel besteht, wie im einzelnen die neue Theorie sich von den herkömmlichen unterscheidet oder an welchen Institutionenbegriff sie anschließt …“ (20).
Astrid Deuber-Mankowsky, eine prominente Vertreterin eines auf die Postmoderne rekurrierenden Genderkonstruktivismus spricht vom „Gender-Paradigma“. Sie meint damit „die Forschung entlang der Kategorie Gender“ (21). Genauer meint sie damit den Gegenstand der Gender Studies. Sie versteht ihn als
„Genealogie der Machtverhältnisse und Archäologie des Geschlechts im Verhältnis zur Geschichte der Sexualität, des begehrenden Körpers, der Institutionen, der Disziplinar- und Regierungssysteme, der Identität, der Kategorien Race/Ethnicity, Class, sexuelle Orientierung, Alter, etc. und der Wissenssysteme der Natur und der Kultur.“ (22)
Um die Gender Studies sammeln sich Sexuality Studies, Queer Studies, Männlichkeitsstudien, Transgender Studies, Critical Whitenes Studies usw. Deuber-Mankowsky versteht unter „Paradigma“ offensichtlich eine Disziplin, die bestimmte Gegenstandsbereiche und Themen hat und um die sich Forschungszweige gruppieren. An einer anderen Stelle spricht sie in Anlehnung an Joan W. Scott vom Gender als dem „zentralen Begriff einer der wichtigsten Bewegungen in der Wissenschaftsforschung am Ende des 20. Jahrhunderts“ (23). Das Gender-Paradigma kann daher als eine „Bewegung“ in der Wissenschaft aufgefasst werden.
Deuber-Mankowsky hebt den anti-universalistischen Charakter des Gender-Paradigmas hervor: Es richtet sich gegen den Androzentrismus, die Gleichsetzung von weiblicher Erfahrung mit der Erfahrung weißer Mittelklassenfrauen, die heterosexuelle Matrix und die körperlich definierte Zweigeschlechtlichkeit. Gender wird von Deuber-Mankowsky als ein „epistemisches Ding“ aufgefasst: Epistemische Dinge sind „Objekte des Wissens“ und „Diskursobjekte“, die sich in einer „charakteristischen, irreduziblen Vagheit und Verschwommenheit“ präsentieren (24).
Doch Gender ist auch mit einer bestimmten Lebenspraxis verbunden: Studierende der Gender Studies sollen das Studium als eine Erfahrung, eine „Übung ihrer selbst“ begreifen. Offensichtlich gehört auch diese Lebenspraxis (doing gender) zum Gender-Paradigma. Das Gender-Paradigma verlässt somit den genuin wissenschaftlichen Kontext und wird zum Medium von Selbsterfahrung und Selbstverwirklichung.
Schließlich verweist Deuber-Mankowsky darauf, dass die „Kategorie Gender“ seit der vierten Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 in einen politischen Kontext gestellt wurde und seit 2002 eine zentrale Rolle in dem Regierungsprogramm „Gender Mainstreaming“ spielt. Auch in diesem Fall verlässt das Gender-Paradigma den genuin wissenschaftlichen Kontext: Es wird zu einer politischen Kategorie. Addiert man die oben genannten Bedeutungen von Paradigma, dann kann das Gender-Paradigma als eine Weltanschauung verstanden werden.
Differenzierungen und Klärungen
Um sinnvoll von Inkommensurabilität von herrschenden Theorien/Paradigmen zu sprechen, ist es notwendig zu zeigen, in Bezug worauf Theorien inkommensurabel sein können. Theorien können zunächst nur dann auf ihre Inkommensurabilität hin untersucht werden, wenn sie sich auf den gleichen Gegenstandsbereich beziehen. Beispielsweise kann man nicht die Quantenmechanik mit psychologischen Theorien vergleichen. Gerade diesen Fehler begeht Lyotard. Er bringt Sprachspiele und Diskursarten, die sich auf verschiedene Gegenstandsbereiche beziehen, in Verbindung und spricht von ihrer Inkommensurabilität.
Darüber hinaus ist es von entscheidender Bedeutung, hinsichtlich welcher Theorie-Komponente Theorien miteinander verglichen werden können. In Anlehnung an einen Vorschlag von Gerhard Schurz können Theorien vier Komponenten enthalten:
1) Die theoretische Komponente. Zu ihr gehört ein Theoriekern, der wiederum Grundbegriffe, Axiome, Gesetzeshypothesen und Modellvorstellungen beinhaltet. Die theoretische Komponente legen darüber hinaus den Gegenstandsbereich der Theorie fest.
2) Die empirische Komponente. Hier wird der Theoriekern auf die empirische Realität bezogen. Wissenschaftliche Hypothesen sollen sich an der empirischen Realität bewähren. Zur empirischen Komponente eines Paradigmas gehört auch die Angabe von Musterbeispielen. Wissenschaftlicher Erklärungen.
3) Die methodologische Komponente besteht aus a) Regeln darüber, wie der Gegenstand der Theorie zu untersuchen ist, b) der epistemologischen Komponente, die beispielsweise darüber Auskunft gibt, wie das Verhältnis zwischen dem Forschungssubjekt und Forschungsobjekt zu bestimmen ist und c) der normativen Komponente, die das Forschungsinteresse anzeigt.
4) Die programmatische Komponente enthält ein Forschungsprogramm, d.h. in der Regel das Versprechen, möglichst viele Phänomene möglichst exakt zu erklären. (25)
Von entscheidender Bedeutung für den Theorievergleich und die Feststellung von Inkommensuarbilität ist die theoretische Komponente, der Theoriekern. Anders formuliert: Die Grundlage einer jeden Theorie/eines jeden Paradigmas ist der Theoriekern, zu dem zentrale Begriffe und Modellvorstellungen gehören. Statt von Modellvorstellung kann man auch von theoretischem Rahmen sprechen. Wenn der Theoriekern einer Theorie zu dem Theoriekern einer anderen Theorie inkommensurabel ist, dann sind auch die ganzen Theorien zueinander inkommensurabel. Mit Inkommensurabilität bezeichnen wir die Unübersetzbarkeit der Begriffe einer Theorie in die Begriffe einer anderen Theorie. Wir möchten das anhand eines Vergleichs der Begriffe des Newtonschen Paradigmas mit den Begriffen des Einsteinschen Paradigmas demonstrieren.
Zentral für die Theorien von Newton und Einstein sind die Begriffe Raum und Zeit. Newton bestimmt Raum als „absoluten Raum“ und Zeit als „absolute Zeit“. Der absolute Raum wird von Newton als eine Art Behälter vorgestellt, der für sich alleinstehend existiert und in dem sich Gegenstände aufhalten können. Sie üben jedoch keine Wirkung auf den Raum aus und umgekehrt. Diese Anordung kann als ein Dualismus von Raum und Gegenstand betrachtet werden. Das gilt auch für die absolute Zeit. Sie besteht unabhängig, d.h. ohne Wechselwirkung mit Gegenständen und Raum. In Einsteins Relativitätstheorie hingegen bilden Raum und Zeit eine Einheit: die sog. Raumzeit. Sie ist vierdimensional, d.h. sie besteht aus den drei Dimensionen des Raums und der Zeit als vierter Dimension. Die Relativitätstheorie deckt zudem das Verhältnis zwischen materiellen Gegenständen und der Raumzeit auf: Die Raumzeit wird erst durch die Bewegung von materiellen Gegenständen bestimmt. Anders formuliert: Sie besteht nur in der Relation zu den materiellen Gegenständen. Damit wird die Unabhängikeit von Raum, Zeit und materiellen Gegenständen aufgehoben.
Die Newtonschen Begriffe Raum und Zeit sind nicht in die entsprechenden Einsteinschen übersetztbar. Sie haben unterschiedliche Bedeutugen und gründen in jeweils unterschiedlichen Weltvorstellungen (Modellvorstellungen). Die beiden Theorien bestehen nicht gleichberechtigt nebeneinander, weil man durch empirische Forschung feststellen kann, das eines dieser Paradigmen (das Einsteinsche) mehr und genauer empirische Phänomene erklären kann (z. B. die Erklärung der Merkur-Bewegung).
Paradigmen können eine Zeit lang miteinander koexistieren und rivalisieren. Das entspricht dem Postulat des Theorienpluralismus: Es ist für die Wissenschaft vom Vorteil, wenn es möglichst viele Theorien gibt, die miteinander in Konkurrenz treten. Theorienpluralismus kann jedoch kein Ziel sein. Als Postulat dient er der größtmöglichen Annäherung an die eine Wahrheit. In diesem Prozess werden manche Theorien falsifiziert und eliminiert, andere Theorien hingegen bewähren sich und bleiben für eine gewisse Zeit vorherrschend.
Paradigmen sind nicht gleichwertig und sie existieren nicht gleichberechtigt nebeneinander. Ein Paradigma ist „besser“ als ein anderes, wenn es mehr und exakter empirische Phänomene erklären kann. Die letzte und entscheidende Überprüfungsinstanz ist demnach die empirische Realität. Die empirische Forschung liefert die Möglichkeit, Paradigmen miteinander zu vergleichen. Wissenschaftlicher Fortschritt besteht darin, sich aufgrund von empirischen Daten für ein Paradigma zu entscheiden.
Anmerkungen
(1) Thomas S. Kuhn, Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Frankfurt am Main 19762, S. 10.
(2) Ebd., S. 186.
(3) Ebd., S. 20f.
(4) Ebd., S. 123.
(5) Ebd., SS. 124.
(6) Ebd., S. 116.
(7) Ebd., S. 74.
(8) Ebd., S. 77.
(9) Ebd., S. 106.
(10) Ebd. 122.
(11) Jean-François Lyotard, Das postmoderne Wissen, Graz/Wien 1986, S. 16.
(12) Ebd., S. 13f.
(13) Ebd., S. 64.
(14) Ebd., S. 16.
(15) Jean-François Lyotard, Der Widerstreit, München 1987, S. 13.
(16) Ebd., S. 217.
(17) Judith Lorber, Gender-Paradoxien. Opladen 1999, S. 41.
(18) Ebd., S. 56.
(19) Ebd., S. 42 und 48.
(20) Ebd., S. 11.
(21) A. Deuber-Mankowsky, „Eine Frage des Wissens. Gender als epistemisches Ding“, in: Marie Luise Angerer/Christiane König (Hg.), Gender goes Life. Die Lebenswissenschaften als Herausforderung für die Gender Studies, Bielefeld 2008, S. 140.
(22) Ebd., S. 140f.
(23) Ebd., S. 156.
(24) Ebd., S. 139.
(25) Gerhard Schurz, „Koexistenzweisen rivalisierender Paradigmen. Eine begriffsklärende und problemtypologisierende Studie“, in: Ders./Paul Weingartner (Hrsg.), Koexistenz rivalisierender Paradigmen. Eine post-kuhnsche Bestandsaufnahme zur Struktur gegenwärtiger Wissenschaft, Opladen/Wiesbaden 1998, S. 10f.
Ich studierte Philosophie, Soziologie und Sprachwissenschaften.
Meine Doktorarbeit schrieb ich über den Begriff der Lebenswelt.
Ich stehe in der Tradition des Humanismus und der Philosophie der Aufklärung. Ich beschäftige mich vorwiegend mit den Themen "Menschenrechte", "Gerechtigkeit", "Gleichberechtigung" und "Demokratie".
In meinen Büchern lege ich besonderen Wert auf Klarheit und Verständlichkeit der Darstellung. Dabei folge ich dem folgenden Motto des Philosophen Karl Raimund Popper: „Wer’s nicht einfach und klar sagen kann, der soll schweigen und weiterarbeiten, bis er’s klar sagen kann“.