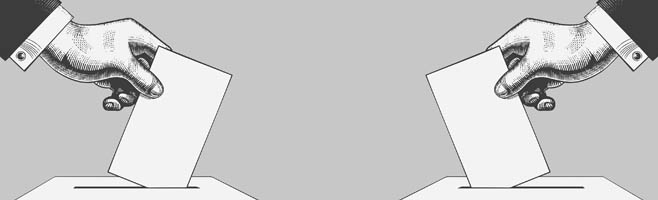Liberalismus und direkte Demokratie: Ein Weg zur Begrenzung politischer Macht?
Eine Reflexion über Machtgleichgewicht und Mehrheitsprinzip
1. Grenzen der Mehrheitsentscheidung
Bevor man die Frage stellt, ob die repräsentative Demokratie oder direkte Demokratie oder eine Mischform aus beidem die erstrebenswerte Form der Mehrheitsentscheidung ist und wo die Grenzen der direkten Demokratie liegen, muss man sich zuerst die Frage stellen, wo die Grenzen und Beschränkungen des Mehrheitsvotums an sich liegen. Demokratie an sich hat Grenzen.
Weder eine Mehrheit der Bürger bei einer direktdemokratischen Entscheidung noch die Mehrheit der Abgeordneten im Parlament hat zum Beispiel das Recht, einen Teil der Bevölkerung entschädigungslos zu enteignen, für einen Teil der Bevölkerung das Recht auf Religions- und Bekenntnisfreiheit aufzuheben oder ein Berufsverbot zu verhängen. Das Mehrheitsvotum steht nicht über den Grundrechten und nicht über der konstitutionellen Ordnung, sondern ist Teil einer solchen Ordnung.
Diese Aussage mag banal erscheinen, ist sie aber nicht. Sie ist von großer politischer Relevanz. Der Westen förderte in vielen Ländern der Welt die Demokratie – zum Beispiel in Afghanistan, im Irak, in Ägypten –, dabei gerät aber oft aus dem Blick, dass Demokratie nicht ohne rechtsstaatliche und konstitutionelle Grundlagen besonders im Hinblick auf die Menschen- und Bürgerrechte denkbar ist. Nicht jede Mehrheitsentscheidung ist legitim. Sollte sich zum Beispiel jetzt nach den Wahlen in Ägypten eine parlamentarische Mehrheit finden, die fundamentale Grundrechte von Frauen und religiösen Minderheiten einschränkt, dann wären diese Entscheidungen nicht legitim, auch wenn sie die Unterstützung einer Mehrheit der Wähler finden. Halten wir also an dieser Stelle fest: Der Wirkungsbereich von Mehrheitsentscheidungen hat Grenzen, die durch Grundrechte und Verfassung definiert werden, dies gilt sowohl für die direkte als auch für die repräsentative Demokratie. Was ein demokratisch gewähltes Parlament nicht entscheiden darf, etwa nach der deutschen Verfassung die Einführung der Todesstrafe, darf ein Volksentscheid auch nicht herbeiführen. Direkte und indirekte Demokratie unterliegen also denselben rechtsstaatlichen und konstitutionellen Beschränkungen.
2. Private und öffentliche Entscheidungen

Die liberale Auffassung sieht darüber hinaus weitere ideale Bedingungen für das Funktionieren und Prosperieren einer freien Gesellschaft. Dazu gehört, dass nur so viele Entscheidungen wie eben nötig von der Politik getroffen werden sollten, die persönlichen Lebensentscheidungen aber von den Bürgern in eigener Verantwortung getroffen werden müssen. Die Frage, welchen Beruf man ausüben möchte und welche beruflichen Ziele man verfolgt, in welcher Familienform man zusammen leben will, wie man seine Kinder erziehen möchte, nach welchen religiösen und kulturellen Wertvorstellungen man sein Leben und seine Freizeit gestalten will, wie man sein Einkommen ausgeben und sein Vermögen anlegen will, mit wem man freundschaftlichen Umgang pflegen möchte und mit wem nicht, in welchem Verein oder in welcher Kirche man Mitglied ist, welche Medien man konsumiert – dies alles sollten die Bürger für sich selbst entscheiden. Das heißt, aus liberaler Sicht gehören die meisten wichtigen Entscheidungen in den privaten und nicht in den politischen Bereich. Dies hängt im übrigen auch eng mit den Grundrechten zusammen, da das Recht, über diese privaten Belange selbst entscheiden zu dürfen, in den meisten Fällen direkt aus den Grundrechten ableitbar ist.
Nur die Entscheidungen müssen politisch getroffen werden, die privat nicht zu lösen sind, weil sie einen allgemeinen, die Öffentlichkeit betreffenden Charakter tragen. Zum Unterhalt der öffentlichen Einrichtungen und zur Umsetzung der Maßnahmen, die das betrifft, werden öffentliche Mittel aufgewendet, die in Form von Steuern und Abgaben erhoben werden. Die Entscheidungen über öffentliche Angelegenheiten – und nur über diese – können und müssen durch Mehrheitsentscheidung getroffen werden, nach dem alten Prinzip „Keine Besteuerung ohne Beteiligung“. Die Bürger zahlen und sind von öffentlichen Angelegenheiten direkt betroffen, also müssen sie darüber auch entscheiden können. Um diese Entscheidungen herbeizuführen, ist der demokratische Prozess der richtige Weg. Dazu ist aber anzumerken, dass dieser Prozess kein Garant dafür ist, dass alle Entscheidungen, die getroffen werden, auch richtig sind. Es kommt im gewissen Sinne mehr auf den geordneten Prozess der Entscheidungsfindung an als auf die Entscheidung selbst. Mehrheitsentscheidungen können sachlich falsch sein. Demokratie bedeutet, dass man auch dann Mehrheitsentscheidungen im skizzierten Rahmen akzeptieren muss, wenn diese sachlich falsch sind.
Das muss betont werden, weil die Popularität der direkten Demokratie oft von den Ergebnissen einzelner Abstimmungen und den demoskopischen Erhebungen zu einzelnen Fragen abhängig gemacht wird. Ob man aber für oder gegen direkte demokratische Elemente in der Bundesrepublik votiert, sollte man nicht davon abhängig machen, ob man für oder gegen die Kernenergie, für oder gegen Stuttgart 21 oder für oder gegen die Eurorettungsschirme ist. Jedes demokratische Modell setzt voraus, dass man auch Mehrheitsentscheidungen akzeptieren muss, die einem nicht gefallen und die vielleicht sogar objektiv falsch sein mögen. Was diesen Umstand betrifft, gibt es keinen Unterschied zwischen direkter und repräsentativer Demokratie. Es kann also kein Argument für oder gegen direkte Demokratie sein, dass man auf diese Weise für das eine oder andere Thema eine Mehrheit bekommt oder nicht. Die Legitimation der Demokratie besteht in ihrem Charakter als formaler Prozess zur Verhinderung von Willkür, der Beschränkung politischer Macht und zur Befriedung der Gesellschaft. Demokratie bedeutet, dass man sich auf einen Prozess der Entscheidungsfindung einigt, und sich darauf verständigt, das Ergebnis einer Abstimmung auch dann zu akzeptieren, wenn man selbst in dieser unterliegt.
Ob dieser geordnete Prozess der Entscheidungsfindung über ein repräsentatives oder direktdemokratisches System erfolgen soll, lässt sich nicht grundsätzlich beantworten. Diese Frage kann nur historisch-pragmatisch beantwortet werden, aber nicht grundsätzlich für jede denkbare Konstellation. Es gibt direktdemokratische Systeme, die funktionieren, und es gibt direktdemokratische Systeme, die nicht oder nicht gut funktionieren. Es gibt repräsentative Systeme, die funktionieren, und es gibt repräsentative Systeme, die nicht oder nicht gut funktionieren. Die Weimarer Republik ist ein Beispiel für ein parlamentarisches System, in dem das Parlament durch die Zersplitterung der Parteienlandschaft gelähmt war. Die negativen Wirkungen der direktdemokratischen Elemente waren hingegen von untergeordneter Bedeutung: „In jeder Diskussion über direkte Demokratie in Deutschland wird stereotyp auf angeblich ‚negative Weimarer Erfahrungen‘ verwiesen. Mit ‚Weimar‘ wird regelmäßig erklärt, warum das Grundgesetz für die Bundesebene keine direktdemokratischen Verfahren aufgenommen hat, und lange Zeit wurde mit dem historischen Verweis auch vor der Einführung solcher Volksrechte für die Zukunft gewarnt. Die historische Forschung hat jedoch inzwischen so viel Aufklärungsarbeit geleistet, dass diese Argumentation nicht mehr aufrechtzuerhalten ist.“ (Schiller, Direkte Demokratie, S. 73)
Der US-Bundesstaat Kalifornien, wo für den Erfolg einer Verfassungsinitiative nur eine einfache Mehrheit notwendig ist, ist heute ein Beispiel dafür, wie falsche Rahmenbedingungen schwer zu bewältigende Systemprobleme verursachen können. Das Funktionieren der repräsentativen wie der direkten Demokratie steht und fällt also mit dem konstitutionellen Rahmen und der institutionellen Ausgestaltung des demokratischen Prozesses.
3. Informiertheit und Irrationalität
Oft wird als Argument gegen die direkte Demokratie vorgebracht, dass die Mehrheit der Menschen schlecht informiert sei und aus irrationalen Beweggründen ihre Wahlentscheidungen treffe. Parlamente entschieden hingegen unter dem Einfluss von Experten und nach sachlichen Kriterien. Dieses Argument ist schon deshalb problematisch, weil es im Grunde auf eine reine Expertenherrschaft hinauslaufen würde, auf Platons Philosophenstaat, in dem die Weisen regieren. Liberale Denker wie Friedrich August von Hayek und Karl Popper haben der Vorstellung eines absoluten Wissens von Experten und Intellektuellen, die im Auftrag der Massen die Gesellschaft und die Wirtschaft lenken, immer widersprochen. Die Public-Choice-Theorie hat sehr eindeutig gezeigt, dass auch und gerade repräsentative Demokratien sachfremden Erwägungen unterworfen sind. Vor Emotionalisierung ist das Parlament keineswegs gefeit. Nach den Terroranschlägen vom 11. September hat eine parlamentarische Mehrheit in den USA sowohl den Patriot Act als auch den Irakkrieg mitgetragen, was sie sonst wohl nicht getan hätte. Die Behauptung, dass Parlamente durch starke Emotionen und öffentlichen Druck nicht zu beeindrucken sind, ist angesichts der Masse der historischen Gegenbeispiele nicht aufrechtzuerhalten. Das heißt im Umkehrschluss nicht, dass die direkte Demokratie nicht solchen Einflüssen unterworfen ist. Es heißt nur, dass beide Systeme fehleranfällig sind und nicht grundsätzlich, dass das eine System rationaler arbeitet als das andere. Parlament und Volksgesetzgebung sind gleichermaßen anfällig für Fehlentscheidungen.
4. Argumente für die Einführung direktdemokratischer Beteiligung
Was spricht nun für die Einführung direktdemokratischer Verfahren als Ergänzung zur repräsentativen Demokratie? Ein wichtiger Grundsatz des Liberalismus war immer die Begrenzung politischer Macht. Lord Acton brachte es auf den Punkt: Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert absolut. Deshalb geht es bei der Ausgestaltung des politischen Systems nicht in erster Linie um die Ermöglichung der besonders effektiven Ausübung von Macht, sondern um die Begrenzung von Macht durch Kontrolle und Gewaltenteilung. Die direkte Demokratie ist eine Möglichkeit, der Macht von Politikern und Parteien Grenzen zu setzen. Aus dem Grundsatz folgt aber auch, dass die Macht der Mehrheit in Volksentscheiden Grenzen haben und klar umrissen sein muss.
Wenn man zu der Einschätzung gelangt, dass die Gewaltenteilung zwischen Legislative und Exekutive nicht mehr dem Niveau entspricht, das eigentlich wünschbar ist, dann kann man zu dem Ergebnis kommen, dass es einer zusätzlichen Kontrollinstanz in der Gesetzgebung bedarf. Dies wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn sich der Trend verfestigt, dass die Vorgaben, die aus der EU kommen, nur noch routinemäßig verabschiedet werden und eine Ablehnung dieser Vorgaben zwar noch theoretisch, aber kaum noch praktisch eine Möglichkeit darstellt; oder wenn der im Parlament praktizierte Fraktionszwang so groß wird, dass die Unabhängigkeit des Abgeordneten auf ein Minimum reduziert wäre. Könnte der Bundestag also seiner Kontrollfunktion nicht mehr in dem notwendigen Maße nachkommen, wie dies wünschenswert und notwendig ist, wäre eine weitere Kontrollinstanz etwa in Form eines fakultativen Referendums eine nützliche Ergänzung.
Ein weiteres Argument für direkte Demokratie ist dann gegeben, wenn die repräsentative Demokratie nicht mehr repräsentativ genug ist. In der repräsentativen Demokratie sollten die wesentlichen Strömungen der Gesellschaft entsprechend ihrer Größe und Bedeutung im Parlament abgebildet sein. Darum gibt es in einer parlamentarischen Demokratie konservative, liberale, sozialdemokratische und weitere Parteien, die unterschiedliche Wertvorstellungen und politische Konzepte vertreten. Ein Problem entsteht in der repräsentativen Demokratie immer dann, wenn es einen Trend zum Konsens gibt, der letztlich die Wahlmöglichkeiten der Bürger so sehr einschränkt, dass eine wirkliche Alternative für den Wähler nicht mehr erkennbar ist. Durch den Volksentscheid können sich weitverbreitete Meinungen in der Bevölkerung, die im Parteiensystem nicht repräsentiert werden, wieder Gehör verschaffen.
Ein weiteres Argument kann in der Absicht bestehen, das parlamentarische System zu entlasten, wenn Entscheidungen anstehen, die in hohem Maß das Potential besitzen, die Bevölkerung gegen das politische System aufzubringen. Referenden können hier eine Entlastungsfunktion für das repräsentative System besitzen.
Dass Verfassungsänderungen und die Abtretung von Souveränitätsrechten vom Volk mitgetragen werden sollten, ist gut begründbar, da sie die Grundlage der Legitimität der demokratischen Ordnung selbst betreffen. Es ist nachvollziehbar, dass die Legitimität durch den Akt des Verfassungsreferendums gestärkt oder überhaupt erst hergestellt werden kann.
5. Voraussetzungen für die Einführung direktdemokratischer Beteiligung
Was sind nun die Voraussetzungen dafür, dass direktdemokratische Elemente erfolgreich eingesetzt werden könnten? Wie bereits beschrieben, müssen direktdemokratische Entscheidungen klaren formalen Regeln unterworfen sein, die allgemein gültig sind und nicht von Fall zu Fall festgelegt werden. Dazu gehört die Zahl der notwendigen Unterschriften, die Höhe des Quorums und die Überprüfung der Zulässigkeit von Abstimmungen. Es muss auch ein Verfahren geben, wie Entscheidungen, die sich als nicht tragfähig erweisen, wieder aufgehoben werden können. Bevor ein Verfahren in die Wege geleitet wird, muss die formale und inhaltliche Übereinstimmung mit den Regeln der Verfassung festgestellt werden. Wenn Entscheidungen zu kostenwirksamen Maßnahmen führen, dann sollte mit der Abstimmung zugleich die Gegenfinanzierung verabschiedet werden. Sie darf nicht zu einer höheren Verschuldung führen. Das könnte etwa dadurch sichergestellt werden, dass das Parlament die Beschlüsse zur Gegenfinanzierung vorlegt und als Junktim mit dem Volksentscheid zur Abstimmung stellt. Ein „Kaufen sie jetzt, zahlen sie später“ darf es in diesem Zusammenhang nicht geben. Wenn Kosten und Nutzen in einer Entscheidung transparent sind, dann kann davon durchaus eine disziplinierende Wirkung für die Ausgabenfreudigkeit des Staates ausgehen.
6. Direktdemokratische Elemente in einem parlamentarischen System
Nun stellt sich die Frage, inwieweit die angesprochenen direktdemokratischen Elemente mit dem in Deutschland vorherrschenden repräsentativen Modell vereinbar sind. In den meisten Publikationen über die direkte Demokratie wird die Schweiz als Beispiel herangezogen. Dabei eignet sich das Schweizer Modell zur Übertragung auf die bundesrepublikanische Ordnung nur begrenzt. Immer wieder wird in dieser Diskussion auf die unterschiedliche Größe der beiden Staaten und auf die Unterschiede der politischen Tradition – repräsentative Demokratie und Konkordanzdemokratie – hingewiesen. Ein Modell, das sich besser für den Vergleich mit der Bundesrepublik eignet, ist Italien – wie Deutschland ein europäischer Großstaat mit einem parlamentarischen System. Italien gilt als repräsentative Demokratie mit starkem „direktdemokratischem Strang“.
Diese Entwicklung begann nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Italiener direktdemokratisch über die Staatsform – Monarchie oder Republik – abstimmen konnten. Die italienische Verfassung sah nach der Schweiz in Europa die stärksten direktdemokratischen Mitspracherechte vor. Zu diesen Regelungen gehören die imperfekte Gesetzesinitiative und das fakultative Referendum. Die imperfekte Gesetzesinitiative sieht vor, dass mit der Unterstützung von 50.000 Wahlberechtigten ein Gesetz in das Parlament eingebracht werden kann, das dann von den Kammern angenommen oder abgelehnt wird. Das fakultative Referendum ermöglicht es hingegen 500.000 Wahlberechtigten, ein Referendum über ein im Parlament verabschiedetes Gesetz durchzusetzen. Den Gesetzesreferenden wird eine grundlegende Bedeutung als Gegengewicht zur blockierten Parteipolitik Italiens zugesprochen. Die Bedingungen für die Referenden sind die fristgerechte Einreichung der Unterschriften, die formale Prüfung der Übereinstimmung mit dem Ausführungsgesetz und die Überprüfung durch das Verfassungsgericht. Der Staatspräsident setzt im Falle der Rechtmäßigkeit das Referendum an. Wenn ein Referendum gegen ein Gesetz scheitert, darf fünf Jahre lang kein weiteres Referendum gegen das Gesetz angesetzt werden. Imperfekte Gesetzesinitiative und fakultatives Referendum wären neben dem obligatorischen Verfassungsreferendum grundsätzlich auch in das repräsentative System der Bundesrepublik integrierbar.
7. Zusammenfassung und Schluss
Für die Liberalen im Besonderen, aber auch für den liberalen Rechtsstaatsbegriff im Allgemeinen, der von allen demokratischen Parteien getragen wird, gilt das Mehrheitsvotum niemals absolut. Die Wirksamkeit des Mehrheitsvotums wird durch die Grundrechte und durch die Sicherstellung der institutionellen Funktionsfähigkeit eingeschränkt. Privates sollte privat entschieden werden und nur öffentliche Angelegenheiten gehören in die Entscheidungskompetenz demokratischer Mehrheiten. Diese Einschränkungen betreffen sowohl die direkte als auch die repräsentative Demokratie. Wenn diese Einschränkungen gewährleistet sind, gibt es kein grundsätzliches Argument dafür, die eine Form der Demokratie der anderen vorzuziehen. Entscheidend ist die Frage der praktischen Umsetzbarkeit.
Die Herausforderungen, vor denen die repräsentative Demokratie in der Bundesrepublik steht, sind die Abgabe von Kompetenzen an die europäische Ebene, die Neigung zum Konsens zwischen den Parteien (etwa: Europa, Kernkraft und so weiter), die Frage der Legitimität der Verlagerung von Souveränitätsrechten und der Wunsch der Bevölkerung nach einer stärkeren Bürgerbeteiligung. Ob direktdemokratische Elemente zu einer Verbesserung der Bürgerbeteiligung und der Akzeptanz der Demokratie führen, das hängt von der konkreten Ausgestaltung des Prozesses ab. Das italienische Modell lässt sich einfacher auf die Zustände der Bundesrepublik übertragen als das der Schweiz. Denn wie die Bundesrepublik ist auch Italien ein Großstaat mit parlamentarischer Demokratie, aber mit starkem direktdemokratischem Strang. Imperfekte Gesetzesinitiative, fakultatives Referendum und das obligatorische Verfassungsreferendum wären Elemente, über deren Einführung in der Bundesrepublik man ernsthaft diskutieren sollte.
Literatur
- Theo Schiller: Direkte Demokratie. Eine Einführung, Frankfurt a. M 2002.
- Anna Capretti: Direkte Demokratie in Italien, in: Hermann K. Heußer, Otmar Jung (Hg.): Mehr direkte Demokratie wagen. Volksentscheid und Bürgerentscheid, München 2009.
- Hermann K. Heußner: Mehr als ein Jahrhundert Volksgesetzgebung in den USA, in: Heußner, Jung: Mehr direkte Demokratie wagen, München 2009, S. 146.