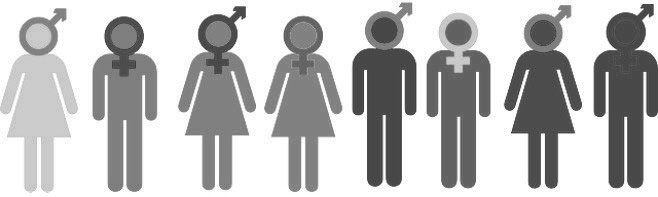Die Marktlogik der Gender Studies
Als vor einem Monat schon wieder ein Text zur Verteidigung der Gender Studies in einer überregionalen Zeitung erschien, hatte ich keine Lust mehr. Die Vielfalt zum Schweigen bringen heißt dieser Text, verfasst von der Gender-Forscherin Franziska Schutzbach, erschienen in der Schweizer Wochenzeitung.
Dass es Kritikern der Gender Studies irgendwie bloß um eine „Verunsicherung“ angesichts der „Vielfalt“ heutiger Lebensentwürfe ginge, ist mittlerweile so variantenarm, häufig und einfältig wiederholt worden, dass es sich kaum lohnt, darüber noch einmal zu schreiben.
In der Süddeutschen Zeitung hatten schon vorher Männer „Angst” vor der Vielfalt, und in der Zeit sind Gender-Kritiker selbstverständlich bloß von der „Angst vor einem anderen Leben“ motiviert. Wie könnte es auch anders sein?
Wie gewohnt geht es Menschen, die auf wissenschaftlichen Standards beharren, auch bei Schutzbach bloß um die „Definitionsmacht über Wissenschaft“, selbstverständlich verraten sie eine „antiintellektuelle, ja autoritäre Geisteshaltung“, und selbstverständlich gehören sie zu einer großen reaktionären Koalition von Rechten, konservativen Christen und Liberalen.
Selbst die raunende Form der Unterstellungen, mit dem auffällig häufigen Gebrauch des verschleiernden Passivs und dem auffällig weitgehenden Verzicht auf seriöse Zitatbelege, findet sich bei Schutzbach wieder – als ob diese stilistischen Marotten für Verteidigungsschriften der Gender Studies aus seltsamen und unerklärten Gründen verpflichtend wären.
„Proklamiert wird letztlich eine dogmatische Erstarrung des Denkens, von Wissenschaft wird nicht Diskurs, sondern Offenbarung erwartet.“
Es bleibt unklar, warum es eine dogmatische Erstarrung proklamiert (als ob das überhaupt schon jemals jemand ernsthaft getan hätte), wenn Kritiker frecherweise für wissenschaftliche Behauptungen auch Belege erwarten. So wie eigentlich alles andere auch unklar bleibt.
Vor allem aber hat die Bloggerin drehumdiebolzeningenieur (ein Begriff aus Astrid Lindgrens Bullerbü-Büchern übrigens) sich mit der wesentlichen Position von Schutzbachs Text schon auseinandergesetzt. Die Formel Schutzbachs,
„Wissen und damit auch Gesellschaft als immerwährenden Prozess von Aushandlungen zu verstehen“,
nimmt die Bloggerin mit passenden Zitaten Karl Raimund Poppers so ausreichend auseinander, dass ein weiterer Text eigentlich überflüssig ist.
Dann aber fiel mir eine Passage an Schutzbachs Text wieder ein, die doch noch einen näheren Blick lohnt. Die Forscherin schreibt dort über den Zusammenhang „zwischen Antiintellektualismus und dem Imperativ des Markts“ – und bei der selbstverständlich kritischen, emanzipatorischen, aber dann leider nicht weiter erläuterten Haltung zum Marktimperativ bin ich dann doch hängen geblieben.
Denn was eigentlich haben die Gender Studies mit dem Markt zu tun?
“Ich habe viele Feinde, aber das sind alles Arschlöcher!”
Auffällig ist, immerhin, die durchgängig selbstbewusste Weigerung der Gender Studies-Verteidigerinnen, diese Forschungsrichtung entsprechend herkömmlicher Erwartungen zu vermarkten. Kein einziges Mal macht sich eine der Verteidigerinnen die Mühe, vorzustellen, wofür sich die investierten Millionen aus öffentlichen Geldern lohnen – niemand stellt wesentliche Resultate dieser Forschungen vor – manchmal werden die Erfolge der Gender Studies bei der Schaffung und Besetzung von Lehrstühlen sogar kaschiert. Stattdessen stehen immer wieder die Kritiker im Mittelpunkt, die immer wieder irgendwie rechts sind und natürlich Angst vor der Vielfalt haben.
Ich habe viele Feinde, aber das sind alles Arschlöcher! Wer in einem Vorstellungsgespräch gebeten würde, einmal kurz von sich zu erzählen, dem könnte kaum eine dämlichere Antwort einfallen als diese. Wenn aber Gender-Forscherinnen in überregionalen Medien für ihre Forschung werben, haben sie aus unerfindlichen Gründen den Eindruck, es gäbe zu diesem Satz überhaupt keine vernünftige Alternative.
Es ist tatsächlich eine Anforderung des Marktes, die sie hier ignorieren. Sie kommen gar nicht erst auf die Idee, Menschen zu demonstrieren, dass es sich lohnt, Geld in das zu investieren, was sie anzubieten haben. Stattdessen moralisieren sie unbekümmert und erwecken den Eindruck, dass jeder der Reaktion zuarbeite, der sie nicht unterstützt.
Würde Coca Cola damit Werbung machen, dass ganz gewiss die Nazis bald an die Macht kommen, wenn Menschen Pepsi statt Coke kaufen – dann würde diese Werbung recht bald recht vielen Menschen ausgesprochen unseriös vorkommen. Zur Verteidigung der Gender Studies hingegen ist, so scheint es, eine andere Werbestrategie nicht einmal denkbar.
“Die Gender Studies sind das Fach, in dem Studentinnen lernen, dass es zu wenige Frauen in den MINT-Fächern gibt”
Durch das unbekümmerte Moralisieren entziehen sich die Autorinnen allerdings tatsächlich einer erheblichen Provokation, die mit dem Denken in Kategorien des Marktes verbunden ist. Wer sich auf dem Markt behauptet, muss lernen, sich selbst im Lichte der Interessen anderer zu sehen. Es reicht nicht, wenn ich etwas zu bieten habe, dass ich ungeheuer wertvoll finde – wenn es für andere keinen Wert darstellt, kann ich nicht erwarten, dass sie mir dafür eine Gegenleistung bieten oder mir etwas dafür bezahlen.
Ein Beispiel: Für mich gehört die Tatsache, dass unser Sohn existiert, zum größten Glück, das ich erlebe und jemals erlebt habe. Dass ich ihn aber als Trennungsvater alle zwei Wochenenden besuche, dafür Geld, Zeit und Nerven investieren muss – das ist in einer neuen Beziehung zu einer Frau eher eine Belastung. Was für mich ein ungeheures Glück ist, ist zugleich geeignet, auf dem Partnermarkt meinen Wert einzuschränken.
Das ist nicht böse, inhuman oder kinderfeindlich. Wenn eine Partnerin erlebt, dass sie sich auf Einschränkungen meiner Zeit einstellen muss – wenn sie miterlebt, wie abhängig ich oft von den Vorgaben und auch Launen der Mutter bin, wenn sie gar mit in diese Abhängigkeiten gerät – dann ist es völlig nachvollziehbar, dass sie, in Begriffen des Markts formuliert, ihre Nachfrage gegebenenfalls überdenkt oder selbst nur ein kleineres Angebot macht.
Ich schreibe das überhaupt nicht verbittert (ich komme ganz gut klar damit). Es ist aber ein wichtiger Punkt: In keinem einzigen Text zur Verteidigung der Gender Studies habe ich auch nur den Versuch gefunden, vorsichtig zu erwägen, was diese Forschungen denn eigentlich denjenigen Menschen bedeuten könnten, die sie finanzieren müssen. Die Autorinnen beharren jeweils, wie festgetackert, auf ihrer eigenen Perspektive – und sie skandalisieren die Idee, dass sie auch die Perspektiven anderer berücksichtigen müssten.
Dabei sind sie diese Überlegung, wenn schon nicht der Öffentlichkeit, vor allem ihren Studentinnen schuldig. Wer sollte denn eigentlich, und wo, und wofür, Menschen brauchen, die es gelernt haben, Geschlechter als Herrschaftskonstruktionen einer heterosexuellen Matrix zu interpretieren oder nachzuweisen, dass selbst der Unterstrich in Student_innen noch sexistisch ist und eigentlich alle Worte mit einem x enden könnten.
Sicherlich: Es gab an Universitäten lange schon Orchideenfächer, deren Nutzen für die Allgemeinheit nicht unmittelbar einleuchtend war und ist. Deren Vertreter können aber immerhin argumentieren, dass die Aufrechterhaltung von ein bis zwei Lehrstühlen sich lohnt, wenn dadurch ein Wissen bewahrt bleibt, das sonst verloren ginge.
In den Gender Studies aber geht es nicht um einen oder zwei Lehrstühle, sondern um weit über hundert. Es ist völlig erwartbar, das angesichts dieser Größenordnung Nachfragen drängender werden – und so ist es auch folgerichtig, dass Vertreterinnen des Faches versuchen, mit Definitionstricks die Zahl der eingerichteten Gender-Lehrstühle so weit wie möglich herunterzurechnen.
Was aber haben die vielen Studentinnen und wenigen Studenten dieses Faches davon? Die Gender Studies sind das Fach, in dem Studentinnen lernen, dass es zu wenige Frauen in den MINT-Fächern gibt: Diese Sottise macht ja immerhin deutlich, dass hier Hunderte von Menschen vermutlich weitgehend am Markt vorbei studieren.
Die einzige erkennbare Strategie dagegen ist, mit noch größerem politischen Druck öffentliche Institutionen und Unternehmen zur Einrichtung von Stellen zu zwingen, von denen die dann meist selbst gar nicht wissen, wozu sie sie brauchen. Das ist unredlich gegenüber denen, die das finanzieren – und es ist verantwortungslos gegenüber denen, die das Fach studieren und die dann völlig verständnislos auf die Erfahrung reagieren, dass ihre Ausbildung am Arbeitsmarkt einen sehr geringen Wert hat.
Studienziel bürgerliche Ehefrau
Gerade weil Gender-Vertreterinnen Marktlogiken ignorieren, geraten sie so umso tiefer und rettungsloser in diese Logiken hinein. Wer Gender Studies studiert, begibt sich damit offenkundig in eben die klassische Position bürgerlicher Frauen, die dort doch angeblich so entschlossen dekonstruiert wird. Es ist ein Studium in die finanzielle Abhängigkeit von Männern hinein: Entweder in die Abhängigkeit von einem Partner, der eine marktgerechtere Ausbildung hat, oder in die Abhängigkeit von öffentlichen Mitteln, deren Löwenanteil ja auch von Männern erwirtschaftet wird.
Eben das ist aber eine wesentliche Funktion einer bürgerlichen Ehefrau: Sie erhält die Illusion aufrecht, ein Leben außerhalb der Marktzwänge sei möglich – doch um ihr diesen Freiraum freizusperren, muss der Mann sich nur umso intensiver diesen Zwängen unterwerfen, weil er nicht allein sich selbst, sondern auch sie finanzieren muss.
Wenn sie ihm das dann auch noch moralisierend zum Vorwurf macht, ihre eigene scheinhafte Distanz zum Markt als kritisch, seine Verstrickung in Marktlogiken als „antiintellektuell“ oder „gefährlich“ hinstellt – dann ist die Verkehrtheit ihrer Position gegen Kritik weitgehend immunisiert und kaum noch aufzulösen.
Die Distanz, die Schutzbach zum „Imperativ des Markts“ herstellt, entspricht so der traditionellen Verachtung des Adels für die Zwänge bürgerlicher Erwerbsarbeit. Es ist keine emanzipatorische, sondern eine reaktionäre Distanz – und so ist es auch schlüssig, dass Schutzbach ganz darauf verzichtet, ihre eigene Position darzustellen, sondern sich stattdessen über die Diffamierung von Kritikern definiert.
Dabei gäbe es ja dringliche Gründe für eine Kritik an Marktlogiken – es ist nur illusorisch zu glauben, dass es simple Alternativen zu ihnen gäbe, wenn Menschen denn einfach nur den guten Willen dazu hätten. Verglichen mit den Alternativen der Verhaftung in dörflichen oder familiären Strukturen ist die Logik des Marktes beispielweise für die von Schutzbach schlagworthaft geforderte „Gleichheit in der Differenz“ deutlich besser geeignet.
Mörderisch aber wird die Marktlogik, wenn die Positionen der Beteiligten massiv ungleich sind. Diejenigen, die in einer schwachen Position leben, werden dadurch unendlich erpressbar, müssen immer mehr investieren, um immer weniger zu erhalten – während diejenigen, die in einer starken Position agieren, schlicht ihren Besitz für sich arbeiten lassen können.
Problematisch ist die Marktlogik also nicht durch die Provokation, dass Menschen sich selbst im Lichte der Interessen anderer beurteilen müssen. Diese Provokation ist prinzipiell zivilisierend – und doch ist es ausgerechnet dieser zivilisierende Aspekt, der Verteidigerinnen der Gender Studies offenkundig abschreckt.
Dafür ignorieren sie etwas Offensichtliches: Dass die rapide wachsenden ökonomischen Ungleichheiten zivile Marktlogiken sprengen und Menschen in Erpressbarkeit und Elend treiben. Von dieser Inhumanität lenkt eine Geschlechterforschung und -politik durchaus systematisch ab, wenn sie die ihrerseits inhumane Illusion zementiert, ein Leben außerhalb von Marktlogiken sei möglich und stünde einigen Menschen schlicht zu – während andere Menschen sich umso mehr zu veräußern hätten, um ihnen das zu ermöglichen.
Die Gender Studies, die Schutzbach präsentiert, kritisieren nicht das, was an Marktlogiken verkehrt ist, ganz im Gegenteil. Sie reproduzieren diese Verkehrtheit, zementieren sie und kaschieren sie zugleich durch die Fixierung auf Geschlechterkategorien, die für Marktlogiken unerheblich sind. Sie analysieren keine Verkehrtheit, sondern produzieren gleichsam eine Verkehrtheit zweiter Ordnung – offenbar abgeschottet gegen Kritik und hoffnungslos in sich selbst vertüdelt.
So ist es denn auch verständlich, dass Verteidigerinnen der Gender Studies eher verstecken, was dort getan wird, als dass sie es selbstbewusst und stolz präsentieren würden.
Der Artikel erschien zuerst auf man tau.