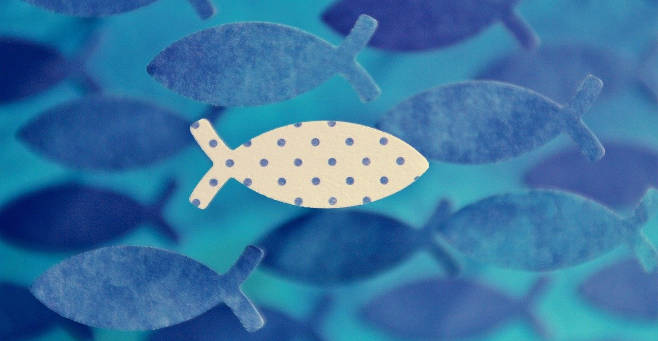Milton Friedman, Richard Nixon und „Affirmative Action“
In Milton Friedmans Klassiker „Kapitalismus und Freiheit“ stellte der us-amerikanische Ökonom fest: „Es ist eine auffallende historische Tatsache, dass die Entwicklung des Kapitalismus begleitet war von einer beträchtlichen Abnahme des Ausmaßes, in dem bestimmte religiöse, rassische und soziale Gruppen unter besonderen Behinderungen in Bezug auf ihre wirtschaftliche Entfaltung leben mussten, mit anderen Worten diskriminiert wurden.“

In „Kapitalismus und Freiheit“ lieferte Friedman zu gleich die Erklärung für dieses Phänomen. In der Regel interessiert es uns als Verbraucher wenig, von wem und unter welchen Umständen ein Gut, das wir erwerben, produziert worden ist. Für den Verbraucher zählen in erster Linie die Qualität und die Kosten eines Gutes. Die Hautfarbe, das Geschlecht, die Religionszugehörigkeit derjenigen, die das Gut produzierten, spielen für die Verbraucher selbst dann kaum eine Rolle, wenn diese im privaten Leben durchaus Vorurteile oder persönliche Abneigungen gegen die Angehörigen einer bestimmten Gruppe hegen.

Ebenso verhält es sich mit den Unternehmern. Ein Unternehmer mag als Privatmann in Vorurteilen befangen sein, als Marktteilnehmer kann er sich in der Praxis der Unternehmensführung diese Vorurteile umso weniger leisten, desto härter der Wettbewerb ist, unter dem sein Unternehmen agieren muss. Der Unternehmer kann sich weder seine Beschäftigten noch seine Kunden frei aussuchen. Er ist nur so weit „Herr im eigenen Haus“, als dass er selbst nach Wegen suchen muss, damit seine betriebswirtschaftliche Rechnung aufgeht. Damit er im Wettbewerb bestehen kann, muss der Unternehmer die effizientesten Mitarbeiter anstellen, die er auf dem Arbeitsmarkt gewinnen kann und so viele Kunden wie möglich dazu bewegen, die von ihm angebotenen Produkte und Dienstleistungen zu kaufen. In einem System freien Wettbewerbs konkurrieren die Unternehmen um die Kunden und um qualifizierte Arbeitskräfte. Unternehmer, die aufgrund persönlicher Vorurteile auf Kunden oder qualifizierte Mitarbeiter verzichten, sind gegenüber den Konkurrenten, die das nicht tun, im Nachteil. Das ist der Grund, warum die Marktwirtschaft die Tendenz zeigt, Unterschiede einzuebnen und Diskriminierungen abzubauen.
Wie Friedman zu Recht feststellte, bedeuten Antidiskriminierungsgesetze hingegen, einen sehr ernsthaften Eingriff in die Vertragsfreiheit. Auf einem freien Markt kann der potentielle Käufer selbst darüber entscheiden, ob er ein Gut erwerben will oder nicht. Auch der Unternehmer befindet sich in der Situation, darüber entscheiden zu müssen, ob er eine zusätzliche Arbeitskraft einstellen will oder nicht. Daraus folgt, dass der Unternehmer berechtigt sein sollte, sich seine Mitarbeiter nach eigenen Vorstellungen auszusuchen. Denn die Vorschrift, einen Arbeitnehmer nach bestimmten Kriterien einstellen zu müssen, bedeutet faktisch einen Kaufzwang. Friedman kommentiert diesen Eingriff auf die folgende Weise: „Wie schon betont ist es für diejenigen unter uns, die der Meinung sind, dass ein bestimmtes Kriterium, wie die Hautfarbe, irrelevant sei, angebracht, unsere Mitmenschen zu überzeugen, der gleichen Ansicht zu sein. Nicht angebracht ist jedoch die Anwendung von Zwang durch die Staatsgewalt, um sie dazu zu zwingen, in Übereinstimmung mit unseren Prinzipien zu handeln.“
Als Friedman die erste Ausgabe seines Buches 1962 veröffentlichte, spiegelte sich darin noch ein allgemeiner Konsens der amerikanischen Gesellschaft wider. Das Ideal der Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre, die sich gegen die Diskriminierung von Schwarzen richtete, war die „farbenblinde“ Gesellschaft, in der, wie Martin Luther King es ausdrückte, nicht die Hautfarbe, sondern der individuelle Charakter zählen sollte. Daraus ergab sich fast selbstverständlich die Ablehnung nicht nur der negativen, sondern auch der positiven Diskriminierung durch die Anwendung von Quotenregelungen. Denn auch eine Gesellschaft, die positiv diskriminiert, kann nicht farbenblind sein. Eine Gesellschaft, die Frauen positiv diskriminiert, kann nicht geschlechterneutral sein. Die Festlegung von Kriterien positiver Diskriminierung führt nicht zur Überwindung kollektiver Zuschreibungen, sondern zu ihrer juristischen Verankerung. Um Farbige, Frauen, Homosexuelle oder andere Minderheiten positiv diskriminieren zu können, müssen „objektive“ Kriterien definiert werden, um überhaupt feststellen zu können, ob jemand in die Kategorie fällt, auf die die Bevorzugung angewendet werden soll. Auf diese Weise tragen Quoten zur Reproduktion der Separation bei.

Das zeigt auch die Geschichte des Konzepts von „Affirmative Action“, der amerikanischen Form der Quotenregelung, die im Spektrum der republikanischen Partei entwickelt wurde. Der politische Vater der positiven Diskriminierung war Präsident Richard Nixon. Der Historiker Kevin Yuill hat Nixons Motivation zur Einführung positiver Diskriminierung in seinem Buch „Richard Nixon and the Rise of Affirmative Action“ untersucht. Wichtige Motive für Nixon waren die Absicht, die Bürgerrechtsbewegung zu spalten und nach dem Prinzip „devide et impera“ verschiedene ethnische Gruppen durch Privilegien an den Staat zu binden und sie bei Bedarf gegeneinander ausspielen zu können. Hinzu kamen die bei Nixon und in seinem Umfeld verbreiteten Vorstellungen genetischer Unterschiede zwischen den ethnischen Gruppen. Die Annahmen, die Nixons Politik der Förderung ethnischer Minderheiten zu Grunde lagen, stützten sich teilweise auf umstrittene Ergebnisse der Intelligenzforschung.
Es ist eine Ironie, dass sich heute ausgerechnet die Strömungen die Forderungen nach Quotenregelungen zueigen gemacht haben, die ethnische Zugehörigkeit und Geschlecht gemeinhin für „konstruiert“ halten, obgleich der Konzeption eine extrem essentialistische Vorstellung zu Grunde lag und diese Konzeption ohne essentialistische Kriterien, wie oben beschrieben, überhaupt nicht praktikabel ist. Die Zuteilung von Arbeitsplätzen, Stellen im öffentlichen Dienst, Lehraufträgen, Ämtern und Mandaten usw. nach Quoten ist die Abkehr von der Idee einer farbenblinden, auf dem individuellen Wettbewerb und der Gleichheit vor dem Gesetz aufgebauten Gesellschaft. Ihr liegt implizit die Vorstellung des Vorranges der Gruppenzugehörigkeit gegenüber dem Individuum und der Ungleichheit der Gruppen zu Grunde. Die Quote ist die Manifestation ethnischer, religiöser und sexueller Stereotype und kein Weg zu ihrer Überwindung.
Literatur
- Milton Friedman: Kapitalismus und Freiheit, München 2009.
- Kevin L. Yuill: Richard Nixon and the Rise of Affirmative Action, Oxford 2006.
Bildnachweis: Milton Friedmann