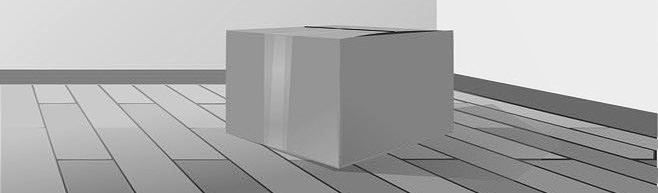Vergesst die Rechten!
Um von Anfang an Missverständnisse zu vermeiden: Ich arbeite mit Personen aus dem konservativen Lager immer wieder gerne für eine lohnende Angelegenheit zusammen. Gelegenheit dazu habe ich beispielsweise bei AGENS, einer die verschiedenen Lager überbrückenden geschlechterpolitischen Initiative, genauso wie bei den bürgerlich Liberalen von „eigentümlich frei“ und Co. Allerdings musste ich im Laufe der letzten Jahre immer wieder feststellen, dass der rechte Rand dieses konservativen Spektrums kein wirklich hilfreicher Ansprechpartner ist – und zwar nicht nur, weil so manche Leute dort dazu neigen, unvermittelt mit ausländerfeindlichen Sprüchen herauszuplatzen. Sondern auch weil dort der Boden wenig fruchtbar ist, wenn es um den Einsatz für Männeranliegen geht.
Um das mal an einem Beispiel zu veranschaulichen: Vor einiger Zeit wurde ich Zeuge einer Diskussion auf Facebook. Einer der Teilnehmer, den ich seinem Profil nach dem Lager der neuen Rechten zuordnen würde, ereiferte sich darüber, wie wenig es in unserer sichtlich zugrunde gehenden Kultur noch ganz normaler Konsens sei, dass ein Mann sein Leben gibt, um das einer Frau zu schützen. Neugierig geworden erkundigte ich mich danach, ob er damit meinte, dass eine Frau ein höheres Recht auf Leben als ein Mann habe. Ich erhielt zur Antwort, ja, so sei es, das wisse man doch schon von Schiffsunglücken, wo es „Frauen und Kinder zuerst“ heiße. Dass man dies überhaupt noch betonen müsse, zeige, wie weit es mit dem Niedergang unserer Kultur schon gekommen sei.
Ich erkundigte mich nun danach, mit welcher Begründung denn eine Gruppe von Menschen ein höheres Recht auf Leben als eine andere genießen solle. Mein neurechter Gesprächspartner teilte mir mit, das sei doch offenkundig: Frauen würden „die Brut“ austragen und seien damit von wesentlich größerer Bedeutung als Männer für den Fortbestand der menschlichen Rasse (von der Nation vermutlich ganz zu schweigen). Dass man dies überhaupt noch erklären müsse, zeige, wie weit es schon gekommen sei mit dem Niedergang und Verfall der abendländischen Kultur. Ich hakte unverdrossen noch einmal nach und erkundigte mich, ob er dann auch der Ansicht sei, dass eine nicht mehr gebärfähige Frau ein geringeres Recht auf Leben habe als eine, die in der Lage ist, noch viele Kinder auszutragen. Mein inzwischen immer mürrischer gewordener Gesprächspartner grummelte etwas davon, dass ich allmählich auf den Trichter kommen würde zu kapieren, wie in einer gesunden Volksgemeinschaft die Hierarchie des Recht auf Lebens geregelt sein sollte. Andere Männer aus seinem politischen Umfeld begannen ihm beizuspringen. Gegenwind bekam er außer von mir bezeichnenderweise nur von einer Frau, die seine Einstellung als so reaktionär bezeichnete, wie sie war: entweder weil diese Frau die Etablierung der hierarchiefreien Menschenrechte noch mitbekommen hatte, die für meinen Gesprächspartner wohl nur ein weiteres Verfallssymptom unserer Gesellschaft darstellten, oder weil sie witterte, dass mit dem angeblichen höheren Lebensrecht von Frauen, von dem man auf Facebook schnell daherschwadronieren kann, solange man nicht selbst in Todesgefahr schwebt, Regelungen verbunden sind, die für eine Frau im Jahr 2012 nicht nur von Vorteil sind. Wenn beispielsweise Taliban ihre Frauen nicht ohne Begleitung aus dem Haus gehen lassen, dann ganz sicher nur in dem wohlmeinenden Interesse, deren höheres Recht auf Leben so gut wie nur irgend möglich zu schützen … Im kulturell verfallenden Deutschland hingegen dürften sich die Frauen dieselbe Regelung trotzdem nicht gefallen lassen, nicht einmal in jenen großstädtischen Gegenden, wo angeblich der messerwetzende Muselmane schon mordgeil hinter der nächsten Litfassäule lauert.
Der Denkansatz, den ich im Jahr 2012 auf Facebook präsentiert bekam, ist in meinen Augen nichts anderes als faschistoid: Das Lebensrecht des Einzelnen hat gefälligst hinter dem Kollektiv bzw. der Volksgesundheit zurückzustehen! Mit dieser Art zu denken hat Hitler Männer an die Front getrieben und Juden ins KZ. Kaum ein Jude allerdings dürfte lautstark darauf beharrt haben, dass sein Recht auf Leben zugunsten eines starken Kollektivs zurückzustehen habe. Auf einen derartigen Blödsinn, sich selbst ein geringeres Lebensrecht einzuräumen, kommt nur eine einzige gesellschaftliche Gruppe, nämlich die Männer – und die vom rechten Rand munter vorneweg. Denn bei ihnen gibt es ein Totschlagargument, das die Linken nicht kennen, und das lautet „Das ist nun mal so“, „Das war schon immer so“, „Das will die Natur“, „Das will Gott“, „Alles andere ist neumodischer Quatsch und bedeutet den Untergang unserer Kultur“. Es heiße bei Unglücken nun mal „Frauen und Kinder zuerst“, und wenn es so heißt, dann wird das schon seinen Grund haben und hat gefälligst nicht hinterfragt zu werden.
Und trotzdem ist es seltsam, wenn sich eine Gruppe ihre grundlegendsten Rechte selbst beschneiden möchte. Wie kommt es zu einer derart kuriosen Einstellung? Eine mögliche Erklärung findet man in John McLeods Buch Beginning Postcolonialism. Darin berichtet Sam Selvon, ein in Trinidad aufgewachsener dunkelhäutiger Schriftsteller, von seiner Kindsheiterinnerung an einen Fischer namens Sammy in San Fernando, Sevlons Heimatort in Trinidad. Sammy war teilweise gelähmt und hatte deshalb Schwierigkeiten, seinen Alltag zu bewältigen, bis er eines Tages einen weißen Helfer an die Seite gestellt bekam. In Sevlon – wie gesagt, damals noch ein Kind – entstand daraufhin großer Zorn. Dass ein Ureinwohner Trinidads einen weißen „Diener“ erhielt, stellte die Welt für ihn auf den Kopf. Es bedeutete eine schier unerträgliche Unordnung, hatte Sevlon doch sein ganzes kurzes Leben über gelernt, dass es sich immer genau umgekehrt verhielt. Der Weiße hatte der Herr zu sein und der Farbige der Diener. Bedeutete das, was hier geschah, nicht den Untergang einer Kultur, die ordentlich und richtig war?
Auch Sam Sevlon gehörte als Kind also zu jenen, die sich selbst einen geringeren Status zusprechen, weil das ihrer Wahrnehmung von der selbstverständlichen Ordnung der Dinge entspricht. So wie Sevlon die Ideologie verinnerlicht hatte, die den Kolonialismus begleitete, haben viele Männer insbesondere im rechten Spektrum eine Kultur verinnerlicht, die vielfach zu ihren eigenen Lasten geht. Als etwa beim Bau des Panamakanals circa 25.000 Männer ihr Leben verloren und ziemlich genau null Frauen, kam kein Mensch auf die Idee zu fragen, ob in unserer Kultur vielleicht ein winziges Ungleichgewicht gegenüber Männern besteht. Es interessiert sich schließlich auch heute noch keine Socke dafür, dass von 59.543 Minenarbeitern, die in China innerhalb von zehn Jahren durch ihren Beruf zu Tode gekommen sind, die Frauenquote bei Null liegt. Oder dass bei den toten Feuerwehrleuten, die man aus den Trümmern des World Trade Centers barg, von keiner einzigen Frau berichtet wurde. Über das vernichtete Leben von Männern geht man wesentlich leichter hinweg, und an dieser jahrtausendealten Tradition hat ein Feminismus, der angeblich die Geschlechterverhältnisse auf den Kopf stellte, exakt gar nichts geändert, sondern sie nur noch fester einzementiert.
Trotzdem sehe ich auf der Seite der Linken ein weit größeres Potential, vermeintlich naturgegebene Es-war-schon-immer-Sos zu hinterfragen. Kaum ist diese Vermutung ausgesprochen, kann man die Linkenhasser schon schnauben hören: Als ob die „taz“ oder der „Freitag“ oder die „junge welt“ ein einziges Mal etwas Vernünftiges zum Thema Männerdiskriminierung geschrieben hätten, während die hochgepreisene „Junge Freiheit“ ja sogar eine Titelgeschichte … Ja, genau das, EINE Titelgeschichte vor einigen Jahren, an der sich die rechten Maskulisten noch immer festzuklammern versuchen. Noch Tage nach diesem Ausnahmefall war die Stimmung, wie man mir berichtete, in der Redaktion der „Jungen Freiheit“ dermaßen mies wie noch niemals zuvor, weshalb man, versicherte man mir, dieses Thema so schnnell bestimmt nicht wieder aufgreifen würde. „Männer als Opfer“, das ist kein Thema für einen rechten Mann, der doch so gerne als deutsche Eiche erscheinen möchte und unerschütterlicher Fels. Auf den Feminismus draufhauen, ja, das ist etwas anderes, der gehört zu den üblen 68ern, die an der Verweiblichung des deutschen Mannes Schuld seien. Und obwohl sich auch die stramm konservativen Schweizer Männer tausendmal lieber als Antifeministen bezeichnen denn als Männerrechtler, war die Schweizer „Weltwoche“, die sich im politischen Spektrum ähnlich rechtskonservativ wie die „Junge Freiheit“ positioniert, von diesem Thema komplett überfordert und spottete derart über angeblich „wehleidige Memmen“, dass René Kuhn mit „Der gefüchtete Mann“ selbst einen Gegenartikel dazu verfassen musste. Die stramm rechte SVP wolle dasselbe Tabu erhalten wie die Linksradikalen, erklärte Kuhn darüber hinaus im Interview mit „eigentümlich frei“.
Grundsätzlich scheinen Linke über eine größere Fähigkeit zur Empathie zu verfügen, ob gegenüber Einwanderern, Frauen, sozial Schwachen, sexuellen Minderheiten … nur bei heterosexuellen Männern ist diese Empathie noch nicht angekommen. Aber auch hier müssen die Kempers, Gesterkamps, Aigners und Rosenbrocks schon massiv mit der Nazikeule drohen: Wer für Männer Mitleid und Einfühlungsvermögen zeigt, der, so heißt es, betreibe eine „Opferideologie“. Dieses und ähnlich abwertende Formulierungen über Männer, die über Opfererfahrungen sprechen, kommen beispielsweise in Hinrich Rosenbrocks Kampfschrift Dutzende Male vor. Rosenbrock tut sich mit Männern als Opfern ebenso schwer wie die „Weltwoche“ und die „Junge Freiheit“. Hier schießt selbst bei den vermeintlichen Bannerträgern der Linken ein erzreaktionäres Denken hoch, das weit besser in die erste Hälfte des vergangenen Jahrhunderts passt als in die Gegenwart.
Aber es ist nicht nur das größere Empathievermögen, das ich jenseits der erwähnten Gestalten eher auf der linken Seite liegen sehe. Es ist auch das stärkere Bewusstsein für Demokratie und gegen eine Hierarchisierung bei der Linken, weshalb man dort eher kapieren dürfte, dass Männer ein ebensolches Recht auf eine Befreiungsbewegung haben wie Frauen. Und es wird die Bereitschaft vieler Linker für progressive Tabubrüche und Regelüberschreitungen sein, die es ihnen weit eher als Rechten ermöglicht, sogar Männer als Opfer zu sehen, obwohl denen von den Essentialisten der Geschlechterdebatte doch die Täterrolle auf den Rücken gebrannt wurde. Die Hoffnung in diesem Bereich ausgerechnet auf die traditionsbewusste Rechte zu setzen ist eine Illusion.
Fakt hingegen ist: Die Partei, die Monika Ebeling in Goslar am engagiertesten aus ihrem Job mobbte, war die FDP. Fakt ist auch: Die Abschaffung der männerfeindlichen Wehrpflicht wurde zwar endlich von einem Konservativen durchgesetzt – wäre es aber nach den linken Grünen gegangen, hätten wir das schon Jahrzehnte früher haben können. Fakt ist: Alice Schwarzers ominösem „Frauenturm“ wurden Unsummen von Steuergeldern erst vom konservativen Landesvater Jürgen Rüttgers überwiesen, dann wurden die Zahlungen von rot-grünen Politikerinnen zurückgefahren und schließlich drehte die konservative Kristina Schröder den Geldhahn wieder auf. Fakt ist: In der Pornographie-Debatte argumentieren radikale Feministinnen und konservative Fundamentalisten fast identisch, dementsprechend wurde die Anti-Porno-Bewegung in den USA am stärksten von Ronald Reagan und seinen Jungs gepusht. Fakt ist auch: Altbackene Männerfeindlichkeit gibt es ebenso in der CSU, wie diese Partei in ihren Reihen die Frauenquote durchgesetzt hat. (Eine eher linke Partei wie die Piraten lehnt die Quote ab.) Dass Alice Schwarzer als Wahlfrau für die CDU und bekanntestes BILD-Mädchen enden würde, konnte für niemanden mehr eine große Überraschung sein. Weite Teile des Feminismus waren schon immer rechts. Und aus dem bekannten offenen Brief Dr. Matthias Stiehlers, Vorstand des Dresdner Institut für Erwachsenenbildung und Gesundheitswissenschaft, dem zufolge in der Geschlechterdebatte die Linken die neuen Konservativen sind, folgt noch lange nicht, dass in dieser Debatte die Rechten die neuen Progressiven darstellen.
Stattdessen handelt es sich um ein Kontinuum: Der Mainstream echter Konservativer pflegt ein Ideal von Männern, wie sie der Staat vor über 50 Jahren haben wollte: zäh wie Leder, flink wie Windhunde, hart wie Kruppstahl. In dieser Welt sollen Männer Frauen in erster Linie ernähren und verteidigen. Auf dem halben Weg steckengeblieben sind die von Stiehler beklagten „linken Konservativen“. Ginge es nach ihnen, sollten Männer so sein, wie sie der Staat seit den siebziger Jahren haben wollte: Softis und neue Väter. Diese sollten Frauen in erster Linie Selbstverwirklichung im Beruf ermöglichen. Noch einen Schritt weiter nach vorne gehen die progressiven Linken in der Männerrechtsbewegung. Sie sagen: Vergesst die Forderungen von Staat, Wirtschaft und Medien und findet stattdessen endlich heraus, was ihr Männer selbst von eurem Leben wollt!
Im Moment haben wir in der Geschlechterdebatte den Zustand, der auf George Orwells „Animal Farm“ herrschte, nachdem der brutale Bauer Jones vom Hof vertrieben war, unter den zurückgelassenen Tieren aber die Schweine die Herrschaft übernommen hatten. Das geschah bekanntlich unter der Parole „Alle Tiere sind gleich, aber einige Tiere sind gleicher“. Tiere, die dagegen protestierten, hielt man entgegen, sie wollten doch wohl kaum die Knechtschaft unter Bauer Jones wiederhaben. In ähnlicher Weise polemisiert mancher heute, wer eine einseitige Geschlechterpolitik ablehne, wolle offenbar zurück in die fünfziger Jahre. Das ist es aber nicht, was linke Männerrechtler wollen. Sie möchten weiter nach vorne: dorthin, wo kein Tier „gleicher“ als das andere ist.
Die Themen für eine linke Männerrechtsbewegung liegen auf der Straße. Wenn etwa die Oberschichtfrau bei uns heute 15 Jahre länger lebt als der Unterschichtsmann, dann wird es Zeit, diese Ungleichheit nicht nur mit Blick auf die Hierarchie der Klassen zu betrachten und die Diskriminierung, die über das Geschlecht erfolgt, auszublenden. Wenn geschätzte neunzig Prozent aller Obdachlosen männlich sind, dann sollten linke Männerrechtler auch dann weiterfragen, woran das liegt, wenn sie deswegen von konservativen Linken als Rechtsextreme verleumdet werden. Wenn eine Studie belegt, dass über die Schulbildung soziale Herkunft und das Geschlecht bestimmen (zu Lasten des männlichen Geschlechts nämlich), dann beschränken sich linke Männerrechtler nicht nur auf die Bekämpfung jenes Teils der Diskriminierung, die durch die soziale Herkunft entsteht, sondern thematisieren auch Benachteiligung durch das Geschlecht. Wenn Rassisten einen männlichen Migranten der Unterschicht nur als potentellen Messerstecher sehen, dann weisen linke Männerrechtler darauf hin, dass hier mit Rassismus und Klassismus auch Sexismus eine unheilvolle Verbindung eingeht. Und wenn kapitalistische Unternehmen ihre Produkte dadurch verkaufen möchten, dass sie Reklame schalten, die eines der beiden Geschlechter diffamiert, dann protestieren linke Männerrechtler auch dann dagegen, wenn das auf breiter Front diffamierte Geschlecht das männliche ist. Vor einem entfesselten Kapitalismus, der selbst Liebesbeziehungen den Gesetzen der Ökonomie unterwirft und die Kompetenz von Frauen auf die kundige Verwendung ihrer Vagina reduziert, warnte im übrigen das AGENS-Gründungsmitglied Professor Gerhard Amendt unlängst im Deutschlandradio. Und auch das ist eine linke, progressive Form der Kritik.
Derzeit wiederholen radikale Feministinnen ebenso gebetsmühlenhaft wie radikale Maskulisten, dass eine Männerrechtsbewegung nur am rechten Rand des politischen Spektrums beheimatet sein könne. Zehntausend Wiederholungen machen aus einer falschen Behauptung aber noch lange keine Wahrheit. Vielmehr zeigen die ständigen Wiederholungen, wie sehr man den Leuten etwas einzuhämmern versucht, das diese so ganz und gar nicht überzeugend finden. Und sie haben Recht: Die Zukunft der Männerbewegung liegt zwar nicht bei den linken Dogmatikern zwischen Heinrich-Böll-Stiftung und taz, sehr wohl aber bei den linken Liberalen. Denn dort gibt es die größte Hoffnung, sich von überholten Rollenkorsetts zu befreien und jeden Einzelnen nach seiner Facon selig werden zu lassen.