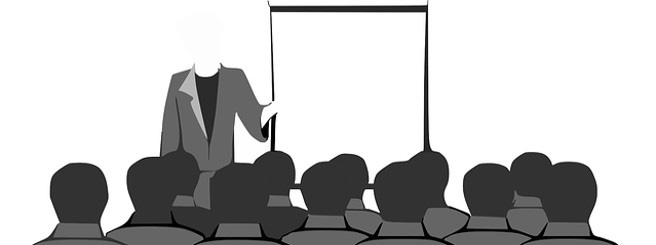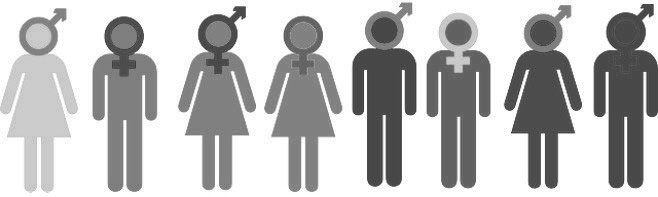Von der Frauenemanzipation zur Frauenprivilegierung
Warum die Gleichstellungspolitik keine linke, sondern eine rechte Politik ist
Gleichheit meint in logischer Hinsicht immer die Gleichheit des Verschiedenen, denn sonst würde es sich um Identität handeln. Nur was verschieden ist, kann gleich sein. Gleichheit meint weder Identität noch enthält sie den Impuls, Ungleiches gleich machen zu wollen, sondern sie betont die Gleichwertigkeit der Verschiedenen, ohne die Unterschiede biologischer, ethnischer oder kultureller Art zu verleugnen. Die Verleugnung biologischer Unterschiede zwischen Männern und Frauen durch ein kulturalistisches Rollenkonzept ist demgegenüber für Teile der zweiten Frauenbewegung ab 1968 konstitutiv, z. B. in den – wissenschaftlich fragwürdigen – Gender Studies.
Der politische Begriff der Gleichheit stammt begrifflich aus den deutschen Bauernkriegen und insbesondere aus dem Zieldreieck der Großen Französischen Revolution von 1789:
liberté, égalité, fraternité!
Freiheit und (soziale) Gleichheit und Brüderlichkeit (oder Gemeinschaftlichkeit, Solidarität): Diese drei wechselseitig aufeinander bezogenen Leitbegriffe können nicht ohne schwerwiegende Verzerrungen voneinander gelöst werden. Geschieht das aber dennoch, wie z. B. durch die Isolierung und die einseitige, libertäre Steigerung der Freiheit im Neoliberalismus des Friedrich August von Hayek und in den Austrian Economics der heutigen USA, dann ergibt sich daraus das Gegenteil dessen, was mit dem Zielsystem der Französischen Revolution gemeint und beabsichtigt war.
Im Hayek´schen Rechtsliberalismus wird folgerichtig gegen die soziale Gleichheit polemisiert, und es wird die soziale Ungleichheit positiv bewertet. Der Begriff der Gleichheit und der Freiheit in der Französischen Revolution wurde jedoch kritisch-verneinend gegen die Ungleichheit und die Unfreiheit der spätfeudalen Ständegesellschaft gewendet, denn sie war es, die nicht länger sein sollte. Die soziale und ökonomische Privilegierung des Klerus und des Adels, die politisch und ökonomisch zu Lasten des Bürgertum ging, war Stein des Anstoßes.
Ob eine Position eine politisch linke oder rechte ist, hängt nicht von den subjektiven Vorstellungen der Menschen ab, sondern sie bemisst sich an der Bewertung der sozialen Gleichheit einerseits und der sozialen Ungleichheit andererseits. Eine politisch linke, also emanzipative Politik fördert eine soziale Gleichheit, z. B. im Sinne gleicher Berechtigungen oder der Chancengleichheit, und sie wendet sich daher gegen Privilegien, während eine rechte Politik Ungleichheit durch Privilegierungen anstrebt, weil sie diese positiv bewertet und weil sie bestimmten Interessen entspricht. Da nun die Gleichstellungspolitik, wie weiter unten noch gezeigt wird, nicht auf Chancengleichheit abzielt, sondern darauf, in diskriminierender Weise zu Lasten von Männern Privilegien für bestimmte minoritäre Frauengruppen zu schaffen, handelt es sich nicht etwa, wie sie selbst subjektiv meint und vorgibt, um eine linke, sondern im Gegenteil um eine objektiv rechte Politik.
In der bürgerlichen Gesellschaft konnte, anders als in der ständischen Gesellschaft, in der Klerus und Adel durch Standeszugehörigkeit sozial privilegiert und die anderen sozialen Klassen und Schichten, insbesondere das Bürgertum und der sogenannte Vierte Stand – die Arbeiterschaft –, diskriminiert waren, erstmals eine formelle Rechtsgleichheit hergestellt werden.
In Deutschland wurde dieses Ziel durch die Stein-Hardenbergschen Reformen und die Revolution von 1848 eingeleitet,aber erst durch die Novemberrevolution von 1918 voll verwirklicht. Dies betraf die Angehörigen des Adels negativ und die Frauen positiv, für die nun endlich der öffentliche Raum geöffnet und zugänglich wurde.
Man muss dabei im historischen Rückblick allerdings bedenken, dass es im 19. Jahrhundert die Regel war, dass Frauen heirateten und zahlreiche Schwangerschaften und Geburten, leider in Verbindung mit einer hohen Mütter- und Säuglingssterblichkeit, erlebten. Diese Lebenswirklichkeit war schwer vereinbar mit einer Berufstätigkeit. Die Töchter des Bürgertums wurden als Höhere Töchter und zukünftige Ehefrauen erzogen und heran gebildet, nicht um zu studieren oder selbst einen Beruf auszuüben. Für besonders ambitionierte oder begabte oder an Heirat und Familie desinteressierte Frauen war das seinerzeit natürlich ein Hemmnis, das sie verständlicherweise nicht akzeptierten. Daraus entwickelte sich die Erste Frauenbewegung, die 1918 endlich zur Gleichberechtigung im Hinblick auf das politische Wahlrecht, den Hochschulzugang und das Berufsleben führte.
Die „Konservative Revolution“ der Nationalsozialisten war mit Rückblick auf die November-Revolution von 1918 eine Konterrevolution. Die Emanzipationsprozesse des 19. und 20. Jahrhunderts wurden annulliert (Judenemanzipation; demokratische Emanzipation) oder – zumindest teilweise und zeitweilig – zurück genommen (Frauenemanzipation).
Die politischen, rechtspolitischen und sozialpsychologischen Nachwirkungen dieser düstersten Periode reichten bis zum Ende der 60er Jahre. Erst die infolge der Studentenrevolte von 1968 – und mit ihr der Zweiten Frauenbewegung – in Gang gesetzten politischen Reformen führten zu einem längeren rechtspolitischen Emanzipations- und Modernisierungsprozess, durch den u. a. die Gleichberechtigung der Geschlechter im Hinblick auf die freie Wahl und Ausgestaltung der gesellschaftlichen Lebenschancen verwirklicht wurde.
Eine soziale Gleichheit hingegen konnte – und kann – wegen der ungleichen Vermögensverteilung innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft prinzipiell nicht erreicht werden, denn dieser entscheidende soziale und ökonomische Unterschied konstituiert und reproduziert die bürgerliche Gesellschaft als Ganze. Sie beruht auf Lohnarbeit einer sehr großen Mehrheit der Bevölkerung, die eben deshalb weitestgehend ohne Vermögen bzw. Kapitalvermögen bleibt – und bleiben muss, damit sich diese ungleiche Struktur reproduziert. Einen Aufstieg in das Besitzbürgertum gibt es auf zwei Wegen, nämlich entweder durch eine erfolgreiche Unternehmensgründung (z. B. SAP) oder durch Heirat (z. B. Liz Mohn, Friede Springer).
Daher stellten und stellen sich die Probleme des praktischen Lebens damals wie heute für Männer und Frauen der Vermögenden ganz anders dar als für Männer und Frauen, die auf Lohnarbeit angewiesen sind – und es von seltenen Ausnahmen abgesehen auch bleiben.
Die gesellschaftlichen Differenzen zwischen Männern und Frauen stellen sich deshalb jeweils zwischen diesen beiden sozialen Lagen – des Besitzbürgertums einerseits und der Lohnarbeiterschaft i. w. S. andererseits – derart unterschiedlich dar, dass weder Männer noch Frauen zu einer Großgruppe zusammengefasst werden können, es sei denn in ideologischer Absicht. Genau das geschieht aber durch die „feministische Dichotomie“, die – ohne Berücksichtigung der Stratifizierung der Gesellschaft – alle Frauen in einer konfrontativen Art und Weise allen Männern gegenüber stellt. Es ist eben nicht das Geschlecht, sondern es ist die soziale Lage, also die Klassen- und Schichtzugehörigkeit, die bis heute das vorherrschende Merkmal ist.
Die Gleichberechtigung ist ein Ausdruck der rechtlichen Gleichheit. Wie es das Wort sagt, geht es um gleiche Berechtigungen im Hinblick auf offene, unverstellte Zugänge zu Studienmöglichkeiten, zu Berufen, zu Karrieren sowie zu allen öffentlichen und politischen Ämtern gleichermaßen für alle Menschen. Die Gleichberechtigung gilt prinzipiell universell, das heißt, kein Mensch, kein Zugang, kein Bereich und kein Prozess (z.B. ein Bewerbungsverfahren) bleibt ausgespart, denn das würde eine Privilegierung und zugleich eine Diskriminierung bedeuten. Gegenwärtig ist z. B. noch das Priesteramt der katholischen Kirche ein solcher Bereich: Frauen werden bezüglich dieses Amtes – aus theologischen Gründen – diskriminiert.
Da vergleichbare andere Diskriminierungen von Frauen fehlen, ist mit dieser Ausnahme seit längerem der Zustand der Gleichberechtigung in der heutigen bürgerlichen Gesellschaft erreicht. Die Gleichberechtigung von Männern und Frauen war von Beginn an eine Verfassungsnorm des Grundgesetzes. Und gegen Diskriminierungen kann heute auch aufgrund des Antidiskriminierungs-gesetzes (AGG) vorgegangen werden. Gleichberechtigung und Nicht-Diskriminierung sind politisch und moralisch universelle Normen, und sie gelten in Deutschland auch juristisch. Daraus erwächst jedoch, wie noch gezeigt werden wird, ein Problem im Hinblick auf die Gleichstellung.
Es ist wichtig zu sehen, dass dieser Zustand der Gleichberechtigung nicht gesteigert werden kann, weil es sich um einen Optimalzustand handelt. Gleichberechtigung öffnet für alle handelnden Subjekte einen Möglichkeitsraum ohne Diskriminierungen, in den sie eintreten und in dem sie nach gleichen Regeln handeln können – oder auch nicht. Aber sie garantiert nicht, das all die individuell anstrebten Ziele auf diesem Wege tatsächlich erreicht werden: Ein Scheitern ist also nicht ausgeschlossen. Ebenso wenig wird damit vorgegeben, wie das Ende des Weges aussehen soll. Gleichberechtigung enthält keine Norm des Sollens im Hinblick auf Ergebnisse. Eine Ergebnisgleichheit, auf die Gleichstellung jedoch abzielt, ist nicht Teil dieser Norm (des Grundgesetzes). Über Ergebnisse entscheiden allein die jeweiligen Prozesse – des Studiums, der Bewerbung, der Arbeit usw. In diesen müssen die Individuen sich entfalten, sich bewähren und sich durchsetzen, und daraus entwickeln sich die jeweiligen Ergebnisse.
Anders gesagt: Eine Tür ist offen oder sie ist es nicht. Wenn sie offen ist, dann ist es allerdings die Sache der einzelnen Personen, hindurch zu gehen und sich damit ebenso wie andere Menschen und ohne Erfolgsgarantie auf diesen, unter Umständen fordernden und anstrengenden Weg voller Ungewissheiten zu machen, oder dies eben nicht zu tun und eine andere Option zu wählen. Diese Entscheidungen sind Ausdruck individueller Präferenzen, und in einer freien Gesellschaft, die die Individuen nicht bevormundet, sind diese Entscheidungen letztgültig und zu respektieren. Eine normative Begründung dafür, hier eingreifen zu dürfen und zu sollen, existiert nicht. Genau dies aber maßt sich die Gleichstellungspolitik an.
Die Gleichstellungspolitik ist ein Projekt der Dritten Frauenbewegung, die die partiell noch emanzipativen Ziele der Zweiten Frauenbewegung hinter sich gelassen hat, und die offen zu einer Politik der Privilegierung von Frauen (der Mittelschicht) durch eine Diskriminierung von Männern übergegangen ist. Die Beschlüsse hierzu können in den Dokumenten der Weltfrauenkonferenz in Beijing aus dem Jahre 1995 nachgelesen werden.
Die Gleichstellungspolitik ist einerseits der Ausdruck einer Unzufriedenheit mit den Ergebnissen der gleichberechtigten Zugänge und Prozesse, andererseits ist sie Ausdruck eines wettbewerblichen Interesses, auf jeden Fall Karriere zu machen, und sei es mit politischer Unterstützung – also einer Art politischer Subventionierung. Dafür wird eine Legitimation benötigt. Diese ist entweder rein subjektiver und nicht überprüfbarer Art, z. B. als bloß gefühlte Diskriminierung, oder sie verweist empirisch auf statistische Unterrepräsentanzen von Frauen und meint irrig, daraus auf die tatsächliche Diskriminierung von Frauen schließen zu können. Der Hinweis auf Unterrepräsentanz, die eine angebliche Benachteiligung von Frauen beweisen oder belegen soll, impliziert die Forderung, dass überall mindestens eine Frauenquote von 50% bestehen oder erreicht werden solle. Aber es wird nicht begründet, warum das so sein soll, und schon deshalb kann aus der Forderung keine gültige Norm werden.
Tatsächlich wird die Frauenquote denn auch nur auf besonders attraktive Berufsgruppen angewendet, und andere Berufsgruppen, die als belastend angesehen werden, bleiben ausgeblendet. Es handelt sich folglich um eine Rosinenpickerei ohne normative Grundlage zum Zwecke egoistischer Karriereförderung, mithin um ein politisch vermitteltes Konkurrenzmanöver außerhalb der Konkurrenz, und zwar nicht etwa, wie ideologisch suggeriert wird, im Interesse aller Frauen, sondern im Gegenteil nur einer eher kleinen Interessengruppe von ambitionierten Frauen speziell der oberen Mittelschicht, vielleicht auch einer Gruppe der Oberschicht, die in Norwegen als Gruppe der „Goldenen Röcke“ bezeichnet wird; Frauen der Oberschicht sind allerdings aufgrund ihrer privaten Großvermögen in der Regel gar nicht auf Berufskarrieren angewiesen. Exemplarisch evident wird das eigentliche Anliegen etwa bei der rein machtpolitischen Forderung, die Aufsichtsräte und Vorstände per Frauenquote zu besetzen; ein bemerkenswertes Beispiel eines Versuches der Selbstprivilegierung übrigens. Es gibt keinerlei Grund, sich diesem Scheinargument zu beugen.
Dieser Teil der Debatte ist für die Lebensprobleme der lohnabhängigen Frauen aus der Unterschicht und der unteren Mittelschicht, das heißt für eine überwältigende Mehrheit aller Frauen, vollständig bedeutungslos, aber der Dritten Frauenbewegung sind deren Lebensprobleme völlig gleichgültig.
Lohnabhängige Frauen ohne besondere Qualifikation haben mehr oder weniger dieselben Probleme wie Männer in derselben sozialen Lage: prekäre statt sichere Arbeitsplätzen, nicht auskömmliche Niedriglöhne statt flächendeckende Mindestlöhne, ggf. ungleicher Lohn zwischen Männern und Frauen ebenso wie regelmäßig zwischen Leiharbeit und regulärer Beschäftigung, Schwächung der gewerkschaftlichen Verhandlungsmacht, Schwächung der Vertretung der Interessen von für Lohn arbeitenden Menschen auf politischer Ebene, Abbau des Sozialstaats, nicht ausreichende oder zu teure kommunale Angebote der Kinderbetreuung, unflexible Arbeitszeitstrukturen, fehlende Ganztagsschulen, sinkendes Altersrentenniveau usw.
Man sieht sofort, dass die Frauenquotendebatte mit all diesen Stichworten einer linken Wirtschafts- und Sozialpolitik überhaupt nichts zu tun hat. Sie hat jedoch etwas zu tun mit den ökonomischen Interessen von qualifizierten Frauen insbesondere der oberen Mittelschicht. Denn sie sind ebenso wie die Männer dieser Schicht am sozialen Aufstieg orientiert, aber diese Aufstiegsmöglichkeit ist keineswegs das die Gesellschaft generell bestimmende Merkmal. Den Mitgliedern der vermögenden Oberschicht ist das ebenso klar wie jenen der Unterschicht. Die einen wissen, dass sie oben bleiben, und die anderen wissen ebenso sicher, dass sie unten bleiben. Nur die untere und obere Mittelschicht findet Arbeitsmarktverhältnisse vor, die eine – meist recht begrenzte – Karriere und damit einen gewissen sozialen Aufstieg ermöglichen, wenn auch zumeist innerhalb des Lohnarbeitsverhältnisses verbleibend, nämlich als Angestellte. Und das drückt sich in einem entsprechenden Angestelltenbewußtein aus.
Stößt dann der soziale Aufstieg im Raum des Mittleren Managements auf Grenzen, dann führt das zu wiederholten öffentlichen Beschwerden über eine angebliche frauenspezifische „gläserne Decke“. Abgesehen davon, ob sich so etwas nachweisen lässt oder nicht, jedenfalls gelingt in den Unternehmen auch nur einer verschwindend geringen Anzahl von Männern der Aufstieg aus dem Mittleren Management in das Top Management, d. h. von der zweiten auf die erste Führungsebene. Nur beschwert sich diese Personengruppe darüber nicht öffentlich. Die zahlreichen männlichen Verlierer im Wettbewerb um weiteren sozialen Aufstieg verzichten darauf, öffentlich eine Forderung nach einer politischen Subvention zu erheben; eine solche Idee dürfte ihnen zu Recht schlicht als absurd erscheinen.
Auch das Scheinargument der Unterrepräsentanz von Frauen ist als Begründung für eine angebliche Benachteiligung von Frauen vollständig unhaltbar. Erstens entscheiden sich die Individuen, wenn auch unvermeidlich immer unter dem mehr oder weniger prägenden Einfluss ihrer sozialen Herkunftsmilieus, nach ihren persönlichen Neigungen und Präferenzen, welchen Lebensplan und welchen Berufsweg sie einschlagen wollen. Darin drückt sich zwar die soziale Lage ebenso aus wie in den empirisch erfassbaren Tendenzen, sogenannte frauen- oder männertypische Berufe zu wählen, aber es erwächst daraus keine begründbare politische Handlungsnorm. Wenn Frauen z. B. weniger Neigung zu technischen Berufen als Männer haben, dann ist das weder eine Benachteiligung noch sonst zu beanstanden. Und dasselbe gilt selbstverständlich, wenn Männer z. B. zu sozialen Berufen weniger Neigung haben als Frauen.
Zweitens wäre die Konsequenz einer solchen Politik, dass überall auf eine 50%-Quote hingewirkt werden müsste, und zwar ohne irgendeine tragfähige Begründung. Denn dass hier eine Unter- und dort eine Überrepräsentanz bestehen mag, das besagt solange wenig bis gar nichts wie die Prinzipien gleicher Berechtigung und Nicht-Diskriminierung wirklich eingehalten werden. Nur darauf kommt es an.
Statistische Unterrepräsentanzen von Frauen können höchstens als ein schwaches Indiz darauf gewertet werden, dass eine Benachteiligung von Frauen vorliegen könnte. Diese Hypothese wäre dann im Einzelfall zu prüfen, insbesondere im Hinblick darauf, ob und wodurch die hier genannten Prinzipien tatsächlich konkret verletzt werden. Und damit wäre der Ansatzpunkt einer Veränderung bestimmt.
Die Auswirkungen einer generalisierten 50%-Quote, die sich z. B. in offiziellen Zielvereinbarungen von Hochschulen wiederfindet, sind mit einer Auswahl der bestgeeigneten Personen nicht mehr vereinbar, und sie geht zwangsläufig zu Lasten der Qualität. Das gilt ebenso für finanzielle Anreize, mit denen Hochschulen dazu gebracht werden sollen, Berufungsverfahren z. B. durch besondere finanzielle Anreize die Hochschulleitungen so zu manipulieren, dass Frauen statt besser qualifizierter Männer berufen werden, was – nebenbei bemerkt – verfassungswidrig sein dürfte; von Professorenstellen nur für Frauen einmal ganz zu schweigen. Es wird überall ein den individuellen Entscheidungen übergeordnetes bürokratisches Steuerungssystem erforderlich, das in Gestalt der Frauenbeauftragten und ihrer Netzwerke im öffentlichen Sektor tatsächlich bereits existiert. Es nützt allerdings nicht dem Gemeinwohl, sondern es schadet ihm, und zwar sowohl unter dem Gesichts-punkt der Kosten wie unter dem der Wirkungen.
Eine Gleichstellungspolitik, die sich des Mittels der Frauenquoten bedient, ist nicht, wie immer behauptet wird, die Verwirklichung der Gleichberechtigung, sondern sie ist eine Politik der Privilegierung von Frauen und zugleich der Diskriminierung von Männern, die die Gleichberechtigungsnorm gerade nicht verwirklicht, sondern sie aushebelt. Es handelt sich aus dieser Sicht um einen klaren Verfassungsverstoß: Die grundlegenden Werte der Gleichberechtigung und der Nicht-Diskriminierung werden dadurch verletzt. Eine Rechtfertigung hierfür existiert nicht, weil die Unterrepräsentanz von Frauen eine Benachteiligung weder belegt noch gar beweist, und bloße Behauptungen beweisen gar nichts.
Die Gleichstellungspolitik ist faktisch eine Lobbypolitik einer Minderheit von frauenpolitisch gut organisierten Frauen, die im wesentlichen der oberen Mittelschicht angehören, und die ihre speziellen Karriereinteressen außerhalb der Konkurrenz und zu Lasten konkurrierender Männer durch Anwendung von Frauenquoten fördern wollen. Die Diskriminierung von Männern wird dabei entweder billigend in Kauf genommen oder sogar bewusst angestrebt.
Linke Politik ist aber eine Politik der Beseitigung von Diskriminierung und gerade nicht eine Politik der Privilegierung, die außerdem und zugleich eine Politik der Diskriminierung ist. Daher handelt sich bei der Gleichstellungspolitik, die unter der Überschrift „Gender Mainstreaming“ seit Mitte der 90er Jahre „top down“ immer intensiver umgesetzt wird, objektiv um eine rechte Politik. Nicht zufällig wird sie von Frauen des rechten politischen Spektrums (z.B. von der Leyen/CDU) besonders forciert.
Eine rechte Politik wird nicht dadurch zu einer linken Politik, dass sie auch von Mitte-Links Parteien betrieben wird. Es sollte, insbesondere von den GRÜNEN, sowie von der Sozial-demokratie und der LINKEN, der Irrtum erkannt werden, der darin besteht, diese Politik für eine linke, emanzipatorische und unterstützenswerte Politik zu halten. Die PIRATEN haben bisher diesen Irrtum vermieden; zu hoffen ist, dass es dabei bleibt.
Die Politik der Mitte-Links-Parteien sollte sich zukünftig besser ernsthaft mit den oben benannten Problemen der Lohnabhängigen befassen. Sie stellen die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung dar, und sie verfügen kaum über finanzielle Reserven. Ihre Probleme sind hauptsächlich ökonomisch, sozial, ethnisch und kulturell bedingt, und den damit im Zusammenhang stehenden Problemen sollte sich die politische Linke (i. w. S.) endlich wieder zuwenden, anstatt das egoistisch-diskriminierende Geschäft ambitionierter Bürgerinnen zu betreiben.
Prof. Dr. Güter Buchholz, Jahrgang 1946, hat in Bremen und Wuppertal Wirtschaftswissenschaften studiert, Promotion in Wuppertal 1983 zum Dr. rer. oec., Berufstätigkeit als Senior Consultant, Prof. für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Consulting an der FH Hannover, Fakultät IV: Wirtschaft und Informatik, Abteilung Betriebswirtschaft. Seit 2011 emeritiert.