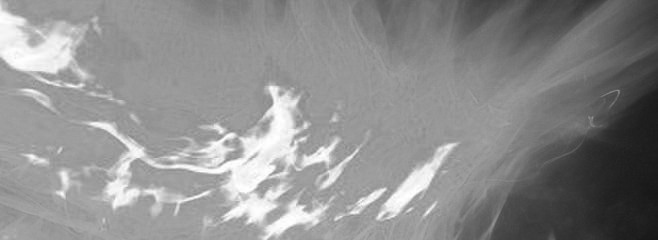Politische Leere, politische Gewalt
Zu Texten von Teresa Bücker und Antje Schrupp
Am Beispiel zweier Texte von Teresa Bücker und Antje Schrupp zeigt sich: Was eine auch nur halbwegs linke, humane Politik heute braucht, ist keine Militanz – sondern mehr Ehrlichkeit.
Beim Quizduell kann ich jeden Monat gegen „Deutschland“ spielen und also herausfinden, ob ich die Nachrichten des vergangenen Monats besser im Kopf habe als die Mehrheit der anderen, die schon mitgespielt haben. Beim letzten Oktober-Quiz war ich dabei ganz gut, und in einer Frage wusste ich auch besser Bescheid als die Mehrheit: Bei der Frage danach, welche Studiengänge in Ungarn nun gestrichen worden seien. Dass das die Gender Studies sind, war mir sofort präsent, während es an den meisten anderen vorbeigegangen war.
Was beständig an geschlechterpolitischen Aufgeregtheiten durch Blogs, Klick-Bait-Artikel wie die von Stokowski und die entsprechenden Kommentarspalten oder durch Hashtags gejagt wird, interessiert die meisten Menschen wenig, die in der Regel ganz andere Sorgen haben. Nur wer direkt mit den Konsequenzen konfrontiert wird, merkt, dass hier nicht nur erhitzte Luft ventiliert, sondern auch folgenreich politisch agiert wird.
Männer würden vermutlich fast rundweg eine leicht irritierte, irgendwie souverän-gelangweilte „Lass sie doch reden, irgendwie haben sie ja auch recht“-Haltung gegenüber Feministinnen einnehmen, wenn nicht viele von ihnen, beispielsweise, die Erfahrung gemacht hätten, dass sie als Väter nach einer Trennung überraschend rechtlos sind.
Frau Bücker entdeckt Empathie für Väter
Das aber ist eben nicht das Problem, mit dem sich Teresa Bücker gerade in der Edition F. beschäftigt – das „F“ steht hier wahlweise für „Feminismus“ oder für „Frauen“. Die „modernen Väter“ seien „eher Urban Legend als Trend“, würden bei der Kindessorge eher die späteren Zeiten übernehmen, „wenn man mit dem Kind schon etwas anfangen kann“, kümmerten sich nicht um bessere Elternzeiten für Väter in Unternehmen und lebten ohnehin in einer Gesellschaft, die „sie wie Helden feiert, wenn sie wickeln können“.
In den ersten Monaten wurde unser Kind ausschließlich von mir gewickelt – ich habe es der Mutter schließlich beigebracht – und kann mich nicht daran erinnern, dafür jemals als Held gefeiert worden zu sein, oder das erwartet zu haben. Was Bücker Männern unterstellt, ist weitgehend projektiv, verkürzt, und es blendet den Anteil von Frauen aus. Zum Beispiel den, dass weiterhin, und nach meinem Eindruck bei Schülerinnen und Schülern eher wieder verstärkt, sowohl Frauen als auch Männer von Männern erwarten, dass sie in der Lage sind, die Familie zu ernähren. Wenn das Geld, das die Frau verdient, nicht ausreicht – dann begrenzt das nun einmal die Möglichkeiten des Mannes, seine Zeit im Beruf zu verknappen.
Nur kurz streift Bücker, dass die rechtliche Stellung von Vätern nach Urteilen des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte und des Verfassungsgerichts gestärkt werden musste:
Die Sorgerechtsreform von 2013 erleichterte unverheirateten Vätern den Zugang zum Sorgerecht für ihre Kinder – ohne sie dazu zu verpflichten, dieser Sorge auch tatsächlich nachzukommen.
Lutz Bierend hat diesen Satz schon kommentiert und darauf hingewiesen, wie schwer es Vätern trotz der leicht gewachsenen rechtlichen Möglichkeiten immer noch gemacht werden kann, wenn sie für ihre Kinder sorgen wollen.
Bücker aber erweckt den Eindruck, Väter würden sich Vorteile herauspicken, sich vor Unterhaltszahlungen möglichst drücken, aber Verantwortungen scheuen. Dass sie weiterhin rechtlich und, mehr noch, institutionell gegenüber Müttern benachteiligt sind, erwähnt sie dagegen nicht.
Sie erwähnt schon gar nicht, dass es insbesondere Feministinnen waren, die sich einer Gleichberechtigung von Vätern und Müttern in den Weg stellten, die Väter pauschal als Kinderschänder hinstellten und eine Vater-Kind-Bindung leugneten, die Müttern Tipps gaben und geben, um Väter aus der Kindessorge herauszuhalten, und die eine verbissene Lobbyarbeit gegen die stärkere Beteiligung von Vätern organisieren.
Im immerhin offen geführten Kommentarspalten-Dialog mit Markus Witt vom Väteraufbruch für Kinder bezeichnet sie das „Maternal Gatekeeping“ – also das gerade im deutschen Recht traditionell verankerte mütterliche Privileg, über die Möglichkeiten des Vaters zur Kindessorge entscheiden zu können – als „Mythos“. Allerdings reproduziert sie dessen Logik selbst.
Aufhänger ihres Textes ist die brutale Abschiebung eines Migranten und werdenden Vaters, der im Krankenhaus festgenommen wurde, als seine Frau gerade in den Wehen lag. Bei dem Fall mache
die Unmenschlichkeit einer Abschiebung während der Geburt sprachlos, die ohne Zweifel auch die Frau traumatisiert hat, die in einer Situation, in der sie besonderen Schutz und Ruhe braucht, das Auseinanderreißen ihrer Familie mitbekam, während sie doch ihr Baby in Empfang nehmen wollte.
Warum die plötzliche Empathie für einen Vater und die Wut darüber, dass seine spezifische Bedeutung nicht respektiert wurde?
Möglich, aber unwahrscheinlich ist es, dass der Vater hier eben kein weißer Mann und daher im traditionellen Verständnis des intersektionellen Feminismus kein Herrscher ist. Das allerdings hatte Feministinnen auch nicht im berühmten Skandalfall des Kazim Görgülü interessiert, der jahrelang darum kämpfen musste, für seinen Sohn sorgen zu können – weil die Mutter den Sohn ohne sein Wissen zur Adoption freigegeben hatte.
Im aktuellen Fall aber möchte die Mutter den Vater dabei haben – er wird gegen ihren Willen von ihr und dem Kind getrennt. Eben das verändert die Situation schlagartig: Die Empathie für den Vater ist eigentlich Empathie für die Mutter, von der auch ein wenig für ihn abgezwackt wird.
Gleichwohl schreibt Bücker ihren Text in einer politischen Gemengelage, in der die vielen Studien nicht mehr zu leugnen sind, die zeigen, wie sehr auch nach Trennungen die Doppelresidenz dem bisherigen De-Facto-Standard der mütterlichen Einzelresidenz überlegen ist. Die Bedeutung von Vätern für die Kinder, und nicht nur für den Unterhalt, lässt sich vernünftig längst nicht mehr leugnen. Bückers Text erweckt nun den Eindruck, Feministinnen hätten schon immer gegen den Widerstand und das Desinteresse von Vätern für eine Stärkung der Väter in den Familien gekämpft.
Es geht der Autorin daher nicht um eine Auseinandersetzung mit Sachfragen, sondern darum, Widersprüche der eigenen Position kaschieren und einen Rückzug aus nicht mehr zu haltenden Schützengräben als Offensive verkaufen zu können. Etwa so:
Könnte es tatsächlich sein, dass die Erde eine Kugel ist?
Flacherdler (im Weiteren kurz: F.): Die Erde ist eine Scheibe.
Irgendein Kritiker: Nein, wir können ziemlich genau nachweisen, dass die Erde tatsächlich eine Kugel ist.
F.: Was für ein Unsinn. Das leugnet kurzerhand und arrogant die tägliche Erfahrung von Tausenden!
K: Nein, genaugenommen gibt es auch Erfahrungen, die meine Position belegen. Zum Beispiel….
F.: Ich hör nicht zu. Ich hör nicht zu. Man sollte diesem Menschen ohnehin nicht zuhören und einen Cordon Sanitaire um ihn legen. Er versucht, Menschen dazu zu bewegen, auf die andere Seite der Scheibe zu gehen und herunterzufallen. Alles, was er sagt, verschleiert nur, dass es ihm um die Sicherung seiner Privilegien geht!
K: Welche…? Ach, nein, ich… (Stille)
Fünfzig Jahre später. Die „Victoria“ kommt gerade von ihrer ersten Weltumseglung zurück.
F.: Was für ein wunderbarer Tag. Und er bestätigt alles, was wir immer gesagt haben: Die Erde ist eine runde Scheibe, die nun ein ganzes Mal umfahren wurde.
K: Nein, tatsächlich ist die Victoria einmal um die Kugel gefahren.
F.: Absurd. Dann wäre sie heruntergefallen.
K: Nein, die Gravitation, also die Erdanziehung hat sie gehalten. Das lässt sich…
F.: Pseudotheorien! Tatsächlich sind die Kugelisten allein an der Aufrechterhaltung ihrer Privilegien interessiert und organisieren seit Jahrtausenden skrupellos das Herunterfallen von Menschen. Es wird Zeit, ihnen das Handwerk zu legen und ihre Gefährlichkeit endlich zu erkennen.
K: Nein, ich.-… (Geräusche eines Handgemenges. Dann: Stille)
Hundert Jahre später. Vom ersten Raumflug wurden beeindruckende Bilder der Erdkugel übermittelt.
F.: Was für ein Erfolg! Was für eine Freude! Und ohne uns wäre diese Leistung niemals möglich gewesen. Hätten wir nicht immer wieder darauf hingewiesen, wie gefährlich die Konzepte der Kugelisten sind, und wie absurd ihre Pseudotheorie einer Gravitation – das Raumschiff hätte sich niemals in das Weltall erheben können.
Wieder einmal zeigt sich: Es gibt kein gesellschaftliches Problem, das sich ohne unser Handwerkszeug lösen ließe. Es gibt keinen Bereich unserer Kultur, bei dem wir verzichtbar wären.
(Endloser Beifall vom Band)
Frau Schrupp flirtet mit politischer Gewalt
Es gibt kein gesellschaftliches Problem, das sich ohne feministisches Handwerkszeug lösen ließe. Es gibt keinen Bereich unserer Kultur, bei dem Feministinnen verzichtbar wären.
So gerade in der Frankfurter Rundschau Antje Schrupp, eine von Deutschlands wichtigsten Feministinnen, die auch schon einmal gefordert hatte, Vätern doch der Einfachheit halber alle Pflichten und Rechte ganz zu streichen. Der FR-Text ist irritierend – nicht, weil dort neue Gedanken enthalten wäre, sondern weil Schrupp irritierend unbekümmert mit politischer Gewalt flirtet.
Sie begründet diesen Flirt mit einer Liste von Enttäuschungen:
Die nachhaltig stereotype familiäre Rollenverteilung. Der Rückgang des Frauenanteils in den Parlamenten. Fehlende Diversität in Institutionen und Konzernen. Der Rosa-Hellblau-Terror im Marketing.
Nun sind Frauen mindestens so sehr wie Männer an der familiären Rollenverteilung beteiligt, ihr Anteil im Bundestag ist immer noch überproportional viel größer als ihr Anteil an der Mitgliedschaft in Parteien, Frauen streben Führungsposten selten an, und der „Rosa-Hellblau-Terror“ – angesichts des realen Terrors, den Europa und andere Teile der Welt erleben, ohnehin eine bescheuerte Dramatisierung – wird wesentlich von Frauen getragen: Frauen kaufen Kinderspielzeug, bei dem Rosa-Blau-Aufteilungen ja besonders beliebt sind, und wenn Frauen für einen Rasierer mehr Geld ausgeben, nur weil er rosa ist, dann ist auch das nicht die Schuld von Männern.
Die Enttäuschung Schrupps entsteht also nicht durch irgendwelche Widerstände irgendeines Patriarchats, sondern dadurch, dass ein Großteil der Frauen offenbar wenig an dem interessiert ist, was Feministinnen so fordern.
Gerade fordert beispielsweise Katharina Barley gesetzliche Regelungen zur Anhebung des Frauenanteils im Bundestag. Natürlich könnten Frauen sich auch einfach stärker politisch engagieren, oder sie könnten konsequent Kandidatinnen wählen – aber unglücklicherweise setzen viele von ihnen offenbar andere Prioritäten.
Da kämpft die SPD um ihr Überleben – da ist der rechtliche Rahmen der Migration offensichtlich ungerecht und, siehe oben, stellenweise grausam – aber die sozialdemokratische Justizministerin hat nichts Wichtigeres zu tun, als die fehlende Massenbasis ihrer Geschlechterpolitik durch gesetzlichen Druck ersetzen zu wollen. Die Vorstellung ist offenkundig irreal, in einer feministisch inspirierten Politik gleichsam einen archimedischen Punkt gefunden zu haben, mit dem alle andere Politik aus den Angeln gehoben und in ihre richtige Form gesetzt werden könne.
Barley wie Schrupp beziehen sich auf die Suffragetten und das vor hundert Jahren erkämpfte Frauenwahlrecht – obwohl längst eigentlich jeder wissen müsste, dass damals nicht allein Frauen, sondern auch einem großen Teil der Männer das Wahlrecht vorenthalten worden war. Der Frau-Mann-Kampf war damals schon vorwiegend eine Inszenierung, aber eine gewalttätige. Der Autor Gunnar Kurz schreibt über die Gewalt der Suffragetten-Bewegung:
Sie zerstörten Bilder in öffentlichen Galerien, schütteten Säure in Briefkästen, lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei, versuchten einen Teil der Bank of England, die Royal Academy und Gebäude einer Schule in die Luft zu sprengen und planten, die Kinder von Winston Churchill zu kidnappen. Sie schickten Briefbomben an bekannte Mitglieder der Gesellschaft – eine davon verletzte die Hand eines Postbeamten –, verübten einen Bombenanschlag auf das Landhaus des Schatzkanzlers, steckten Kirchen in Brand und fackelten einen Bahnhof ab (…).
An eben diese Militanz erinnert Schrupp heute, sie raunt von einer Ausweitung der Kampfzone und fragt suggestiv, ob es denn reichen würde, T-Shirts zu tragen und zu demonstrieren. „Oder braucht die Frauenbewegung wieder mehr Militanz?“
Allerdings ruft sie nicht direkt zur Gewalt auf, sondern kokettiert lediglich mit der Idee und legt es nahe, die Frage nach der Militanz mit „Ja“ zu beantworten. Wenn daraufhin jemand wirklich gewalttätig wird, hat sich die Redakteurin von „Evangelisches Frankfurt“ nicht die Hände schmutzig gemacht und kann sie zur Not in Unschuld waschen.
Da sie aber nur kokettiert und nahelegt, den Gedanken an politische Gewalt jedoch nicht konsequent durchspielt, stellt sie auch nicht die Frage, wenn denn diese Gewalt überhaupt legitimiert werden könnte. John Dewey beispielsweise hat sie mit einem schlagenden Argument abgelehnt: Politische Gewalt, auch revolutionäre Gewalt, würde nichts Neues schaffen, sondern lediglich bewirken, dass alte Strukturen in neuer Einkleidung weiter existierten. Er dachte dabei offenbar an den Übergang vom autoritären Zarenreich zum autoritären Bolschewismus.
Wenn überhaupt, dann war diese Gewalt in Situationen gerechtfertigt, in der sich ökonomische, soziale und kulturelle Strukturen längst weiter entwickelt hatten, politische Strukturen aber betoniert und veränderungsunfähig schienen: so wie bei der amerikanischen Revolution 1776 oder der französischen 1789. Aber in demokratischen Strukturen greift auch diese Legitimation nicht, weil diese Strukturen prinzipiell veränderbar sind.
Es gibt in einer Demokratie keine schlüssige Legitimation politischer Gewalt.
{loadposition man-tau}
Zudem ist Schrupp ja eben nicht von fehlender Beweglichkeit der politischen Ebene enttäuscht. Im Gegenteil: In Parteien, in Parteiorganisationen wie der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen oder dem grünen Gunda-Werner-Institut, im Familienministerium, in Hunderten von Stellen für Gleichstellungsbeauftragte, in staatlicher Förderung von Frauenprojekten und feministisch inspirierter akademischer Forschung werden feministische Akteurinnen umfassend gefördert.
Ihr Problem ist nicht die fehlende Unterstützung, sondern die Unannehmlichkeit, dass sie ihre Positionen schlecht legitimieren können, weil ein Großteil der Frauen gar nicht an ihrem Aktivismus interessiert ist.
Die Gewalt, mit der Schrupp flirtet, ist also nicht die Gewalt der Hoffnungslosen, die seit Jahrzehnten schon für humanere Strukturen kämpften und die dabei immer wieder an betonierten politischen Verhältnissen zerschellten.
Es ist die Gewalt der Ideen- und Substanzlosen, die ihr inneres Vakuum als Resonanzraum für politische Lautstärke nutzen und die sich eine verschärfte Freund-Feind-Konfrontation herbeiträumen, weil sie glauben, darin so etwas wie einen Sinn entdecken zu können.
Das ist besonders verantwortungslos angesichts einer Situation, in der sich in den USA tatsächlich eine gewaltsame Konfrontation zweier gleichermaßen substanzloser politischer Lager abzeichnet und in der es schön wäre, wenn europäische Gesellschaften etwas rationalere Wege finden würden.
Der Feminismus, und nicht nur er, braucht ganz gewiss nicht mehr Militanz. Mehr Ehrlichkeit: Das wäre unspektakulärer, undramatischer, weniger verkaufsfördernd – aber ein sehr guter Anfang.
Danke für die Informationen an Genderama!