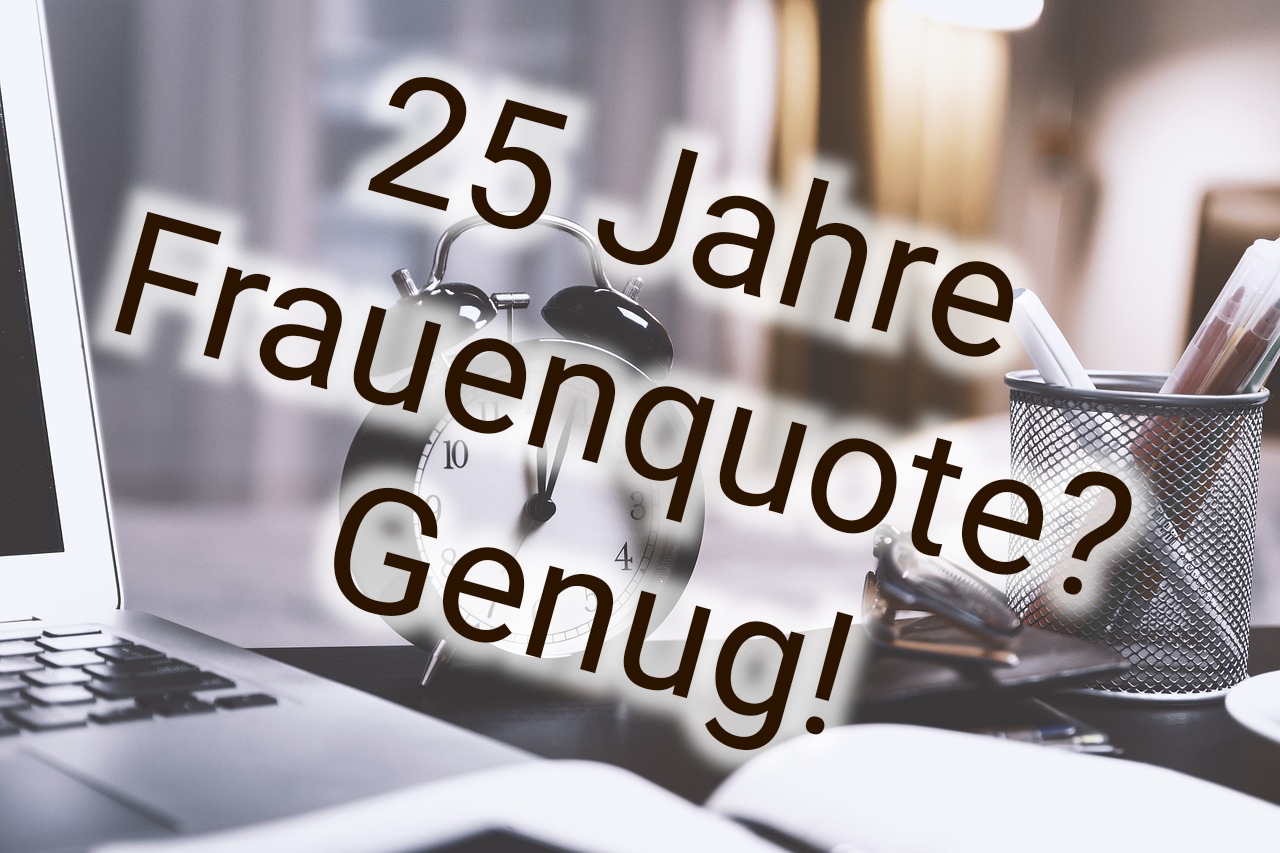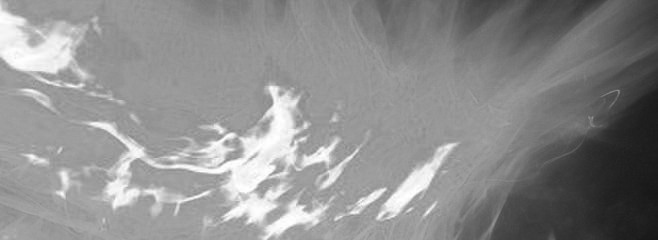SPD: 25 Jahre Frauenquote sind genug
Die SPD hatte auf ihrem Parteitag in Münster 1988 die verbindliche Frauenquote in ihren Parteistatuten aufgenommen. Diese Quotenregelung sollte für 25 Jahre Geltung haben, also bis zum Jahr 2013 befristet sein. Eine solche Privilegierung von Frauen ist nur zeitlich begrenzt gerechtfertigt. Sie ist auch nur dann verfassungsgemäß. Das war Konsens in Münster. Sowohl die Antragsteller, die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen, als auch die damalige Parteiführung unter Hans Jochen Vogel sowie die Delegierten auf dem Münsteraner Parteitag waren sich einig, dass eine Befristung zwingend notwendig war. Auch der juristische Sachverstand, der vor der Münsteraner Beschlussfassung bemüht worden war, teilte diese Auffassung.
10 Jahre vor Ablauf der Frist hat – wiederum auf Antrag der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen – der SPD Parteitag in Bochum die zeitliche Befristung der verbindlichen Quotenregelung aufgehoben. Dabei hatten Kritiker bereits früh grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedenken gegenüber einer verbindlichen Quotenregelung geäußert. Ihre Einführung sei ein „verfassungsrechtlich äußerst riskantes, ja risikoträchtiges Unternehmen“. Ohne Zweifel hat sich mit der Entfristung der verbindlichen Quotenregelung das Risiko gerichtlicher Auseinandersetzungen erhöht. Ob der Bochumer Beschluss vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand haben kann, ist durchaus fraglich. Das Bundesverfassungsgericht hat sich bislang mit dieser Frage nicht auseinandersetzen müssen. Die verbindliche Quotenregelung ist nicht nur bei den meisten Männern unbeliebt, auch viele Frauen sehen in der Frauenquote eine subtil frauenverachtende Besserstellung, die sie heute gar nicht mehr nötig haben. Die Parteiführung sollte deshalb überlegen, ob sie dem nächsten Parteitag nicht vorschlägt, den Bochumer Parteitagsbeschluss von 2003 aufzuheben. Die Pflichtquote würde dann – wie ursprünglich in Münster beschlossen – im August 2013 auslaufen. Doch die Parteiführung unter Sigmar Gabriel und Andrea Nahles haben ganz Anderes vor: Mit ihren organisationspolitischen Reformvorschlägen setzen sie die Bochumer Beschlusslage fort: Nicht nur für die Listenaufstellung auch für die Kandidatenaufstellung bei Direktmandaten soll nun auch die 40 Prozentquote zugunsten der Frauen verbindlich festgeschrieben werden. Anstatt den problematischen Weg der SPD zur Quotenpartei zu korrigieren, setzen Gabriel und Nahles ihn fort und das im Namen von mehr innerparteilicher Demokratie!
Die Verankerung von Frauenquoten in den Statuten der Parteien ist heute nichts Besonderes mehr. Sie werden zwischenzeitlich in allen Parteien diskutiert und praktiziert. „Grüne“, SPD und „Linke“ haben sie schon seit Jahren in ihren Organisationsstatuten verankert. Zwischenzeitlich hat selbst die CSU sie eingeführt. CDU und FDP werden mit großer Wahrscheinlichkeit folgen. Die Frauenquote also eine einzige Erfolgsgeschichte? So könnte man meinen. Die Bilanz sieht jedoch anders aus. Unter Quotierung wird die zeitlich befristete Bevorzugung von Frauen bei der Gewinnung von Mandaten in Parlamenten und bei der Vergabe von Ämtern und Funktionen in den Parteien verstanden. Die Quote, so heißt es, sei notwendig, um das politische Engagement der Frauen zu stärken und ihr Interesse, aktiv in einer Partei mitzuwirken, zu wecken. Zudem wären gerade Frauen in der Vergangenheit in den von „Männer dominierten“ Parteien strukturell benachteiligt gewesen, sie kämen regelmäßig bei der Vergabe von Ämtern und Mandaten zu kurz. Die Quote sollte somit sicherstellen, dass Frauen zumindest entsprechend ihres Anteils an der Mitgliederschaft bei der Vergabe von Führungspositionen berücksichtigt werden. Für eine befristete Zeitspanne sei sogar eine „Überrepräsentanz“ von Frauen in den Führungsgremien gerechtfertigt. Eine solche Quote könne jedoch „nur als zeitlich befristetes Mittel zur Erhöhung des Mitgliederanteils …legitimiert werden und kann auch nur insoweit eine Abweichung vom Grundsatz der Wahlgleichheit rechtfertigen.“[1]
Quotierung nur bei zeitlicher Befristung verfassungsgemäß
Gewährsmann und Quotenverteidiger Ingwer Ebsen machte klar, „daß eine Quotierung von 40% nach Ablauf einer Zeit …insoweit nicht mehr verfassungsmäßig wäre, als sie den Mitgliederanteil der Frauen deutlich überstiege.“ Genau das ist jedoch heute der Fall. Deshalb sei es, so Ebsen, empfehlenswert, „im Interesse klarer Verhältnisse von vorneherein eine zeitliche Befristung vorzusehen, nach deren Ablauf die in der Satzung vorgesehene Quote durch den Mitgliederanteil begrenzt ist.“[2] Der Parteitag der SPD in Münster 1988, auf dem die Aufnahme der Quotenregelung ins Organisationsstatut beschlossen wurde, kam dieser Empfehlung nach: Die Quotenregelung wurde auf das Jahr 2013 befristet. Bis zum Parteitag der SPD im Jahre 2003 in Bochum. Dort wurde die Quotenregelung entfristet und auf Dauer gestellt.
Nach dem auf dem Parteitag in Münster beschlossenen Organisationsstatut der SPD sollten „ab sofort“ ein Drittel und von 1994 an 40% weibliche Mitglieder bei der Vergabe von Parteiämtern zwingend berücksichtigt werden.
Doch nicht nur bei der Vergabe von Parteiämtern und –funktionen sollten Frauen bevorzugt werden. Bei den Listen und Kandidatenaufstellungen zu Parlamentswahlen auf kommunaler Ebene, auf Länder- und Bundesebene sollten nach der neuen Parteisatzung bis 1990 25%, ab 1994 33% und ab 1998 40% Frauen zwingend berücksichtigt werden. Allerdings wurde diese 40% Quote faktisch unterlaufen. Im Statut gilt die Quotenregelung für Frauen und Männer gleichermaßen. Die Folge davon ist, dass in der praktischen Umsetzung der Quotenregelung den Frauen tatsächlich eine 50% Quotierung zugute kommt.
Grundwerte im Widerspruch: Zwischen Demokratie und Gleichstellung
Verfassungsrechtlich ist die verbindliche Quotenregelung nicht unheikel. Und aus diesem Grund war sie lange Zeit umstritten. Die 40% Quotierung stellt nicht nur eine Bevorzugung von Frauen dar, sondern auch umgekehrt eine Benachteiligung von Männern. Die verbindliche Quotenregelung verletzt Art. 3 Abs. 3. S. 1 unseres Grundgesetzes, nach dem niemand wegen seines Geschlechts benachteiligt oder bevorzugt werden darf. Zwar können Parteien als privatrechtliche Vereinigungen organisationspolitisch souverän handeln, gegen Grundrechte und gegen die Verfassung dürfen aber selbst Parteien nicht verstoßen.
Verfassungsrechtler sind allerdings der Auffassung, dass von Verfassungsgrundsätzen aus besonders schwerwiegenden Gründen abgewichen werden darf. Zum Beispiel dann, wenn ein anderer Grundwert der Verfassung nachhaltig verletzt werde, wie beispielsweise die Gleichberechtigung von Männern und Frauen (Art. 3 Abs. 2 S. 1). Die Bevorzugung von Frauen in den Parteistatuten bedarf aber immer einer „im Rahmen des strengen Gleichheitsgebots hinreichenden Rechtfertigung“ (Ingwer Ebsen). Den Rechtfertigungsgrund sehen die Befürworter der Quotenregelung denn auch in der Gleichrangigkeit der Absätze 2 und 3 von Artikel 3 GG. Artikel 3 des Grundgesetzes enthält, wie sie sagen, ein grundrechtsimmanentes Spannungsfeld. Einerseits bestimmt Art. 3 Abs. 2 GG, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Der Staat habe die „tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern (zu fördern) und (wirke) auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Anderseits darf niemand „wegen seines Geschlechts … benachteiligt oder bevorzugt werden“ (Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG). Hier stehen, wie der ehemalige Bundesjustizminister Gerhard Jahn auf dem Quoten-Parteitag der SPD in Münster meinte, zwei Grundsätze der Verfassung im Widerstreit.“… Aber es sei „ein Irrtum, zu glauben, daß die Verfassung einem ihrer Gebote blindlings und generell Vorrang einräumt“. [3]
Die Frage bleibt allerdings, ob die Wahrung und Förderung des einen Grundrechts Art. 3 Abs. 2 GG (Männer und Frauen sind gleichberechtigt) zulasten eines anderen Grundrechts Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG (Niemand darf wegen seines Geschlechts … benachteiligt oder bevorzugt werden) erkauft werden darf oder ob zweifelsfreiere, verfassungskonformere Wege dazu beschritten werden können. Eine weitere Frage ist, ob es politisch klug ist, sich auf einen solchen Handel, zwischen zwei Grundwerten entscheiden zu müssen, einzulassen.
Quotenregelung von Karlsruhe nicht gedeckt
Von interessierter Seite wird der Eindruck erweckt, als sei eine Quotenregelung von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts gedeckt. Dieser Eindruck ist jedoch falsch. Bislang haben sich die Karlsruher Richter mit der verbindlichen Quotierung nicht befasst. Das Bundesverfassungsgericht hat sich in einer Reihe von Entscheidungen mit der Frage des in Art. 3 Abs. 2 GG geforderten Gleichberechtigungsgebots und dessen Umsetzung in der gesellschaftlichen Wirklichkeit auseinandergesetzt. In Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG gehe es, so das Bundesverfassungsgericht, „um die Durchsetzung der Gleichberechtigung der Geschlechter für die Zukunft“.[4] Dabei dürften faktische Nachteile, die typischerweise Frauen treffen, „durch begünstigende Regelungen ausgeglichen werden“.[5] Die Karlsruher Richter haben deshalb dem Gesetzgeber einen Gestaltungsspielraum eingeräumt, wie er dem Gebot des Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG nachkommt. Die „Ausgestaltungsbefugnis“ des Staates muss jedoch „faktische Diskriminierungen, die sich als Folge seiner Regelungen ergeben, so weit wie möglich vermeiden.“[6]
Den die Frauen „begünstigende Regelungen“ sind somit enge Grenzen gesetzt. Zumal dann, wenn andere Grundrechtsnormen verletzt werden, wie im Falle einer verbindlichen Quotenregelung Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG (Niemand darf wegen seines Geschlechts benachteiligt oder bevorzugt werden) oder Art. 21 Abs. 1 S. 3 GG (Die innere Ordnung der Parteien muss demokratischen Grundsätzen entsprechen). Ob die in Parteistatuten festgeschriebene verbindliche Quotenregelung vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand haben wird, ist deshalb durchaus fraglich. Aus dem „Auftrag“ an den Staat, die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern durchzusetzen, wird zwar geschlossen, dass eine statutenverbindliche Bevorzugung von Frauen (und eine entsprechende Benachteiligung von Männern[7]) auch in Parteien gerechtfertigt sei. Doch Parteien sind keine staatlichen Institutionen, für die allenfalls „begünstigende Regelungen“ beispielsweise in Form von Quotenregelungen Geltung haben könnten. Die Staatsferne der Parteien ist ausdrücklich von den Verfassungsgebern gewollt. Parteien sind privatrechtliche Vereine, die an der Willensbildung des Volkes mitwirken. Niemand wird gezwungen, in einer Partei mitzuwirken. Jedes Mitglied kann zu jeder Zeit seine Partei verlassen und seine Beitragszahlung an sie beenden. In den Statuten der Parteien existieren keine Frauen benachteiligende Regelungen. Sie können jeder Partei ohne Behinderungen frei beitreten und sich um Ämter und Mandate bewerben. Weil unsere Parteien eben keine Staatsparteien sind, ist die Pflichtquote auch nicht durch die Auslegung von Art. 3 Abs. 2 durch das Bundesverfassungsgericht gedeckt.
Beschränkung der innerparteilichen Demokratie
Aber auch andere Artikel des Grundgesetzes werden mit einer verbindlichen Quotenregelung verletzt. Die innere Ordnung der Parteien muss „demokratischen Grundsätzen“ entsprechen (Art. 21 GG Abs. 1 S.2). Zudem werden mit der Einschränkung des Prinzips „allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahlen“ (Art. 38 Abs.1 S.1) „Grundelemente der Demokratie“ missachtet. Welche Aufgaben und Funktionen, welchen Grad an Organisationsouveränität der Gesetzgeber den Parteien in der parlamentarischen Demokratie als „Mittler zwischen Wahlvolk und staatlichen Institutionen“ auch immer einräumt, unstreitig bleibt, dass Parteien Grundrechte zu beachten und demokratische Verfahren einzuhalten haben. Dazu gehört, dass sie ihren Mitgliedern die gleichen Mitwirkungsrechte gewähren müssen. Artikel 21 Abs. 1 S. 3 GG bestimmt, dass die innere Ordnung der Parteien „demokratischen Grundsätzen“ entsprechen muss. Was unter dem Begriff „demokratische Grundsätze“ im Einzelnen zu verstehen ist, bleibt unklar. Das Bundesverfassungsgericht hat allerdings zwei „ganz elementare Anforderungen“ an die Parteien aus Artikel 21 Abs. 1 S. 3 GG hergeleitet:
Zum einen müssen sie den Aufbau und den Entscheidungsprozess von unten nach oben gewährleisten, zum anderen muss die grundsätzliche Gleichwertigkeit der Parteimitglieder bei der Willensbildung in der Partei garantiert sein. Das Bundesverfassungsgericht hat zudem eine Differenzierung von aktivem und passivem Wahlrecht einschließlich des Zähl- und Erfolgswerts der Stimmen verboten. Dem widerspricht aber grundsätzlich eine Pflichtquotierung, wie sie in den Parteien praktiziert wird. Die Quotenbefürworter sind auch hier der Auffassung, dass bei Verletzung eines so elementaren Grundrechts wie dem der Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern eine hinreichende Rechtfertigung vorhanden sei, um das Prinzip der Wahlgleichheit für eine befristete Zeit einzuschränken.
Die Münsteraner Inszenierung
In der Diskussion um die Einführung der Quote auf dem Parteitag der SPD in Münster 1988 gab es dazu eine eher langweilige, nur wenige Male leidenschaftlich aufflammende Debatte. Es war offensichtlich vorher schon alles öffentlich gesagt und vor allem intern geregelt worden. Den Rest besorgte eine geschickte Parteitagsinszenierung. Erstaunlicherweise hatten sich die beiden ehemaligen Bundesjustizminister Gerhard Jahn, 1988 parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, und der Parteivorsitzende Hans Jochen Vogel bereits früh, mit großer Verve und ohne Vorbehalt für die verbindliche Quotenregelung ausgesprochen. Ihre Autorität, ihr Einfluss, ihr Prestige und ihr Ansehen, das sie in die Waagschale werfen konnten, verfehlte ihre Wirkung bei den Parteitagsdelegierten nicht.
Der baden-württembergische Bundestagsabgeordnete Hermann Bachmaier war einer wenigen Delegierten, die auf dem Parteitag in Münster der Einführung einer „Muß-Quote“, wie er sagte, aus grundsätzlichen Erwägungen widersprochen. Sozialdemokraten seien, so Bachmaier, mit Recht stolz darauf, „daß wir unsere Ziele immer mit unbestreitbar demokratischen Mitteln verfochten und durchgesetzt haben.“ Die verbindliche Quote stelle aber einen bedenklichen Eingriff in die Entscheidungsfreiheit der Parteimitglieder dar und gerate damit zwangsläufig und notwendigerweise in Konflikt zur innerparteilichen Demokratie. „Wer es mit der innerparteilichen Demokratie ernst meint, kann auch noch so herausragende Prinzipien wie das der Gleichstellung der Frauen in der Politik nur mit einwandfreien demokratischen Mitteln herbeiführen. Diesem Anspruch aber genüge die Pflichtquotierung nicht. Innerparteiliche Wahlen und Listenaufstellungen würden in nicht unwesentlichem Umfange vorfestgelegt und nicht mehr der souveränen Entscheidung der Parteimitglieder überlassen. Die Eigenschaft „Frau oder Mann“ überlagere alle anderen bei Personalentscheidungen anstehenden Kriterien.“ Schließlich warnt Bachmaier: Wer das Gutachten von Professor Ebsen gründlich gelesen und sich ein bisschen um die einschlägigen Probleme gekümmert habe, „der weiß, daß die Einführung einer Pflichtquotierung ein verfassungsrechtlich äußerst riskantes, ja risikoträchtiges Unternehmen darstellt.“[8] Bachmeiers Warnungen stießen auf taube Ohren.
Die wenigen kritischen Einwände, die auf dem Parteitag vorgetragen wurden, wurden mit leichter Hand als unerheblich beiseite geschoben. So hielt der ehemalige Landesvorsitzende der SPD Baden-Württemberg, Ulrich Lang, die Quotenregelung für einen „schweren Rückschlag für den Gedanken einer auf Verständigung und Einsicht durchsetzungsfähigen Gleichberechtigungspolitik, wenn wir alle, die in Zukunft gewählt werden, dem Verdacht aussetzen, sie seien nur um des Proporzes willen gewählt worden.“ Er erntete mit dieser Bemerkung ebenso Pfiffe wie mit seinem Apell doch zu bedenken, was es bedeute, „daß diese Partei am Anfang dieses Jahrhunderts das Dreiklassenwahlrecht in einem entschiedenen Kampf abgeschafft hat und daß wir jetzt dabei sind, am Ende dieses Jahrhunderts ein Geschlechterwahlrecht einzuführen. Der große Gedanke der Gleichberechtigung, eine der herausragenden Aufgaben, vor denen diese Partei für diese Gesellschaft steht und mit der sie bei sich selbst anfangen muß, hätte bessere Methoden verdient als die, die hier uns heute vorgeschlagen wird.“[9]
Semantische Kosmetik und verhängnisvolle Umdeutung
Die „Frauenquote“ sei in Wahrheit eine quotenmäßige „Mindestabsicherung für beide Geschlechter“ hatte die ASF bereits Anfang der achtziger Jahre behauptet. Dem folgte erstaunlicherweise der Parteivorstand schon 1986[10]. Natürlich ging es bei der Quotenregelung um die (im Verhältnis zum Anteil weiblicher Mitglieder) Überrepräsentanz von Parteifrauen bei der Vergabe von Spitzenpositionen. Natürlich war das eine Bevorzugung der Frauen, zulasten der männlichen Mitglieder. Das war ja der ganze Sinn der Operation. Quotenbefürworter Ludwig Stiegler, damals stellvertretender bayrischer Landesvorsitzender und Mitglied des Deutschen Bundestages, brachte es auf den Begriff: „Die Quotenregelung würde viele, vor allem junge Männer demotivieren, so heißt es. Das werden wir aushalten müssen.“[11]
Die semantische Umdeutung war für die Quotenbefürworter, vor allem für die führenden Genossinnen, aus verschiedenen Gründen wichtig. Die Pflichtquote war zum einen das Eingeständnis einer Niederlage. Die Parteifrauen hatten es in der Männerpartei SPD nicht geschafft, sich aus eigner Kraft zu behaupten und im Wettbewerb um Posten und Karrieren mitzuhalten. Dieses Bild der „Quotenfrauen“ passt aber so gar nicht ins Bild der „Starken Frauen“, das so werbewirksam in der Öffentlichkeit zur Schau gestellt wird. Zum zweiten konnte mit diesem semantischen Trick die Quotierung zugunsten von Frauen nach oben, nämlich in Richtung 50%, verschoben werden. Bei der Wahl der Delegierten zu Parteitagen, bei der Quotierung von Parteigremien und der Aufstellung von Listen für Parlamentswahlen wird regelmäßig das sogenannte „Reißverschluss“-Verfahren (weibliche Kandidaten wechseln mit männlichen Kandidaten auf Wahllisten ab) angewandt.
Die semantische Umdeutung hatte zum dritten eine Wirkung, an die 1988 wohl kaum jemand gedacht haben mochte. Auf dem Bochumer Parteitag 2003 wird die „Mindestabsicherung für beide Geschlechter“ zur argumentativen Grundlage für die Entfristung der Quotenregelung. Frauen und Männern soll die „Verlässlichkeit einer klaren Satzungsreglung ohne Beschränkung“ gegeben werden, so die Vorsitzende der ASF auf dem Bochumer Parteitag 2003 Karin Junker.[12] Schließlich sollte mit der semantischen Neuschöpfung das hässliche Wort von der „Quotenfrau“, die in der „Alibifrau“ oder „Proporzfrau“ früherer Tage ihre Entsprechung hatte, aus der Welt geschafft werden. Bis heute ist es jedoch nicht gelungen, der „Quotenfrau“ den „Quotenmann“ an die Seite zu stellen. Die Quotenbefürworter mögen noch so nachdrücklich von der „Mindestabsicherung für beide Geschlechter“ reden, solange sich die Realität nicht ändert, bleiben die semantischen Bemühungen erfolglos, eher ein Beitrag zur Erheiterung. Und die Realität heißt: Bei einem Mitgliederanteil von Frauen von unter einem Drittel werden Frauen bei der Vergabe von Spitzenpositionen nach wie vor bevorzugt und sind damit deutlich überrepräsentiert. Auch noch 23 Jahre nach dem Parteitag von Münster.
Der Weg nach Münster
Als auf dem Münsteraner Parteitag die Quotenregelung nach mehr als zehnjähriger Diskussion beschlossen wurde, hatte sich die Frauen diskriminierende Lage in der Partei längst verändert. Von den 400 Delegierten und den 39 Mitgliedern des Parteivorstandes, die nach Münster anreisten, waren 159 Frauen, das war ein Anteil von über 36%. Dagegen waren 1988 nur gut 26% der Parteimitglieder Frauen. Vom Gesichtspunkt der Gleichstellung der Geschlechter waren die Frauen bereits auf dem Münsteraner Parteitag auch ohne Quotenregelung privilegiert vertreten. Auch war der Frauenanteil in der SPD-Bundestagsfraktion Mitte der achtziger Jahre bei 16% deutlich höher als zehn Jahre zuvor. Der Aufholprozess der Frauen war längst im Gange.
Das war Mitte der siebziger Jahre, als die Quotendiskussion begann, noch ganz anders. Auslöser der Debatte war die blamabel geringe Zahl weiblicher Abgeordneter in der SPD-Bundestagsfraktion nach dem historischen Wahlsieg der SPD im Jahre 1972. Noch nie hatte die SPD mit 45,9 % der abgegebenen Zweitstimmen ein solches Wahlergebnis erzielt. Einziger Schönheitsfehler: Von den 242 SPD Abgeordneten waren nur 13 Frauen. Ganze 5,3%. Das war der seit Jahrzehnten geringste Frauenanteil bei einer nationalen Wahl. Der Parteivorstand musste sich darum kümmern.
Mitte der siebziger Jahre schlug der SPD-Vorsitzende Willy Brandt eine 25% Frauenquote für alle Ämter in der Partei und eine ebenso so hohe Quote bei der Kandidatenaufstellung bei Wahlen für die Parlamente vor. Fakt war: Ihren jahrzehntelangen hehren Bekundungen zur Gleichberechtigung von Männern und Frauen kam die männerdominierte SPD regelmäßig nicht nach, wenn es um die Verteilung von Macht und Einfluss in Politik und Staat ging.
Trotz eines Frauenanteils von 18,7% (1972) waren Frauen bei der Verteilung von Ämtern und Mandaten erschreckend gering berücksichtigt worden. Auf Länder- und Kommunalebene sah es nicht viel besser aus. Brandt spürte, dass aus dem eklatanten Widerspruch von Anspruch und Wirklichkeit langfristig eine Bedrohung für die SPD entstehen konnte. Die Glaubwürdigkeit stand auf Spiel. Im Übrigen hatte sich die gesellschaftliche Großwetterlage mit der neuen Frauenbewegung seit Mitte der sechziger Jahre spürbar verändert. Damals, in den siebziger Jahren, lehnte die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF) den Quotenvorschlag Willy Brandts ab. Die sozialdemokratischen Frauen wollten aus eigener Kraft und mit demokratischen Mittel die – eigentlich ja von allen in der Partei gewollte – höhere Beteiligung von Frauen in Ämtern und Mandaten erkämpfen. Viele sahen im Übrigen in der Quotenregelung eine – wenn auch subtile – Diskriminierung von Frauen durch eine von Männern gönnerhaft gewährte Privilegierung von Frauen. Die Frauen wollten nicht als Alibi-, Proporz- oder Quotenfrau abgetan – und belächelt – werden.
Die feministische Wende
Der Beginn der achtziger Jahre brachte dann die Wende. Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF) hatte sich nach ihrer „feministischen Wende“ 1981 der Forderung nach „völliger zahlenmäßiger Gleichstellung von Frauen in Parlamenten, d.h. die Repräsentation von Frauen entsprechend ihres Anteils an der Bevölkerung“[13] verschrieben, d.h. es ging jetzt um die Einführung einer 50% Ämter- und Mandats-Quote für Männer und Frauen. Bereits auf dem Nürnberger Parteitag der SPD im Jahre 1986 hatten sich die Feministinnen durchgesetzt. Jetzt hieß es, es sei das „feste Ziel der SPD, den Anteil der Frauen an Mandaten, Ämtern und Funktionen in der Partei so zu steigern, dass noch in den 90er Jahren der Anteil der Frauen an allen Funktionen und Mandaten der SPD grundsätzlich dem Bevölkerungsanteil entspricht.“ Diese populäre feministische Denkfigur ist – bezogen auf die Beteiligung von Frauen an Führungspositionen der Partei – geradezu absurd. Sie bedeutet, dass – selbst wenn der Anteil der Frauen an der Mitgliedschaft gegen Null tendieren würde – die Führungsgremien nach wie vor paritätisch besetzt werden müssten.
Die Quotendiskussion in der SPD bekam durch die „feministischen Wende“ eine völlig neue Wendung. Hatte der Parteivorsitzende Brandt in den siebziger Jahren eine schreiende Ungerechtigkeit mit der Einführung einer Quotenregelung beseitigen wollen, ging es mit der feministischen Interpretation der Quoten durch den neuen ASF Vorstand um etwas ganz anderes. Es ging um Geschlechtergleichstellung schlechthin, nicht um Gleichberechtigung von Männern und Frauen in einem konkreten Fall, in einer konkreten Organisation. Es ging nicht um die Beseitigung einer in der Partei existierenden Unterrepräsentation von Frauen, sondern es ging jetzt um die Repräsentation von Frauen entsprechend ihres Anteils an der Bevölkerung, unabhängig von ihrem Mitgliederanteil. Solange die Zahl weiblicher und männlicher Mitglieder nicht annähernd gleich hoch ist, ist die Überrepräsentanz von Frauen damit faktisch dauerhaft festgeschrieben.
Geschlechterquote widerspricht Grundgesetz
Eine solche Zielsetzung widerspricht allerdings dem Demokratiekonzept des Grundgesetzes, wie Prof. Ebsen in seinem Gutachten für den SPD-Parteivorstand ausgeführt hatte. Der Bezug zum Frauenanteil an der Bevölkerung begründe in Wahrheit „einen durch keinen demokratischen Mechanismus vermittelten und damit auch durch nichts legitimierten Repräsentantenstatus der Frauen in der Partei für die Frauen außerhalb der Partei. „Eine solche, dem Demokratiekonzept des Grundgesetzes widersprechende Frauenrepräsentanz kann nicht teilhaben an der positiven verfassungsrechtlichen Bewertung faktischer Gleichstellung der Frauen auch bei der politischen Einflussnahme.“[14] Kaum jemand in der Partei hatte diesen Einwand ernst oder auch nur zur Kenntnis genommen. Es ist bezeichnend, dass auf dem Parteitag in Münster über die feministische Interpretation der Quote gar nicht gesprochen wurde. Von Repräsentation von Frauen in Parteiämtern und Mandaten entsprechend ihres Anteils an der Bevölkerung sprach weder Vogel noch die Vorsitzende der ASF, die den Antrag für die Quotenregelung begründete, noch irgendjemand sonst. Die Quotenregelung sollte eine Regelung auf Zeit sein, eine Übergangsregelung, bis den Frauen schrittweise ein, wie der Parteivorsitzende Vogel sagte, „angemessener Anteil an den Funktionen und Mandaten eingeräumt werden“ kann.[15]
Münster und danach
Der Quotenbeschluss von Münster war ein Meilenstein in der Parteigeschichte. Ein fataler, wie sich allerdings bald herausstellen sollte. Der damalige Parteivorsitzender Hans Jochen Vogel sprach – allerdings erst nach der Beschlussfassung des Parteitages – von einer „Entscheidung von großer Tragweite, die manche (der anwesenden Parteitagsdelegierten K.F.) in ihrer Tragweite noch gar nicht klar erfasst“ hätten. Er ging sogar soweit zu behaupten, die Entscheidung für die Quote könne „mit der Einführung des Frauenwahlrechts vor 70 Jahren in einem Atemzug genannt werden“. [16]
In einer offenen Abstimmung stimmten 416 der Parteitagsdelegierten mit Ja, 54 mit Nein. Warum ein solch entscheidender Schritt für die SPD in offener und nicht der Bedeutung entsprechend in geheimer Abstimmung beschlossen wurde, hatte hinter vorgehaltener Hand schon auf dem Münsteraner Parteitag Fragen hinterlassen. Vogel, der ein Jahr zuvor überraschend zum Parteivorsitzenden gewählt worden war, hatte seine ganze politische Autorität in die Waagschale geworfen und hinter den Kulissen mit Hilfe der Parteifrauen, der Parteilinken und seinen Getreuen aus der Bundestagsfraktion äußert geschickt an den Strippen gezogen. Auch eine große Zahl weiblicher Parteitagsgäste tat das ihre, lautstark ihre Sympathien und vor allem auch Antipathien zu zeigen. Jedem war klar, die Entscheidung zugunsten der Quotenregelung war schon vor dem Münsteraner Parteitag eine ausgemachte Sache.
Damit wurde für alle Parteigliederungen – vom Ortsverein, von den Unterbezirken, den Bezirken, den Landesverbänden, bis zur Bundesebene (Parteitag, Parteirat, Parteivorstand, Präsidium sowie den unterschiedlichen Parteikommissionen) – die „Geschlechter-Quote“, wie sie bald hieß, bei der Wahl von Funktions- und Mandatsträgern verbindlich festgelegt. Nach dem neuen Statut sollten „ab sofort“ ein Drittel und von 1994 an 40% Frauen bei der Vergabe von Parteiämtern berücksichtigt werden. Bereits auf dem Parteitag in Münster machte die SPD mit der neuen Quotenregelung ernst. Auf getrennten Männer- und Frauenlisten und entsprechenden Wahlgängen wurde von den Delegierten der neue Parteivorstand gewählt.
Bei der Wahl zum neuen Parteivorstand wurde dann die Zielvorgabe für die Frauen in nur zwei Wahlgängen spielend erreicht. Bei den Männern wurde dagegen elend lange gewählt bis ein Ergebnis feststand. Der Wahlvorgang mit vier Wahlgängen dauerte insgesamt 8 Stunden. Mit knapper Not wurden im vierten Wahlgang der Bremer Bürgermeister Hans Koschnick, der ehemalige Bundesbildungsminister Klaus von Dohnanyi, der außenpolitische Sprecher der SPD Bundestagsfraktion, Karsten Voigt[17] gewählt. Als Schlusslicht schlitterte der stellvertretende Vorsitzende und wirtschaftspolitische Sprecher der SPD Bundestagsfraktion, Wolfgang Roth noch gerade durch. Auf der Strecke blieben Peter Glotz, enger Vertrauter Willy Brandts und langjähriger Bundesgeschäftsführer der Partei sowie der stellvertretende Vorsitzende und finanzpolitische Sprecher der SPD Bundestagsfraktion, Hans Apel[18]. Apel war ein enger Vertrauter von Helmut Schmidt, Bundesfinanz- und Bundesverteidigungsminister in der sozialliberalen Koalition. Doch das Ziel einer 33% Quote für Frauen wurde erreicht: Neben 24 Männern waren jetzt 12 Frauen im Parteivorstand vertreten. Das war die Hauptsache.
Die Bochumer Entfristung
Auf dem Münsteraner Parteitag 1988 war für alle Delegierten klar, dass eine Überrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen mit Hilfe einer verbindlichen Quotenregelung nur gerechtfertigt ist, wenn sie befristet, also für einen bestimmten Zeitraum gilt. Prof. Ingwer Ebsen hatte in seinem Gutachten für den SPD Parteivorstand ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Quotenregelung nur als zeitlich befristetes Mittel zur Erhöhung des Mitgliederanteils verfassungsrechtlich legitimiert sei.
Auf dem Parteitag hatte das Parteiratsmitglied Helmut Kuhn an Ebsens Ausführungen angeknüpft: Dass man sich mit dem Projekt der Quotenregelung in die Nähe der Fragwürdigkeit gegenüber der Verfassung und der Gesetze begebe, sei in der Diskussion deutlich geworden. „Ingwer Ebsen selber sagt ja, nur deswegen, weil die vorgeschlagene Regelung eine Anstoßfunktion auf Zeit habe, müsse man sie auch wieder verlassen.“[19] Auch der – neben Partei- und Fraktionsvorsitzendem Hans Jochen Vogel – Hauptbefürworter einer verbindlichen Quotenregelung, der frühere Bundesjustizminister Gerhard Jahn, hatte sowohl auf dem Parteitag in Münster als auch in diversen Beiträgen vor und nach dem Parteitag auf diesen Aspekt der Quotenregelung ganz besonderes Gewicht gelegt: Weil es darum gehe, einen Teufelskreis (Jahn meinte die strukturelle gesellschaftliche Benachteiligung von Frauen einerseits und ihr mangelndes politisches Engagement andererseits) zu durchbrechen, sei die „vorgeschlagene Quotierung in ihrer, die Frauen im Verhältnis zu ihrem Mitgliederanteil sogar bevorzugenden Form nur zeitlich begrenzt vorgesehen“.[20]
Selbst in der Begründung des Quoten-Antrags auf dem Münsteraner Parteitag führte die Vorsitzende der ASF, Inge Wettig-Danielmeier – allerdings ziemlich nebulös – aus: „Im Übrigen haben die SPD und die ASF die Quotenregelung schon immer als Übergangsregelung angesehen, um die Verhältnisse neu zu regeln. Aber langfristig ist die Quotenregelung in einer Partei, die der Gleichheit verpflichtet ist, nach unserer Überzeugung überflüssig.“[21] Der Quotenbeschluss von Münster sah deshalb folgerichtig die zeitliche Befristung der Quotierung bis zum Jahre 2013 vor.
Auf dem Parteitag in Bochum hat die SPD dann – auf Antrag der ASF (Antrag 244) – diese Befristung ohne Debatte sang- und klanglos aufgehoben. Die Vorsitzende der ASF und Antragsbegründerin, Karin Junker, meinte, die „Frauenquote“ sei in Wahrheit eine quotenmäßige „Mindestabsicherung für beide Geschlechter“. Das war aber nichts anderes als eine semantische Umdeutung, der sich die ASF schon sehr früh bediente, um zu verschleiern, dass es bei der Quotenregelung um die zeitlich befristete Bevorzugung von Frauen geht. Die „Mindestabsicherung für beide Geschlechter“ sei „im Zweifelsfall auch eine Garantie für Männer, ihren geschlechtergerechten Anteil an Funktionen und Mandaten zu erhalten. Darauf legen wir großen Wert.“[22]
Die bittere Bilanz der Quotenregelung
Es sei vorherzusehen, schrieb Gerhard Jahn in einem Artikel für die Parteizeitung „Vorwärts“, dass längst vor Erreichen des vorgesehenen Endes der Maßnahme (das ist im Jahr 2013 K.F.) die Quotierung praktisch kein Thema mehr sein werde. „Deshalb wird nach einer -zugebenermaßen für Männer schmerzlichen, weil ihre Chancen schmälernden – Umstellungsphase auch die Zusammenarbeit von Männern und Frauen in der Partei keine Schwierigkeiten bereiten. Wenn erst die geschlechtsspezifische Benachteiligung (heute die von Frauen, für eine zeitlich begrenzte Anstoßphase die der innerparteilich aktiven Männer) überwunden sein wird, wird das Geschlecht ebensowenig eine Rolle für die politische Karriere spielen wie heute die Konfession.“ [23]
Richtig ist, dass das Geschlecht heute weit weniger eine Rolle für die politische Karriere spielt als vor dreißig Jahren. Nur dazu hätte es – wie Beispiele heute zeigen – nicht einer verbindlichen Quotierung bedurft. Die CDU hat als erste Partei eine weibliche Vorsitzende gewählt und sie stellte auch die erste Bundeskanzlerin, die FDP die erste Fraktionschefin im Deutschen Bundestag – ganz ohne die verbindliche Quotierung. Dagegen hat die SPD bisher weder eine weibliche Parteivorsitzende noch eine weibliche Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag. Von den traditionell mächtigen 20 Landes- und Bezirksvorsitzenden sind gerade einmal 2 weiblich.
23 Jahren Quotenregelung: abschreckend und frustrierend
Wie nicht anders zu erwarten, hat die SPD auf allen Parteiebenen die Quotenregelung penibel umgesetzt. Der Frauenanteil im höchsten Führungsgremium der Partei, dem Parteipräsidium, liegt derzeit bei 47%[24], im Parteivorstand sind 40% Frauen, im Parteirat, dem wichtigsten Entscheidungsgremium zwischen den Parteitagen, liegt die Frauenquote bei 43,6%. Der Frauenanteil auf den Bundesparteitagen liegt seit 1990 bei weit über der Muss-Quote von 40%. Auch bei den Landes- und Bezirksvorstände beträgt der Frauenanteil im Durchschnitt zwischen 40 und 50%. Ausnahmen sind die Bezirke Braunschweig mit 33,3% und Hannover mit 39,1% bzw. der Landesverband Saar mit 34,8%, dem Heimatverband der Vorsitzenden der ASF, Elke Ferner. Selbst bei den Kreisverbänden liegt der Frauenanteil im Durchschnitt noch bei 37%.
Ein völlig anderes Bild finden wir auf der lokalen Ebene, dort, wo die ehrenamtliche, häufig frustrierende Knochenarbeit der Mitglieder vor Ort gemacht werden muss. In den Ortvereinen, den Abteilungen der Partei, den Kommunalparlamenten, wo die täglichen Sorgen der Bürger im Vordergrund stehen, das Kleinklein der Politik ansteht. Hier ist die Anerkennung gering, der Unmut der Bürger hautnah spürbar. Hier auf lokaler Ebene weiß man nichts vom Glanz der öffentlichen Wahrnehmung. In noch nicht einmal jedem fünften Ortsverein (18,8%) steht eine Frau als Vorsitzende vor. Immerhin haben in den Vorständen der Ortsvereine Frauen fast 30 Prozent der Ämter inne. Überhaupt gilt: In den Basisorganisationen der Partei ist das aktive Engagement der Frauen weit geringer als der weibliche Mitgliederanteil von gut 30% vermuten lässt.
Bei der Bundestagswahl im Jahre 2009 stieg der Frauenanteil in der SPD Bundestagsfraktion auf 38,5 Prozent. Im Vergleich der Bundesländer hat der Landesverband Sachsen-Anhalt mit 66,7% den höchsten Frauenanteil. Von 4202 SPD Mitgliedern in Sachsen-Anhalt sind nur 1136 Frauen, das ist ein Anteil von 27%. Nur 19% Frauen fanden sich bereit, in einem Ortsverein den Vorsitz zu übernehmen. Die Landesgruppe Brandenburg in der SPD-Bundestagsfraktion hat einen Frauenanteil von 60%, bei den Mitgliedschaft liegt er bei 28%, der Anteil der weiblichen Ortsvereinsvorsitzenden liegt bei 23% . Im Landesverband Berlin sind 33% der Mitglieder Frauen, nur 28% der lokalen Parteigliederungen, den Abteilungen, werden von Frauen geleitet, dagegen sind 60% der Bundestagsabgeordneten aus Berlin Frauen. Wenn auch nicht so krass: Verhältnisse wie in Sachsen-Anhalt, Brandenburg oder Berlin gibt es strukturell in allen Landesparteien.
Die Quotenregelung hat den für die SPD typischen Karriereweg ihrer Spitzenpolitiker, die „Ochsentour“, wie er genannt wurde, aus den Angeln gehoben. Das „Hochdienen“, wie die „Ochsentour“ verächtlich genannt wird, von unten (Schriftführer, Kassierer, Ortsvereinsvorsitzender) nach oben (Delegierter auf Landes- und Bundesparteitagen, Mitglieder des Bezirks-, Landes-, Bundesvorstandes) war für den Weg eines Spitzenpolitikers in der SPD typisch. Diese „Ochsentour“ war aus verschiedenen Gründen von elementarer Bedeutung: Man lernte das politische Handwerk von der Pike auf, kannte sich in der Partei aus, war bei Wählern bekannt, hatte sich in vielen Wahlkämpfen als Redner, Organisator bewährt. Die „Ochsentour“ war ein Qualitätsausweis. Wer sie geschafft hatte, konnte mitreden, wusste Bescheid, ließ sich nichts mehr vormachen.
Quotenfrauen haben es bei ihrer „Ochsentour“ in der Regel um einiges leichter. Die Hürden zu Ämtern und Funktionen in der Partei werden meist spielend übersprungen, Mandate in Parlamenten werden relativ schnell erreicht. Zumindest sehr viel schneller und leichter als für männliche Mitbewerber. In den Ortvereinen, den Kreisen und Bezirken werden nicht selten händeringend Genossinnen gesucht, die sich für eine Kandidatur zur Verfügung stellen. Zwar ist es selten – immerhin kommt es vor -, dass Frauen – kaum dass sie die Parteimitgliedschaft erworben haben – auch schon in einem Landesparlament oder sogar im Bundestag sitzen. Fest steht: Weibliches Führungspersonal steigt auf der „Ochsentour“ weiter oben ein, die unteren Ränge werden meist übersprungen.
Es kann kaum verwundern, dass das Ergebnis von fast einem Viertel Jahrhundert Quotenregelung dem männlichen Teil der Partei als frustrierend, ja abschreckend und demotivierend erscheint: In den Spitzenpositionen von Partei und Staat werden Frauen in die Ämter quotiert, während Männer in den 10.000 Ortsvereinen die Arbeit vor Ort erledigen.
Ziel verfehlt
In seinem Schlusswort auf dem Münsteraner Quotenparteitag hatte der Parteivorsitzende Hans Jochen Vogel prognostiziert, der Quotenbeschluss werde „in der nächsten Zeit vielen Frauen den Weg zu uns erleichtern“.[25] Das war ein Irrtum, wie sich schon bald herausstellen sollte. Das Ziel der Quotenregelung, die SPD für Frauen attraktiver zu machen und damit mehr weibliche Mitglieder zu gewinnen, ist gründlich verfehlt worden. Nach dem Quotenparteitag nahm zwar drei Jahre lang die Zahl weiblicher Mitglieder leicht zu – von 240.325 (1988) auf 251.559 (1991), also um 11.234. Das war ein Anstieg um knapp 4,7%. Allerdings: In den drei Jahren vor der Einführung der verbindlichen Quotierung (also in den Jahren 1985 bis 1988) stieg die Zahl der weiblichen Mitglieder immerhin um 9009 oder 3,9%. Einen Quantensprung nach Einführung der verbindlichen Quotierung nennt man das wohl nicht.
Aber es kam noch schlimmer. Nach nur drei Jahren eines eher mageren Anstiegs ging es rapide bergab – unaufhaltsam. Einen solch unumkehrbaren Abwärtstrend hatte es nach dem zweiten Weltkrieg noch nicht gegeben. 1993 war schon wieder das Niveau von 1988 erreicht. 1998, dem Jahr der vollen Wirksamkeit der Quotenregelung, wurden 224.213 weibliche Mitglieder gezählt. Gegenüber 1988 ein Rückgang von 16.112 oder knapp 7%. 2009 zählte die Partei dann nur noch 159.893 weibliche Mitglieder (Stand 31.12.2009). Das war ein Rückgang gegenüber dem Jahr der Einführung der Quotenregelung von 33,5%. Vor dem Quotenbeschluss war der Entwicklungstrend ein ganz anderer: Von 1965 an nahm die Zahl der weiblichen Mitglieder – von einigen wenigen Schwankungen einmal abgesehen – kontinuierlich zu. 1965 waren 123.565 Frauen Parteimitglieder, 1988 waren es 240.325, also ein Anstieg von 116.760 oder 94,5%.
Der Anstieg des Frauenanteils an der Mitgliederschaft ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass deutlich mehr Männer die Partei verließen als Frauen. 1988 gab es 671.591 Männer in der SPD, 2009 waren es nur noch 352.626 (Stand 31.12.2009). 318.955 männliche Parteimitglieder gaben seit dem Quotenparteitag im Jahr 1988 ihr Parteibuch zurück. Das ist ein Rückgang von knapp 47,5%. In den 23 Jahren vor dem Quotenbeschluss nahm die Zahl der Männer leicht zu. Waren im Jahr 1965 586.883 Männer in der Partei, so lag die Zahl der Männer 1988 bei 671.591. Das war ein Anstieg von 84.708 oder 14,4%. Dem Rückgang männlicher Mitglieder von 47,5% steht der Rückgang weiblicher Mitglieder von 33,5% gegenüber. Das erklärt die leichte Zunahme des Frauenanteils an der Gesamtmitgliederschaft. Eine bittere Bilanz.
Die SPD schrumpft sich der Gleichstellung entgegen. Wie ein Witzbold sarkastisch meinte, bis zur tatsächlichen Gleichstellung der Geschlechter in der SPD gibt es noch immer 200.000 männliche Mitglieder zu viel…
Anmerkungen
[1] Ingwer Ebsen, Verbindliche Quotenregelungen für Frauen und Männern in Parteistatuten, Tübingen 1988,
S. 9. Der Staatsrechtler Ingwer Ebsen hatte im Auftrag des SPD Parteivorstandes das Gutachten erarbeitet. Als Befürworter der Quotenregelung ist er juristischer Kronzeuge in der innerparteilichen Auseinandersetzung vor Münster gewesen. Allerdings wurden entscheidende Passagen seines Gutachtens wissentlich oder unwissentlich übersehen.
[3] Redebeitrag G. Jahn, In: Protokoll des SPD-Parteitages in Münster am 30. 8. 1988, Seite 102f
[4] Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, Bd. 109, S. 89, Tübingen 2004
[5] Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, Bd. 85, S. 207, Tübingen 1995
[6] Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, Bd. 109, S. 90, Tübingen 2004
[7] Diese Benachteiligung setzt am passiven Wahlrecht an, was nichts anderes bedeutet, als dass die Wählbarkeit der Männer beschränkt wird.
[8] Redebeitrag Hermann Bachmeier, In: Protokoll des SPD-Parteitages in Münster am 30. 8. 1988, Seite 101f
[9] Redebeitrag Ulrich Lang, In: Protokoll des SPD-Parteitages in Münster am 30. 8. 1988, Seite 109
[10] vgl. Beschluss zur Gleichstellungspolitik der SPD auf dem Nürnberger Parteitag 25.- 29.8.1986
[11] Ludwig Stiegler, Wieviel „Quoten“ braucht die SPD? In: Die Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte Nr. 1, 1988, S. 13
[12] Redebeitrag Karin Junker, In: Protokoll des Bundesparteitages, Bochum 2003, S. 201
[13] SPD-Pressedienst vom 16. Juli 1985
[14] Ingwer Ebsen, Verbindliche Quotenregelungen … S.25f
[15] Redebeitrag Hans-Jochen Vogel, In: Protokoll des SPD-Parteitages in Münster am 30. 8. 1988, Seite 550f
[17] Karsten D. Voigt nach der Wahl: „Da müht man sich seit Jahrzehnten für die Partei – und dann dies!“ Jahrbuch,… S. 186
[18] Hans Apel hat in seinem Tagebuch die Stimmung in den Führungsgremien der Partei beschrieben: „In persönlichen Gesprächen hält niemand diese Quotierung für sinnvoll. Auch die meisten Frauen sind dagegen, sie ziehen einen politischen Aufstieg ohne die Krücke der Quote vor. Auch sie befürchten, daß sich künftig weniger qualifizierte Männer in der SPD engagieren, weil ihre Aufstiegschancen über Jahre blockiert sind. Doch bis auf wenige Ausnahmen sind wir alle elende Feiglinge. Wir haben Angst vor der organisierten Kraft der Frauen in der ASF und hoffen, daß der Kelch der Quote an uns vorübergeht.“ (Hans Apel, Der Abstieg, Politisches Tagebuch 1978-1988, Stuttgart 1990, S. 450). Doch der Kelch ging weder an der Partei noch an Apel vorüber.
[19] Redebeitrag Helmut Kuhn , In: Protokoll des SPD-Parteitages in Münster am 30. 8. 1988, Seite 114
[20] Gerhard Jahn, Quotierung: der einzige Weg zur Gleichheit, in: Vorwärts Nr. 29, 16. Juli 1988, S. 15
[21] Redebeitrag Inge Wettig-Danielmeier, In: Protokoll des SPD-Parteitages in Münster am 30. 8. 1988, S. 88.
[22] Redebeitrag Karin Junker, Protokoll des Bundesparteitages der SPD, Bochum 17.-19. 11. 2003, S. 201
[23] Gerhard Jahn, Quotierung: der einzige Weg zur Gleichheit, In: Vorwärts Nr. 29. 16. Juli 1988, S. 15
[24] Alle nachfolgenden Zahlen stammen aus den diversen „Gleichstellungsberichten der ASF“ für die Bundesparteitage der SPD.
[25] Redebeitrag Hans-Jochen Vogel, In: Protokoll des SPD-Parteitages in Münster am 30. 8. 1988, Seite 551